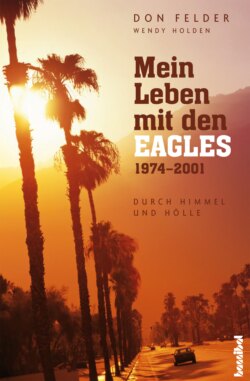Читать книгу Mein Leben mit den Eagles - Wendy Holden, Don Felder - Страница 8
ОглавлениеDREI
Das Radio in der Poliklinik machte mich erstmals mit den Freuden der Musik vertraut. Mein Vater förderte dieses frühe Interesse, da das etwas war, was wir gemeinsam hatten. Egal, wie arm wir auch waren, er besaß immer irgendeine Musikanlage, auf der man Dreiunddreißiger- und Fünfundvierziger-Vinylplatten abspielen konnte. Als ich alt genug war, um dies entsprechend zu würdigen, war unsere aus Einzelteilen zusammengeschusterte Unterhaltungsanlage das größte Möbelstück im Wohnzimmer. Nach einem harten Arbeitstag kam Papa nach Hause, wusch sich, machte es sich bequem und hörte sich ein paar Tonbänder an. Es war die einzige echte Fluchtmöglichkeit aus dem Leben, in das er hineingeboren worden war. Das und das Fernsehen – wenn ich auch glaube, dass wir bestimmt die letzte Familie in Gainesville waren, die sich ein Gerät leistete. Es war so groß und wuchtig, dass es wie eine hölzerne Waschmaschine mit einer übergroßen Scheibe aussah.
Er lieh sich immer Langspielplatten von seinen Freunden aus, spielte sie auf seinem Plattenspieler ab und nahm sie auf seinem gebrauchten Tonbandgerät der Marke Voice of Music auf. Er wusste, dass es sich dabei um illegale Raubkopien handelte, aber mehr konnte er sich nicht leisten. Wenn ihn etwas zu langweilen begann, löschte er es wieder, lieh von jemand anderem eine Platte aus und nahm sich diese dafür auf. Bald besaß er eine umfangreiche Sammlung von Leuten wie Tommy Dorsey, Lawrence Welk, Benny Goodman und Glenn Miller. Bis heute muss ich an meinen Vater denken, wenn ich „Moonlight Serenade“ höre.
Ihm verdanke ich auch meine erste Berührung mit Jazz und Country. Na ja, ihm und der Grand Ole Opry. Wir hörten uns die aus dem Ryman Auditorium übertragene Sendung immer auf WSM Radio an, bis wir uns einen Fernseher kauften und sie freitag- und samstagabends live aus Nashville sehen konnten. Trotz der minderen Qualität des Fernsehgeräts hatten wir den besten Empfang im Viertel, weil Papa eine ausgeklügelte Ringantenne gebastelt hatte. Wenn man den Kanal wechselte, drehte sie ein Motor in die richtige Richtung. Ich fand das ziemlich klasse.
Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich eines Sonntagabends im Jahr 1957 Elvis Presley in der Ed Sullivan Show sah und völlig ausflippte. Er sang „Hound Dog“, „Heartbreak Hotel“ und „Love Me Tender“, und ich war vollkommen von den Socken. Obwohl er aufgrund der Beschwerden über die sexuelle Natur des Tanzstils von „Elvis the Pelvis“ (Elvis das Becken) nur von der Hüfte aufwärts gezeigt wurde, hatte ich noch niemanden gesehen, der sich so bewegte. Wenig später gab es eine wahre Flut von Musik namens Rock ’n’ Roll, und ich begriff sofort, dass dies genau das Richtige für mich war. Etwas daran ließ mir regelrecht die Nackenhaare zu Berge stehen.
Meine ersten Erfahrungen mit der technischen Seite von Musik verdanke ich ebenfalls meinem Vater. Eines Tages rief er mich zu seinem Tonbandgerät herüber, das aus zwei Boxen bestand. In der einen befanden sich das Bandabspielgerät und ein winziger Breitbandlautsprecher, in der anderen ein kleiner Verstärker und ein zweiter Lautsprecher. Ohne weitere Erklärungen baute er ein Mikrofon auf, stellte es vor mich hin und instruierte mich: „Okay, Doc, ich möchte, dass du laut die ungeraden Zahlen aufsagst.“
Wie mir geheißen ward, zählte ich: eins, drei, fünf, sieben und so weiter. Nachdem er das Band zurückgespult hatte, spielte er es ab und sagte: „So, wenn du jetzt ‚eins‘ hörst, dann beginne, die geraden Zahlen aufzusagen.“
Nach wenigen Minuten spielte er mir das fertige Resultat vor. Durch die mit dem Stereoeffekt gegebene Möglichkeit einer Zweispuraufnahme hörte ich nun, wie meine Stimme auf dem linken Kanal „eins“ sagte und dann auf dem rechten Kanal „zwei“. Es war die erste Zweispuraufnahme, die ich je gehört hatte, und ich dachte: „Mein Gott, das ist ja unglaublich!“ Da war es um mich geschehen.
Zuallererst brauchte ich dringend eine Gitarre. Die Elvis-Welle war über Amerika geschwappt, und eine Gitarre war plötzlich das tollste Instrument, das man spielen konnte. Ich war mit der Gitarren- und Banjomusik aus Nashville großgezogen worden, und es gab kein anderes Instrument, für das ich mich auch nur im Entferntesten interessierte. Als ich elf war, schienen alle im Block außer mir Gitarre zu spielen. Das Problem war nur, dass ich kein Geld hatte, um eine zu kaufen. Ich war völlig niedergeschlagen, bis ich plötzlich entdeckte, dass ich eventuell etwas Wertvolles zu verkaufen hatte: Knallfrösche. Jerry und ich kauften sie immer, wenn wir Onkel W. L. in Karolina besuchten, und brachten sie mit nach Hause nach Florida, wo sie verboten waren. Wenn man einen in die Abflussrinne aus Beton vor unserem Haus warf, gab es einen solchen Knall, dass alle Kinder in der Straße angerannt kamen, bevor sich noch das Schießpulver verzogen hatte.
Der Junge auf der gegenüberliegenden Straßenseite besaß genau so eine Akustikgitarre, wie ich unbedingt eine wollte, also fingen Jerry und ich eines Tages an, Knallfrösche zu werfen. Wie geplant, kam der Junge sofort heraus. „Hey, kann ich ein paar davon haben?“, fragte er mit leuchtenden Augen.
„Klar“, sagte ich und tat recht geschäftsmäßig. „Aber es kostet dich diese alte Gitarre, die oben auf deinem Schrank liegt.“ Sie war ein grässliches Instrument mit drei fehlenden Saiten und voller Löcher, aber sie war meine erste große Liebe. Ich nahm sie mit zum Gemischtwarenhändler und kaufte für meine letzten Ersparnisse neue Saiten. Ein Nachbar zeigte mir, wie man mein neues Spielzeug stimmte und sich durch die ersten, schmerzvollen D- und G-Akkorde ackerte. Ich nahm den Schaukelstuhl auf der Veranda meiner Eltern in Beschlag, wo ich stundenlang übte. Ich saß ihn beinahe durch.
Später kratzte ich, mit einem kleinen Zuschuss von Papa, ein kleines Vermögen zusammen und schickte achtundzwanzig Dollar an Sears, Roebuck & Co., wo ich eine Silvertone Archtop bestellte, was mir damals als Gipfel musikalischer Finesse erschien. Eine Woche lang kam ich jeden Morgen zu spät zur Schule, weil ich darauf wartete, dass sie endlich mit der Post geliefert wurde. Ich kann mich immer noch gut an den stechenden Geruch nach frischem Lack erinnern, als ich den Koffer das erste Mal öffnete. Ich hatte noch nie etwas so Glänzendes, Poliertes und Neues besessen. Auf meine Gitarre achtete ich mit unglaublicher Sorgfalt. Alles andere hatte ich von Jerry aufgetragen: seine Kleider, seine Schuhe, sogar sein altes Fahrrad. Dies war der erste Gegenstand, der mir ganz allein gehörte. Musik war auch das Einzige, worin ich besser war als Jerry. Er beherrschte gerade mal ein paar Akkorde auf dem Klavier. Es war darüber hinaus die einzige Aktivität, zu der mich mein Vater direkt ermunterte. Dieser doppelte Anreiz – meinem Vater zu gefallen und in etwas besser als mein Bruder zu sein – genügte mir vollauf, um mich richtig in die Sache reinzuknien.
Papa schien es wirklich zu freuen, dass ich mich für etwas begeisterte und nicht nur Tagträumen nachhing. Als alter Bastler nahm er die Rückverkleidung des Fernsehers ab und entdeckte, dass es dort eine kleine Buchse gab, wo ich meine Gitarre einstöpseln und so über die Lautsprecher des Geräts spielen konnte. Jeden Samstagmorgen, wenn mein Bruder Baseball spielen und meine Eltern bei der Arbeit waren, stöpselte ich mich ein, sah mir Zeichentrickserien wie Mighty Mouse und Winky Dink and You an und erfand währenddessen die Musik dazu. Vor den Leuten in der Fabrik prahlte Papa mit mir. „Mein Jüngster hat ein gutes Gehör“, sagte er stolz. „Ich glaube, er ist ein Naturtalent.“
Eines Tages hörte er zufällig, wie sich einer seiner Kumpels darüber beklagte, dass er seiner Tochter eine elektrische Gitarre gekauft habe, auf der sie nie spiele. „Das verdammte Ding steht nur in ihrem Schrank und verstaubt“, stöhnte er.
„Ah ja?“, kommentierte Papa, der wusste, dass mir die Silvertone längst nicht mehr genügte. An jenem Abend kam er etwas später nach Hause und erzählte mir von der elektrischen Gitarre. „Wenn wir rübergehen, um sie uns anzusehen, dann tu so, als wäre dir das Ganze egal“, schärfte er mir ein.
Es handelte sich um eine cremefarben-goldene Fender Mustang in einem kleinen Tweedkoffer. In dem Augenblick, in dem ich die Gitarre zu Gesicht bekam, flog unser Trick auf. Papa konnte aus meinem Gesichtsausdruck ablesen, dass er bereits jetzt kein gutes Geschäft mehr machen würde. Es war vermutlich die billigste Fender, die es für Geld zu kaufen gab, und mit ihrem goldenen Schlagbrett sah sie aus wie eine Mädchengitarre, aber ich hatte mich verliebt. Ich wollte sie unbedingt haben, besonders, als ich sah, dass noch ein kleiner Verstärker dazugehörte, der kaum größer als ein Kofferradio war. Stolz nahm ich sie mit nach Hause und spielte so lange, bis meine Finger bluteten. Papa half mir, den Verstärker so aufzurüsten, bis er einem Fender Deluxe entsprach, und das war schon etwas. Nun musste ich nur noch meine musikalischen Fertigkeiten verbessern.
Ich übte und übte, und sobald ich dachte, ich wäre gut genug, machte ich mich auf zum State-Theater-Kino. Samstagmorgens liefen dort für fünfundzwanzig Cent Filme wie Das Ding aus dem Sumpf oder King Kong, und die meisten Jugendlichen aus Gainesville gingen hin. Meistens veranstaltete das Kino direkt im Anschluss an die Vorstellung einen Talentwettbewerb. Viele Jugendliche kamen früh, zahlten ihren Vierteldollar und bekamen mehr fürs Geld – einen Film und ein paar begabte Amateure.
Als ich die Bühne betrat, um meinen ersten öffentlichen Auftritt zu absolvieren, war ich gerade elf Jahre alt, hatte mein weißblondes Haar gescheitelt und trug meine beste Sonntagshose und mein bestes Hemd. Ein Schauder überkam mich. Ich war so nervös, dass meine noch unbehaarte Oberlippe schweißnass wurde. Mein Hemd klebte mir am Rücken, und mein Gesicht wurde knallrot. Mit äußerster Konzentration legte ich meine Finger auf die korrekten Positionen und spielte die ersten Takte von „Red River Valley“, einem sentimentalen amerikanischen Countrysong, den ich Porter Wagoner schon ein Dutzend Mal in der Grand Ole Opry hatte spielen hören. Es war nicht gerade Elvis, doch ich hatte noch nicht den Mut, die Bewegungen, die ich stundenlang in meinem Zimmer geübt hatte, öffentlich aufzuführen.
Im Publikum waren nur wenige Leute, die ich kannte. Der Rest waren vollkommen Fremde, und das machte es in gewisser Weise leichter. Sie lümmelten auf ihren Plätzen, redeten und lachten, tranken Softdrinks und bewarfen sich gegenseitig mit Popcorn, während ich spielte.
Ich sang nicht oder so. Ich konnte gar nicht. Ich hatte damals wenig bis kein Vertrauen in meine Stimme und hätte ohnehin nicht genügend Spucke produziert, um meine Stimmbänder zu befeuchten. Noch konnte ich verhindern, dass sich mein Mund seltsam bewegte, während ich die schwierigsten Teile des Stücks auf dem Griffbrett spielte. Ich hoffte nur, dass diejenigen, die vorn an der Bühne saßen, dachten, ich würde den Text vor mich hin murmeln.
Ich stand einfach nur stocksteif da und spielte Gitarre. Die Resonanz darauf war zunächst wenig begeistert, doch nach einer Weile kehrte eine gewisse Stille ein, und ich bemerkte, dass einige der Kids tatsächlich zuhörten. Ich gestattete mir ein kleines Lächeln, ging das Ganze nun entspannter an und spielte mit mehr Selbstvertrauen. Ich wich sogar ein wenig von dem Song ab und baute einen kleinen Improvisationsteil ein. Als ich den letzten Chorus erreichte, gab es nicht gerade stehende Ovationen, aber ich wurde nicht ausgebuht oder mit Pappbechern beworfen. Ich wusste, dass dies ein gutes Zeichen war.
Als ich den letzten Akkord verklingen hörte, richtete sich mein Blick auf ein paar hübsche junge Mädchen in der zweiten Reihe, die mich aus irgendeinem Grund mit einem Ausdruck der Bewunderung in den Augen anstrahlten. Ich wusste, dass ich meinen Weg gefunden hatte. Als ich wie benom-men von der Bühne stolperte, als wäre ich gerade aus einem langen Traum erwacht, hatte ich keine Wahl mehr. Von jenem Tag an sollte mein Leben nie mehr dasselbe sein.
Die Pubertät war für mich, wie für viele Teenager, eine Zeit unangenehmer Verwirrung. Haare sprossen, die Knochen wuchsen, Pickel blühten, ich kam in den Stimmbruch, und alle möglichen beunruhigenden Gedanken schlichen sich in meinen Kopf. Hitzewellen durchfuhren meinen Körper, wenn ich nur an ein Mädchen dachte. Eine nähere Begegnung mit jemandem wie Sharon Pringle hätte mich wahrscheinlich umgebracht.
Zu den rein körperlichen Veränderungen kamen noch unvorhergesehene psychologische – so war mir bis zu meinem ersten Tag an der F. W. Buchholz High School nicht ganz klar, wie verarmt meine Familie wirklich war. Beinahe über Nacht entdeckte ich völlig neue Bereiche der Peinlichkeit. Ich musste mich nur umschauen und die Kleidung, Fahrräder und sogar Autos der anderen mit meinen eigenen spärlichen Besitztümern vergleichen, um zu verstehen, was ich war: bettelarm. Mit dieser Erkenntnis stieg ein schneidendes, stechendes Schamgefühl in mir auf.
Freunde wie Kenny Gibbs, dessen Vater ein Möbelgeschäft in der Stadt besaß, lebten in neuen Betonhäusern mit Klimaanlagen, wovon ich nur träumen konnte. Bald verbrachte ich mehr und mehr Zeit bei ihm zu Hause und genoss die dauerhaft kühle Luft sowie andere ungeahnte Luxusgüter wie einen Farbfernseher und einen Kühlschrank voll mit Schokoriegeln und Coca-Cola, aus dem wir uns nach Herzenslust bedienen durften. Bereitwillig nahm ich eine Einladung seiner Mutter an, über Nacht zu bleiben, einfach nur, um herauszufinden, wie es war, einmal nicht in einer Schweißpfütze zu liegen.
Selten, wenn überhaupt lud ich Kenny zu mir nach Hause ein. Auch sonst niemanden, um genau zu sein. Meine übliche Ausrede war, dass Mama zu Hause wäre oder mein Bruder lernte. Alles, was mit meinen Eltern zu tun hatte, erschien mir in meiner halbwüchsigen Gedankenwelt auf einmal unerträglich. Ihr Englisch wirkte so gebrochen; sie waren nicht so beredt wie die Eltern der anderen. Ich dachte, in dem Augenblick, wo ihnen jemand begegnete, würde man wissen, dass ich aus bescheidenen Verhältnissen stammte.
Hin und wieder jedoch wurde mein familiärer Hintergrund sichtbar und drohte mich bloßzustellen, etwa wenn mir jemand eine persönliche Frage stellte wie: „Ist dein Vater nicht Mechaniker bei Koppers?“ Oder: „Habe ich deine Mutter nicht neulich im Gebrauchtwarenladen gesehen?“ Meistens gelang es mir, so etwas abzubiegen, bevor es zu spät war. Die Musik, mein einziger Fluchtweg, blieb weiterhin meine Erlösung.
Ich konnte mir keine eigenen Schallplatten leisten, um mit den neuesten Trends Schritt zu halten, also hörte ich unablässig Radio. Ich hatte in meinem Zimmer ein altes hölzernes Gerät stehen, das schnell alle Aufmerksamkeit auf sich zog, die ich ansonsten auf die Hausaufgaben verwendet hätte. In Gainesville stellten die meisten der von Weißen betriebenen Radiostationen den Sendebetrieb bei Sonnenuntergang ein. Wenn das Wetter gut war und zwischen Tennessee und Florida nicht gerade ein heftiger Sturm tobte, konnte ich die Antenne so lange ausrichten, bis ich damit WLAC in Nashville auf der Mittelwellenfrequenz 1510 empfing, die einzige Station, die schwarze Musik sendete. Während der von Gene Nobles moderierten, knisternden Sendungen wurde ich mit Legenden wie B. B. King, Bo Diddley, Chuck Berry und Muddy Waters vertraut gemacht. Da ich Pat Boones abgestumpfte Version von „Tutti Frutti“, die den ganzen Tag auf den regulären Kanälen lief, gründlich satthatte, hörte ich nachts offenen Mundes zu, wie Little Richard seinen Kram herunterhämmerte.
Ich kämmte mir das Haar mit Pomade zur Seite, nähte mir auf der Nähmaschine meiner Mutter meine Jeans um und machte mich ernsthaft daran, die Musikszene Nordfloridas zu erobern. Ich nahm eines von Papas Bändern und begann, bei anderen Leuten Schallplatten auszuleihen – Elvis, Buddy Holly, Bill Haley And His Comets, im Grunde alles seit den Anfängen des Rock ’n’ Roll. Ich benutzte Papas Voice-of-Music-Gerät und nahm die Platten auf einem Kanal auf. Dann spielte ich dazu Gitarre auf dem anderen und versuchte, die Rock-’n’-Roll-Größen zu imitieren. Als sich mein Vater eine bessere Stereoanlage kaufte, requirierte ich sein altes Gerät und trug es vorsichtig in mein Zimmer. Ich hatte nun jeden Gedanken an höhere Bildung aufgegeben und widmete meine Nächte ganz der Musik.
Mit vierzehn hatte ich meinen zweiten öffentlichen Auftritt. Ich nahm an einem Talentwettbewerb teil und betrat die Bühne der Junior High School allein, nur mit meiner Gitarre und einem Verstärker. „Alles klar, Jungs und Mädels, einen dicken Applaus für unseren nächsten Teilnehmer – Donald Felder“, kündigte mich der Moderator unter den kreischenden Rückkopplungen seines Mikrofons an. Ich war viel nervöser als bei meinem letzten Gig, hauptsächlich deshalb, weil ich diesmal jeden im Publikum kannte. Irgendwie schaffte ich es jedoch, „Walk – Don’t Run“ von den Ventures gut genug zu spielen, dass man es noch erkannte. Es waren etwa fünfhundert Zuschauer anwesend, und die Reaktion war verblüffend. Sie schienen mich zu mögen, und gegen Ende des Auftritts hatte ich den Status einer Neuentdeckung erworben. Ebenso wie ich hatten auch meine Altersgenossen die Phase erreicht, dass sie sich mit ihren Rock-’n’-Roll-Idolen identifizierten, und ich stellte fest, dass ich – als nächstes Äquivalent – plötzlich Fans in Gainesville hatte. Das Beste daran war, dass einige davon sogar Mädchen waren. Mit meinem hübschen Äußeren und meiner schlanken Gestalt wurde ich nun, da ich auch noch musikalisches Talent bewiesen hatte, offenbar als Sahneschnittchen betrachtet. Unnötig zu sagen, dass ich meine neue Coolness genoss.
Drei Wochen nach diesem Auftritt schlug mir einer der Lehrer vor, ich solle doch die örtliche Radiostation WGGG kontaktieren, die regelmäßig die besten Amateure von Gainesville übertrug. Er begleitete mich dorthin, weil er einen der DJs kannte, und arrangierte eine Livesendung für mich. Ich stand in einem winzig kleinen Tonstudio vor einem Mikrofon und drosch zwei Instrumentalnummern herunter: „Apache“ von Jerry Lordan, das die Shadows populär gemacht hatten, und mein altes Kabinettstückchen „Walk – Don’t Run“. Einige meiner Freunde hörten die Sendung. „Gut gemacht, Don“, sagten sie zu mir. „Das war ’ne echt saubere Sache.“ Durch sie fühlte ich mich wie jemand, fast sogar wie Elvis. Bereits damals verblüffte es mich, wie ich mich in der Wahrnehmung der Leute veränderte, wenn ich nur vor ein Mikrofon trat. Der DJ, ein Typ aus Gainesville namens Jim, der im Hauptberuf als Fahrer des örtlichen Bestattungsunternehmens Williams-Thomas arbeitete, bot an, mir bei ein paar Bandaufnahmen zu helfen. Wir wurden gute Freunde und trafen uns abends immer im Schauraum des Bestattungsinstituts, wo wir neben den Sockeln mit den offenen Särgen Frisbee spielten.
Ich stellte eine kleine Schulband mit Kenny Gibbs und dessen Bruder zusammen, und wir probten regelmäßig in ihrer Garage. Seine Mutter wollte, dass wir uns Moonbeams nannten, aber wir fanden den Namen scheiße. Ich kann mich nicht entsinnen, wofür wir uns als Nächstes entschieden, aber irgendwann wurden aus uns die Continentals. Es war sozusagen meine Band. Ich stellte sie zusammen und ließ Karten mit meiner Telefonnummer darauf für die Buchungen entwerfen. Wie es für Teenagerbands in einer Collegestadt typisch ist, wechselten die Mitglieder ständig, je nachdem, wer Gainesville gerade wegen des Studiums verließ oder neu hinzuzog. Kenny spielte eine Zeit lang Bass – nicht weil er besonders begabt gewesen wäre; er sah einfach gut aus und wirkte anziehend auf die Mädchen. Außerdem hatte er das Geld für Equipment, was lebensnotwendig war. Es gab noch zwei weitere Bassisten, die viel besser waren: Barry Scurran, ein Collegestudent aus Miami, und ein Typ namens Stan Stannell.
Wenn ich zu einer Probe rüber zu Stans Haus ging, saß er immer schon stundenlang in seiner Unterwäsche auf dem Bett, den Fuß auf ein kleines Hockerchen gestützt, und spielte klassische Gitarrenmusik vom Blatt. Er spielte phänomenal, aber wenn man ihm eine elektrische Gitarre in die Hand gab, klang es fürchterlich. Das Einzige, was für ihn infrage kam, war der Bass, aufgrund der Ähnlichkeit zu den klassischen Gitarrentechniken. Er spielte ungefähr ein Jahr lang mit uns und zog dann weiter. Schließlich landete er als Leiter der Gitarrenabteilung am Musikkonservatorium von Boston. In meiner Band spielte vermutlich einer der besten klassischen Gitarristen des ganzen Landes Bass, und ich wusste es nicht einmal.
Unter den weiteren Musikern in den verschiedenen Inkarnationen der Band befanden sich unter anderem ein Schlagzeuger namens Jeff Williams, ein Erstsemester an der Universität, der uns ein paar klasse Auftritte bei Verbindungspartys verschaffte (wir machten falsche Altersangaben); Lee Chipley, ein Saxofonist; und ein Gitarrist und Sänger namens Joe Maestro. Ein Bandmitglied, das buchstäblich kam und ging, war ein junger Mann, der in Gainesville aus heiterem Himmel auftauchte. Er lernte Jeff bei einem Konzert kennen und fragte ihn, ob er ihm einen Platz zum Schlafen empfehlen könne.
„Ich bin dem Typen bei einer Verbindungsparty über den Weg gelaufen“, erzählte uns Jeff eines Tages. „Er kann richtig gut singen und Rhythmusgitarre spielen. Ich finde, wir sollten ihn in unsere Band aufnehmen.“
„Klasse, wie heißt er denn?“, fragte ich.
„Stephen“, entgegnete Jeff. „Stephen Stills.“
Jeff hatte recht. Stephen hatte eine der außergewöhnlichsten Stimmen, die ich je gehört hatte. Er war fünfzehn, hatte kurzes blondes Haar, war unglaublich lustig, umgänglich und selbstbewusst – einer von diesen Typen, die sich einfach so mit ihrer Gitarre hinsetzen und dazu singen. Er hatte etwas Rebellisches, Freiheitsliebendes an sich, doch war er keinesfalls ein Traumtänzer. Ich glaube nicht, dass er etwas besonders Schlimmes angestellt hatte, weil man ihn nun suchte und auf die Militärakademie stecken wollte. Er hatte sich einfach nur öfter erwischen lassen als der Rest von uns. Er wohnte eine Zeit lang bei Jeff und trat schließlich als neuestes Mitglied der Continentals mit uns gemeinsam auf.
Eines Abends hatten wir einen Auftritt bei einem Ball in Palatka und verbrachten die Nacht in einem Hotelzimmer mit zwei Doppelbetten. Ich glaube, jemand nahm uns hinten auf seinem Pick-up zum Auftritt mit. Obwohl wir minderjährig waren, gelang es uns irgendwie, eine Flasche Jack Daniel’s in die Finger zu bekommen. Am Ende sprangen Stephen, Kenny und ich auf diesen Doppelbetten herum und schrien aus vollem Hals, wie Kinder, die allein zu Hause gelassen worden sind. Wir lachten und hüpften herum, bis die Bettfedern brachen, und hatten einen Riesenspaß. Das ist wohl eine meiner schönsten Erinnerungen an diese Zeit.
Ehe ich mich’s versah, war Stephen wieder weg. Er verschwand einfach, ohne eine Erklärung oder einen Abschiedsgruß. Ich hatte stets angenommen, dass ihm der Boden unter den Füßen zu heiß geworden war, doch später hörte ich, dass er nach Tampa und anschließend nach Lateinamerika gegangen sei, als seine Familie dorthin zog. Was auch immer seine Gründe gewesen sein mögen, er löste sich schlicht in Luft auf. Ich dachte nicht, dass ich ihn je wiedersehen oder von ihm hören würde.
Im Sommer 1961 fuhr mich Papa nach Daytona Beach zu einem Auftritt von „Mister Guitar“ Chet Atkins, einer Nashville-Legende, die später für Gibson und Gretsch Gitarren entwarf. Papa und ich gingen allein hin, was eine seltene Ausnahme darstellte. Es war ein erstaunliches Konzert. Ich sah Chet mit offenem Mund zu, wie er ganz allein mit seiner Gitarre ein Publikum von zwei- oder dreitausend Fans in seinen Bann schlug. Nicht nur dass er eine unglaubliche synkopierte Anschlagstechnik mit Daumen und Fingern hatte, er hatte auch eine Methode entwickelt, wie er mit der linken und der rechten Hand gleichzeitig verschiedene Melodien spielen konnte. Auf den tieferen Saiten spielte er „Yankee Doodle“ und auf den höheren „Dixie“. Es war, als hätten sich der Norden und der Süden endlich wieder ausgesöhnt. Ich war völlig von den Socken und begann, mir seine Platten von Freunden auszuleihen, die ich in einem fast religiösen Akt kopierte. Ich lernte nach Gehör, hörte die einzelnen Töne heraus, probierte, welcher Fingersatz passte. Noten konnte ich mir nicht leisten.
Ich dachte, wenn ich auf Papas Bandmaschine Musik bei einer Geschwindigkeit von neunzehn Zentimetern pro Sekunde aufnahm und dann bei neuneinhalb wieder abspielte, wäre es eine Oktave tiefer, aber immer noch in derselben Tonart, nur halb so schnell. Auf diese Weise konnte ich jede einzelne Saite, jeden Anschlag und jeden Fingerwechsel heraushören. Ich versuchte, meine Geschwindigkeit so weit zu steigern, dass ich unisono mit Chet spielen konnte. Mit diesem „Yankee Doodle/Dixie“-Stück muss ich mich etwa ein Jahr lang abgemüht haben. Jeden Tag arbeitete ich mehrere Stunden lang daran, doch ich fand immer noch nicht ganz heraus, wie es ging. Eines Abends hatte ich die Nase voll und warf angewidert meine Gitarre vom Bett. Ich schlief ein, und irgendwie ging mein Gehirn im Lauf der Nacht alles noch einmal durch und fand die Lösung. Am nächsten Morgen nahm ich meine Gitarre und konnte das Stück zu meinem großen Erstaunen Ton für Ton spielen.
Nicht dass sich mein gesamtes Leben nur noch um Musik gedreht hätte. Für einen Jungen, der an der Schwelle zum Mannsein stand, gab es noch jede Menge weiterer Ablenkungen. Zunächst einmal aber musste ich etwas Geld verdienen, um Saiten und Tonbänder bezahlen zu können. Ich nahm ein paar Gelegenheitsjobs in der Nachbarschaft an und arbeitete jeden Samstag im Schuhgeschäft von Sharon Pringles Vater, das gegenüber vom Billigkaufhaus an der Ecke Main Street lag. Es war ein absolut schlimmer Job für einen notgeilen jungen Kerl wie mich – zu Füßen dieser ganzen hübschen jungen Mädchen zu knien und ihren Geruch zu inhalieren, während sie Schuhe anprobierten. Jedes Mal, wenn sie mich anredeten, wurde ich knallrot. Ich hielt es nicht lange dort aus. Es war einfach unerträglich.
Mein nächster Job war eine Arbeit in dem neuen Musikgeschäft in der Stadt. Lipham Music eröffnete im Einkaufszentrum, das gleich nach dem alten Gemischtwarenhändler kam, dem einzigen Laden, wo ich zuvor Saiten hatte kaufen können. Das neue Geschäft wurde von dem alten Lipham und seinem Sohn Buster betrieben und war für Gainesville und seine Big-Band-Fans revolutionär. Es gab dort weit und breit kein einziges Saxofon, keine einzige Posaune und kein Klavier – nur Gitarren und Noten. Es war ein deutliches Symbol für die neue Rock-’n’-Roll-Ära.
Als ich eines Tages vorbeischlenderte, blieb ich wie angewurzelt stehen und starrte ins Schaufenster. Dort, beinahe als hätte sie nur auf mich gewartet, stand eine Fender Stratocaster, genau so eine, wie Buddy Holly sie spielte. Direkt vor meinen Augen. In Gainesville. Ich war ziemlich pleite und hätte ein wenig Arbeit gut gebrauchen können, aber die Gitarre war zu verkaufen, und ich musste sie einfach haben. Ich öffnete die Tür und drückte mich so lange im Laden herum, bis Mister Lipham schließlich auftauchte.
„Kann ich dir helfen, mein Sohn?“, fragte er mit einem belustigten Lächeln auf dem Gesicht.
„Ich möchte gern die Fender Stratocaster im Schaufenster kaufen“, platzte ich heraus. „Ich habe eine Fender Musicmaker mit Originalkoffer, die ich in Zahlung geben kann. Ich habe das Geld jetzt noch nicht, aber ich könnte Ihnen jede Woche etwas abzahlen.“
Mister Lipham strich sich mit der Hand übers Kinn und musterte mich von oben bis unten. „Kannst du spielen?“, fragte er misstrauisch.
„Ja, Sir“, erwiderte ich selbstbewusst.
„Zeig’s mir“, antwortete er und angelte eine gebrauchte Gitarre aus dem Regal. Ich legte mir den Gurt um den Hals und gab ihm wunschgemäß eine Kostprobe meines rasch anwachsenden Repertoires.
„Hmmm. Wie wäre es mit einer monatlichen Ratenzahlung von zehn Dollar?“, fragte er, als ich fertig war. Als er sah, dass ich zauderte, fügte er hinzu: „Du kannst hier arbeiten, wenn du Zeit hast, die Gitarren stimmen und putzen und den Leuten zeigen, wie man spielt. Ich zahle dir einen Dollar fünfzig die Stunde.“
„Klar“, strahlte ich. Innerhalb einer Stunde war ich zu Hause in meinem Zimmer und spielte auf dieser alten Stratocaster, was das Zeug hielt.
Mein Job in dem Musikgeschäft weitete sich bald zu dem eines Musiklehrers aus. Mister Lipham empfahl mich einigen seiner Kunden, und eh ich mich’s versah, unterrichtete ich zehnjährige rotznäsige Kinder, welche die ganze Zeit jammerten, weil ihnen die Finger wehtaten und sie glaubten, sie könnten in dem Augenblick wie Elvis spielen, wo sie die Gitarre in die Hand nahmen, die ihnen ihre Eltern gerade gekauft hatten. Mein Gehalt verdoppelte sich, und bald hatte ich die Stratocaster abbezahlt, obwohl der Preis dafür – die Arbeit mit den Kindern – oft zu hoch erschien.
Einer meine Schüler jedoch erwies sich als sehr vielversprechend. Sein Name war Tommy Petty, und er war mein Musterschüler. Tommy war drei Jahre jünger als ich, dürr, mit Hasenzähnen und einer grässlichen Gitarre. Ich ging zum Unterricht zu ihm nach Hause. Dort hatte er ein Mikrofon aufgestellt und sang aus voller Kehle. Er stand im Wohnzimmer, sang, spielte und gab alles. Ich war beeindruckt.
Tommy war kein herausragender Gitarrist, aber er hatte eine Stimme irgendwo zwischen Mick Jagger und Bob Dylan und ziemlich starke Nerven. Wenig später wurde er Leadsänger in einer Band namens Rucker Brothers. Ich kann mich noch erinnern, dass ich zu Tommy sagte, vielleicht könnte er es eines Tages sogar schaffen. Ich riet seiner Band, ihre Gitarrentechniken zu verbessern, und half ihnen auch bei einigen Arrangements. Manchmal begleitete ich sie sogar zu einem Auftritt und stand im Publikum, um sie spielen zu hören. Tommy sah sehr gut aus und hatte langes, seidenes Haar, das er immer in den Nacken warf, was die Mädchen sehr anziehend fanden. Als ich ihm eines Abends bei einem Auftritt in einem Gasthaus zusah, kam ein echt scharfes Mädchen auf mich zu und sprach mich an. Sie hatte gesehen, wie ich der Band beim Ausladen der Instrumente geholfen hatte, und wusste, dass ich zu ihnen gehörte. Zu meiner Überraschung und meinem Entzücken lud sie mich in der Pause zu einer Spazierfahrt in ihrem Auto ein. Ich war natürlich einverstanden. Sie fuhr ein bisschen die Straße entlang, parkte dann, und wir begannen uns zu küssen. Bevor jedoch noch irgendetwas Ernsthaftes passierte, hielt ein Wagen neben ihrem, und ein sturzbetrunkener junger Mann begann, uns anzuschreien.
„O mein Gott, das ist mein Freund!“, kreischte sie und schob mich von sich fort.
Ich wurde leichenblass, als ich sah, wie dieser Brecher direkt vor uns parkte, ausstieg und hier, mitten im Nichts, mit einem mordlustigen Gesichtsausdruck die Asphaltstraße zurück auf uns zukam. Zum Glück für mich war er so betrunken, dass er plötzlich stolperte und mit dem Gesicht voran auf der Straße zusammenbrach.
„Schnell, starte den Wagen“, schrie ich das Mädchen an. „Machen wir, dass wir von hier wegkommen.“
„Wir können ihn doch nicht einfach da liegen lassen“, jammerte sie. „Er liegt mitten auf der Straße. Irgendwer wird ihn überfahren. Wir müssen ihn an den Straßenrand ziehen.“
Mit ernsthaften Zweifeln an meiner geistigen Gesundheit stieg ich aus dem Wagen und half ihr, ihren Freund auf die Beine zu stellen. Als wir ihn aufrichteten, rülpste er, und es stank nach abgestandenem Bier. Widerwillig legte ich einen seiner Arme um meine Schultern und den anderen um ihre, und so schleppten wir ihn langsam zurück zu seinem Auto. Wir hatten es schon beinahe geschafft, als er zu sich kam.
„Nimm deine dreckigen Hände von mir“, sagte er und warf plötzlich seine Arme mit einer gewaltsamen Bewegung zurück, wodurch er mir die Schulter komplett auskugelte. Ich stieß einen Urschrei aus, griff meinen Arm und drückte ihn in die Gelenkpfanne zurück.
„Bring mich zurück zu dem Konzert“, keuchte ich dem Mädchen zu. Sie warf einen Blick auf ihren Freund, der inzwischen auf der Motorhaube seines Wagens zusammengesunken war, dann sah sie mich an. Ich hatte riesige Schmerzen, und sie stimmte zu.
Ich taumelte in den Saal zurück. Der zweite Konzertteil war bereits halb vorbei. Ich hielt mir die Schulter, die sehr schmerzte, und versuchte, zur Bühne durchzukommen. Ich wollte einen der Jungs bitten, mich ins Krankenhaus zu bringen. Ein paar Schritte hinter mir war der betrunkene Freund des Mädchens, der wieder zu Bewusstsein gekommen war und sich an meine Fersen geheftet hatte. „Hey, du kleiner Wichser!“, schrie er und stieß mich hart in den Rücken. „Was zum Teufel machst du da mit meiner Freundin?“ Ich konnte mich nicht zur Wehr setzen. Meine Schulter war total angeschwollen, und ich hatte so große Schmerzen, dass ich hätte weinen können. Die Gebrüder Rucker hingegen waren große, böse, gemeine, hartgesottene Rednecks aus Florida, deren Vater ein Autohaus besaß. Sie sahen, dass ich bedrängt wurde, warfen ihre Instrumente zu Boden, schnappten sich den Kerl und zerrten ihn hinaus, wo sie ihm eine ordentliche Tracht Prügel verpassten. Das war, soweit ich mich entsinnen kann, einer der denkwürdigsten Auftritte von Tom Petty. Heute noch werde ich schmerzhaft an jenen Abend erinnert, wenn ich meine Schulter ein bisschen zu weit zurückziehe.
Meine schulischen Leistungen litten unweigerlich unter all den außerschulischen Aktivitäten, in die ich verstrickt war. Zusätzlich zu meinen Wochenendjobs, wo ich Schuhe verkaufte, Gitarren stimmte und heulenden kleinen Kindern „King Creole“ auf der Gitarre beibrachte, begann ich nun auch noch Solokonzerte zu geben – nur ich, meine Fender und mein kleiner Verstärker. Ich spielte in der Stadt und an weiter entfernten Auftrittsorten, die ich mit dem Greyhoundbus erreichte.
„Don Felder, Gitarrist“, kündigte ich mich selbst an. Ich nahm schlecht bezahlte Gigs bei Frauenvereinen und Kindergeburtstagen an, wo ich von Filmmusik bis Elvis alles spielte. Daneben spielte ich noch Schlagzeug in einer Bar namens Gatorland, die direkt gegenüber der Universität von Florida lag, sowie Leadgitarre in einer Band im Dubs Steer Room, einem verrauchten Steakhaus, wo Fleisch und Bier serviert wurden. Man konnte Billard spielen, den „Gator“ (Alligator) tanzen oder einfach nur beim Wet-T-Shirt-Contest zusehen, der jeden Freitag- und Samstagabend stattfand. Mann, ich dachte, ich wäre gestorben und in den Himmel gekommen.
Jerry gefiel es gar nicht, wenn ich mich an solchen Orten herumtrieb, und als er es herausfand, drohte er, es unseren Eltern zu erzählen. „Das ist nicht in Ordnung“, sagte er zu mir. „Du bist minderjährig und solltest solche Spelunken nicht einmal betreten. Außerdem ist es mir peinlich, dass mein kleiner Bruder dort auf der Bühne steht.“ Aber das war mir alles egal. Ich war glücklich, dass ich Musik machen und Spaß dabei haben konnte. Seit ich die Bühne im State Theater betreten hatte, hatte ich nichts anderes gewollt.
Nach meinem frühen Kontakt mit den Soulsängern in der Kirche und meiner Liebesaffäre mit den Spätsendungen im Radio liebte ich schwarze Musik immer noch, aber in den späten Fünfzigern und frühen Sechzigern gab es für schwarze Künstler keine Auftrittsmöglichkeiten. Im tiefen Süden war Rassismus an der Tagesordnung, so war das eben. Mir gefiel das nicht, und ich verstand es auch nicht. Mein Vater arbeitete mit „Farbigen“ zusammen und kam gut mit ihnen aus. Einer von Papas Freunden, bekannt als „Pig“, hatte vor der Stadt eine kleine Zuckerrohrplantage. An den Wochenenden gingen wir manchmal dorthin und halfen zusammen mit seinen Leuten bei der Zuckerrohrernte. Pigs Maulesel zog den Mühlstein, und die Schwarzen kochten ein wenig von dem Zuckerrohr, um daraus Sirup für unsere Pfannkuchen zu machen. Einem Mann, der uns regelmäßig zu Hause besuchte, lieh Papa sogar einmal Geld. Ich wunderte mich immer, dass er die Hintertür statt der Vordertür benutzen musste, wenn er zu Besuch kam.
Es gab einen Stadtteil von Gainesville, den jedermann „Colored Town“ (Stadt der Farbigen) nannte. Weiße gingen dort nicht hin, aber ich schon. Als Teenager schlich ich mich davon und rannte hinunter zu den Bars, um mit den Musikern zu jammen. Meine Eltern hätten einen Anfall bekommen, wenn sie davon erfahren hätten. Mein Vater versohlte mich immer noch mit dem Gürtel, und ich möchte gar nicht erst daran denken, was er getan hätte, wenn er herausgefunden hätte, dass ich in Wahrheit gar nicht bei einem Freund übernachtete, sondern mich mit den Schwarzen traf.
Einer der Musiker, mit denen ich dort unten spielte, ein Schlagzeuger namens John, erzählte mir, dass B. B. King im Rahmen eines sogenannten „Chitlin Circuit“ (etwa: Specktournee) für schwarze Künstler in die Stadt komme. Er sollte in einer illegalen Bar in einer Scheune auf irgendeiner Farm spielen. Damals suchten sich die Veranstalter ein Gebäude mitten in den Kuhweiden und räumten für das Konzert einfach die Heuballen zur Seite. Sie stellten Kisten als Tische und Stühle auf, ließen ein paar Fässer anliefern, verkauften Bier und nahmen fünf Dollar Eintritt.
Fünf Mäuse, um B. B. King zu sehen. Es war ein kleines Vermögen.
Ich war ein großer Fan von B. B., den ich schon hundertmal auf WLAC gehört hatte, also bekniete ich John, mich doch mitzunehmen. „Bitte nimm mich mit, bitte, bitte, bitte!“ Zu meiner großen Freude sagte er schließlich zu, und so stahl ich mich eines Abends aus dem Haus, rannte zu seinem Jeep und fuhr mit ihm zu der Scheune.
Der Laden kochte. Ich war meilenweit der einzige Weiße. Ich konnte es mir nicht leisten hineinzugehen, also stand ich draußen und spähte durchs Fenster. B. B. haute mich völlig um. Nur durch sein Spiel brachte er Männer zum Schreien und Frauen zum Weinen. Ich beobachtete ihn mit großen Augen und wusste, dass ich mehr als alles andere in der Welt so sein wollte wie er – mit zusammengekniffenen Augen vorn am Bühnenrand stehen und die Frauen mit meiner Gitarre zum Weinen bringen.
Als er fertig war, stellte er seine Gitarre in einer Pferdebox ab und nahm auf einem Heuballen Platz, um wie alle anderen ein wenig von dem Schwarzbrand zu trinken. Mit klopfendem Herzen platzte ich hinein und preschte quer durch die überfüllte Scheune bis zu seinem Platz.
„Mister King“, sagte ich atemlos. „Ich würde ihnen einfach gern die Hand schütteln.“
Sein Gesicht erhellte sich wie eine Kerze, und er lächelte mich mit einem Mund voller unglaublich weißer Zähne an. „Na gut, mein Junge“, entgegnete er mit leuchtenden Augen. „Hier ist sie.“ Er streckte mir seine Riesenhand entgegen, und ich nahm sie in die meine. Seine Finger waren so groß wie Würstchen, und sein Atem roch schwach nach Whisky. Sein Blick durchbohrte mich förmlich. Wie zur Salzsäule erstarrt, brachte ich kein weiteres Wort mehr hervor. Ich machte mich davon und ging halb benommen nach Hause. Danach wusch ich mir eine Woche lang nicht die Hände.
Die nächsten paar Monate sparte ich jeden Penny, bis ich mir schließlich leisten konnte, was ich wollte. Das erste Album, das ich jemals kaufte, war Live At The Regal von B. B. King. Ich kaufte es per Postversand bei Randy’s Record Shop in Gallatin, Tennessee, der auf WLAC in Nashville als „größter Plattenladen der Welt“ Werbung machte. Das Album kostete zwei Dollar achtundneunzig, die ich mühsam zusammengespart und mit der Post geschickt hatte. Es war eine der großartigsten Bluesaufnahmen aller Zeiten. Ich lernte jeden Ton auswendig.
Die Ereignisse der Weltpolitik schienen an Gainesville größtenteils vorbeizugehen, einige wenige jedoch, wie die Kubakrise und das Attentat auf Präsident Kennedy, ließen sich nicht umgehen. Ich war auf der Highschool, als sich JFK und der russische Premierminister Nikita Chruschtschow im Herbst 1962 wegen der geplanten Stationierung nuklearer Sprengköpfe auf Kuba in die Haare gerieten. Der Name Castro wurde zum Synonym für das Böse, so wie heute Osama bin Laden. In einer Ecke jedes Klassenzimmers befand sich an der Wand ein kleiner Lautsprecher, über den wir die neuesten Nachrichtenmeldungen aus dem Radio hörten. Bei der täglichen Luftalarmübung versteckten wir uns unter unseren Tischen, sobald eine Sirene aufheulte. Dann kam eine Ansage: „Dies ist eine Übung. Dies ist eine Übung. Im Ernstfall begeben Sie sich bitte in Ihren vorgegebenen Bereich.“ Daraufhin folgte eine Reihe lauter Huptöne.
Der Lehrer sagte: „Gut, Kinder, bitte merkt euch jetzt den Ablauf. Helm auf, Kopf runter, Augen zu.“ Als ob uns unsere Sperrholztische und Blechhelme vor einer nuklearen Katastrophe bewahrt hätten. Ich erinnere mich, dass ich mich fragte, wie lange ich wohl brauchen würde, um nach Hause zu rennen, falls eine Rakete in Florida einschlug. Es war eine Zeit, in der die Angst im Land regierte, und ihr erstes Opfer war die Logik. Einige Leute in unserem Viertel versuchten, sich Bunker zu bauen, aber da das Grundwasser nur etwa einen Meter tief unter der Erdoberfläche lag, begriffen sie schnell, dass sie eher ertrinken würden, bevor jemand eine Atombombe auf sie warf. Die Bedrohung durch einen Krieg schien irreal und beinahe wie ein Spaß, als wären wir Teil von etwas Fantastischem und nicht potenzielle Opfer eines Atomschlags.
Im Jahr darauf wurde JFK erschossen. Das veränderte alles vollkommen. Die Nachricht war unglaublich und erschütternd. Ich erinnere mich, dass unsere Lehrerin zusammenbrach, als sie uns im Schulhof davon berichtete. Jedermann schien plötzlich verängstigt und paranoid zu sein. Erwachsene weinten auf offener Straße, was ich noch nie zuvor gesehen hatte. Es war, als wäre ganz Gainesville durch das Abfeuern dieser Kugel plötzlich aus einem Dornröschenschlaf gerissen worden. Nichts schien mehr sicher oder verlässlich. Die Apfeltörtchensüße war einem sauren Geschmack gewichen. Wir bekamen den Tag schulfrei, damit wir mit unseren Familien das Begräbnis im Fernsehen anschauen konnten. Ich kann mich noch erinnern, wie ich vor unserem Schwarzweißgerät auf dem Boden saß und zusah, wie der kleine John auf dem Nationalfriedhof in Arlington schweigend neben seiner Mutter stand, während meine eigene Mutter schluchzend auf dem Sofa saß. Mann, das war schon seltsam.
Jeder erinnert sich noch genau, wo er gerade war, als er hörte, dass JFK erschossen worden war. Ich werde es nie vergessen. Das Jahr 1963 ist in die amerikanische Psyche unauslöschlich eingegraben. Für mich war es jedoch noch aus einem anderen Grund bedeutsam. Es war das Jahr, in dem ich den Mann traf, der für mein gesamtes Leben zur Schlüsselfigur wurde. Sein Name war Bernie Leadon.