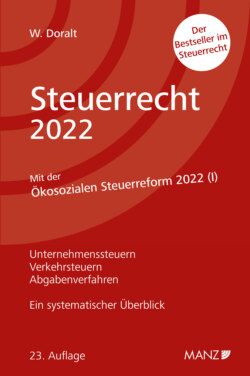Читать книгу Steuerrecht 2022 - Werner Doralt - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеKleine Stilkunde
„Einer plagt sich immer – der Autor oder der Leser“
Der frühere Justizminister und Vizekanzler, Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Brandstetter, meinte in einem Interview: „Dass Gesetzestexte zu kompliziert sind, bekomme ich in letzter Zeit oft um die Ohren gehauen – mit Recht“ (Standard 24. 9. 2016).
Ebenso hat die ehemalige Präsidentin des OGH, Frau Dr. Irmgard Griss, die bessere Verständlichkeit von Gerichtsentscheidungen eingemahnt. Dazu passend bescheinigt eine Diplomarbeit über die Sprache des VwGH und des VfGH den höchstrichterlichen Entscheidungen eine „auffallend überdurchschnittliche Satzlänge“; durch die langen Nebensätze entstünden häufig „lang gezogene Spannsatzrahmen mit einem beträchtlichen und unter Umständen verständnishemmenden Spannungsbogen“ (Judith Langthaler).
Ein Richter meinte dazu allerdings, es sei ihm kein Gesetz bekannt, das ihm vorschreibt, er müsse sich um Verständlichkeit bemühen. Ein anderer, auch als Fachautor bekannter Jurist meinte ähnlich, lange Sätze und Schachtelsätze seien Geschmacksache. Von einem früheren Legisten im BMF ist bekannt, dass er sich in Schachtelsätzen „baden“ konnte.
Es geht allerdings nicht darum, welcher Stil dem Verfasser eines Textes gefällt oder nicht gefällt, entscheidend ist vielmehr, dass der Leser den Text möglichst leicht versteht. Das muss unser Anliegen sein, gleichgültig, ob es sich um einen Fachbeitrag, um einen Schriftsatz an eine Behörde, ein Urteil oder um ein Gesetz handelt.
Konstruktive Kritik am fremden Text:
Eine bewährte Methode, seinen eigenen Stil zu verbessern, ist die „konstruktive Kritik am fremden Text“. Da wir in unseren eigenen Text „selbstverliebt“ sind, erkennen wir die Mängel leichter am fremden Text. – Es mag mühsam sein, hat aber einen hohen Lerneffekt, wenn wir versuchen, einen schwer verständlichen fremden Text umzuformulieren, um ihn lesbar zu machen.
Übrigens: Es gibt Stilfibeln, mit wertvollen Anregungen, zB von Wolf Schneider. Tonio Walter und Michael Schmuck haben eigene Stilfibeln für Juristen geschrieben.
Univ.-Prof. Dr. Fritz Schönherr hat an unserer Fakultät eigene Seminare für Legistik veranstaltet (siehe auch Fritz Schönherr, Sprache und Recht, Verlag Manz).
Werner Doralt
1. Regel: Vermeiden Sie lange Sätze
Lange Sätze mit oft mehr als 50, gelegentlich sogar mehr als 100 Wörtern sind einer der häufigsten Gründe, weshalb ein Text schwer lesbar ist. Daher ist eine der einfachsten Methoden, verständlicher zu schreiben: lange Sätze vermeiden.
Im Anhang finden Sie – als abschreckendes Beispiel – einen Satz mit 133 Wörtern aus einer Entscheidung des OGH.
Zählen Sie die Wörter in Ihren Sätzen: Ab 20 Wörtern sollten Sie vorsichtig werden, je mehr Wörter, desto mehr leidet die Verständlichkeit. Lösen Sie Nebensätze in selbständige Sätze auf (zB statt einen Nebensatz mit „weil“ anzufangen, können Sie einen neuen Hauptsatz mit „denn“ einleiten).
Ausnahmen gibt es zB dann, wenn Ausführungen nur aneinandergereiht werden.
2. Regel: Vermeiden Sie Schachtelsätze
Schachtelsätze machen einen Satz insbesondere dann schwer verständlich, wenn er lang ist, oder wenn mehrere Schachtelsätze hintereinander gereiht sind. Besonders erschwerend wirken Schachtelsätze, wenn sie Subjekt und Prädikat durch lange Nebensätze trennen.
Lange Sätze verbunden mit Schachtelsätzen sind die häufigsten Ursachen für einen schwer verständlichen Text. Indem Sie lange Sätze mit Schachtelsätzen vermeiden, gewinnen Sie bereits erheblich an Verständlichkeit.
Beispiel:
§ 12 Abs 1 Z 1 UStG (Vorsteuerabzug): „. . . Besteuert der Unternehmer nach vereinnahmten Entgelten (§ 17) – ausgenommen Unternehmen iS des § 17 Abs 1 zweiter Satz – und übersteigen die Umsätze nach § 1 Z 1 und 2 – hierbei bleiben die Umsätze aus Hilfsgeschäften einschließlich der Geschäftsveräußerung außer Ansatz – im vorangegangenen Veranlagungszeitraum 2.000.000 Euro nicht, ist zusätzliche Voraussetzung, dass die Zahlung geleistet worden ist . . .“ (idF vor dem AbgÄG 2016).
Alternative:
„. . . Versteuert der Unternehmer nach vereinnahmten Entgelten, muss außerdem die Zahlung geleistet sein; dies gilt nicht für Unternehmen, deren Umsätze im vorangegangenen Veranlagungsjahr 2.000.000 Euro überstiegen haben, wobei Umsätze von Hilfsgeschäften einschließlich der Geschäftsveräußerung außer Betracht bleiben, und für Unternehmungen iS des § 17 Abs 1 zweiter Satz . . .“
Anmerkung:
Richtig heißt es natürlich „Versteuert der Unternehmer . . .“ und nicht „Besteuert . . .“
Die Hauptaussage ist durch Einschübe und Schachtelsatz zerrissen, gehört aber vorangestellt, die Ausnahmen gehören nachgereiht. Damit werden gleichzeitig die Verschachtelungen aufgelöst. Als Ausnahmen gehören die Unternehmen mit hohen Umsätzen den Versorgungsunternehmungen (§ 17 Abs 1 zweiter Satz) vorangereiht, weil sie für den Normadressaten die idR wichtigere Ausnahme sind.
Beispiel:
§ 28 a FinstrG: Ein Beispiel, wie selbst ein Satz mit „nur“ rund 40 Wörtern absolut unverständlich sein kann (siehe Anhang).
3. Regel: Machen Sie Absätze
Gliedern Sie den Text zumindest mit Absätzen, nach Möglichkeit auch mit Zwischenüberschriften. Das zwingt Sie, den Text zu strukturieren, und macht den Text für den Leser leichter verständlich.
4. Regel: Verwenden Sie „dass“-Sätze sparsam
Unnötige „dass“-Sätze machen den Text holprig und stören den Lesefluss (wirken „wie eine Hacke“). Noch schlimmer ist es, wenn es sich um Treppensätze handelt (mehrere „dass“ in einem Satz). Gerade in juristischen Texten ist der Satz vor dem „dass“-Satz häufig nur kurz und ohne relevante Aussage; erst der oft lange Nebensatz enthält die Hauptaussage. Nach dem ersten nichtssagenden Hauptsatz, ist die Hauptaussage bereits im ersten Nebensatz.
Beispiele:
– § 20 EStG normiert, dass . . .
Alternative: Nach § 20 EStG
– Der Autor vertritt die Auffassung, dass . . .
1. Alternative: Wie der Autor erklärt . . .
2. Alternative: Der Autor kommt zu folgendem Ergebnis: . . .
– Voraussetzung ist, dass . . .
1. Alternative: Das gilt nur, wenn
2. Alternative: Voraussetzungen sind:
– Es ist bekannt, dass es unzulässig ist, dass in öffentlichen Räumen geraucht wird.
1. Alternative: Es ist bekannt, dass in öffentlichen Räumen nicht . . .
2. Alternative: Wie bekannt, darf in öffentlichen Räumen nicht . . .
– Bemerkenswert ist, dass sich auch das Bezirksgericht für unzuständig erklärt hat.
1. Alternative: Bemerkenswerterweise hat sich auch . . .
2. Alternative: Im Übrigen hat sich auch das Bezirksgericht . . .
– Die Rechtslage sieht nunmehr vor, dass . . .
Alternative: Nach der neuen Rechtslage . . .
– Der VwGH vertritt die Auffassung, dass . . .
1. Alternative: Nach Auffassung des VwGH . . .
2. Alternative: Wie der VwGH entschieden hat . . .
3. Alternative: Der VwGH kam zu folgendem Ergebnis: . . .
– Der VwGH bestätigt die geltende Auffassung, dass . . .
Alternative: Der VwGH bestätigt die geltende Auffassung, nach der . . .
Besonders hässlich sind „dass, wenn“-Sätze.
Beispiel:
– Es gibt den Grundsatz, dass, wenn der Gesetzgeber unterschiedliche Begriffe verwendet, er auch Unterschiedliches meint.
Notwendig ist ein „dass“-Satz, wenn der vorangehende Satz eine wichtige Aussage enthält; dann wirkt er auch nicht holprig.
– Der Kläger konnte nicht beweisen, dass . . .
– Die Zeit verging so schnell, dass . . .
5. Regel: Verwenden Sie „da“ und „weil“ richtig
Der Begründungssatz wird mit „da“ eingeleitet, wenn er dem Satz mit der Folgeaussage vorangeht. Dagegen wird der Begründungssatz mit „weil“ eingeleitet, wenn er dem Satz mit der Folgeaussage nachgereiht ist.
Beispiele:
– Da der Zeuge die Unwahrheit gesagt hat, wurde er wegen falscher Zeugenaussage verurteilt.
– Der Zeuge wurde wegen falscher Zeugenaussage verurteilt, weil er die Unwahrheit gesagt hat.
6. Regel: Achtung bei Verstärkerwörtern
Verstärkerwörter können auch abschwächen. Oft ist man versucht, eine Aussage mit einem Verstärkerwort zu betonen (zB sicher, sehr, genau, exakt). Die beabsichtigte Verstärkung kann allerdings gegenteilig wirken, meist ist sie unnötig oder weicht die Aussage sogar auf.
Beispiele:
– Der Zeuge hat sicher die Wahrheit gesagt.
Alternative: Der Zeuge hat die Wahrheit gesagt.
Anmerkung: In Prozessbehauptungen kann ein „sicher“ sogar gefährlich sein, weil es die Frage provoziert: „Wie sicher sind Sie?“
– Bekanntes Beispiel aus einer Stilfibel: Der Freund flüstert seiner Freundin ins Ohr: „Ich liebe Dich sehr.“
Was stört seine Freundin daran?
7. Regel: Eher Zeitwörter als Hauptwörter verwenden
Verbalstil ist flüssiger zu lesen als Nominalstil. Das heißt nicht, dass man auf Hauptwörter verzichten soll – als formelhafte Begriffe können sie gerade bei juristischen Texten wichtig sein. Vielmehr sind überflüssige Substantivierungen zu vermeiden. Wenn es um Tätigkeiten geht, dann ist es besser, sie mit Tätigkeitswörtern auszudrücken, eben mit Zeitwörtern.
Beispiele:
– Ich stelle den Antrag auf Einvernahme des Herrn N. als Zeugen.
Alternative: Ich beantrage, Herrn N. als Zeugen zu vernehmen.
– Die Behörde führt als Begründung an . . .
Alternative: Die Behörde begründet . . .
8. Regel: Kündigen Sie Gegenmeinungen möglichst früh und ausdrücklich an
Wenn Sie im Text eine Gegenposition erwähnen (gerade in juristischen Texten nicht selten), dann dient es der Verständlichkeit, wenn sie erstens die Gegenposition als solche deutlich ansprechen (zB mit „dagegen“) und – zweitens – die Gegenposition auch so früh wie möglich ankündigen. Der Leser weiß dann sofort, dass eine Gegenposition kommt; damit erleichtern Sie dem Leser das Verständnis des (nachfolgenden) Textes.
Beispiele:
– Unbeschränkt Steuerpflichtige unterliegen mit ihren Welteinkommen der ESt. Beschränkt Steuerpflichtige unterliegen nur mit bestimmten Inlandseinkünften der ESt.
Alternative: . . . Dagegen unterliegen beschränkt Steuerpflichtige . . .
– Der Kläger erklärte, er habe gesehen, wie das Fahrzeug nach rechts abgebogen ist. Der Beklagte erklärte, er habe gesehen, wie das Fahrzeug links abgebogen ist.
Alternative: „. . . Der Beklagte erklärte dagegen . . .“ oder noch besser „. . . Dagegen erklärte der Beklagte . . .“
9. Regel: Verwenden Sie Tendenzwörter! Aber richtig!
Tendenzwörter sind Wörter, die das Positive oder Negative einer (bevorstehenden) Aussage erkennen lassen; sie erleichtern das Lesen. Gelegentlich werden sie sogar falsch angewendet und erschweren damit das Verständnis, statt es zu erleichtern.
Beispiele (überprüfen Sie selbst):
– Die Wahrscheinlichkeit, in einer Lawine umzukommen, ist groß.
– Die Gefahr, in einer Lawine umzukommen, ist groß (wohl besser!).
– Die Chance, in einer Lawine umzukommen . . .
– Die Möglichkeit, in der Lotterie zu gewinnen, ist gering.
– Die Chance, . . .
– Die Chance, Opfer eines Terroranschlags zu werden . . .
– Die Gefahr, Opfer . . .
– Über 200 Personen sind seit Jänner im Mittelmeer „gestorben“ (ORF). – Passender wäre wohl „ertrunken“.
– „Kosten höher als erhofft.“ – Die Aussage irritiert, hohe Kosten waren wohl nicht „erhofft“; gemeint ist: „Kosten höher als erwartet.“
– „Insolvenzen: Österreich unter den Erwartungen.“ Oder: „Insolvenzen: Österreich besser als erwartet.“
– Die Auswahl stieß auf Anerkennung. Die Auswahl fand Anerkennung.
– Feinstaubbelastung höher als die WHO „vorschreibt“ (besser wohl „zulässt“).
– Im ORF hieß es: Die Ergebnisse der Zentralmatura waren „besser als befürchtet“ (richtig wohl: „besser als erwartet“).
10. Regel: Hauptaussagen voranstellen (im Hauptsatz), Spezifizierungen oder Ausnahmen nachstellen (in Nebensätzen)
Beispiele:
– § 6 Z 5 EStG: „Einlagen sind wie folgt zu bewerten:
a) Wirtschaftsgüter und Derivate . . . sind mit den Anschaffungskosten anzusetzen . . .
b) Grundstücke . . . sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten anzusetzen . . .
c) Abweichend von lit b sind Gebäude . . .
d) in allen übrigen Fällen ist der Teilwert im Zeitpunkt der Zuführung anzusetzen.“
Alternative: Die allgemeine Regel gehört vorangestellt:
„Einlagen sind mit dem Teilwert im Zeitpunkt der Zuführung anzusetzen; davon bestehen folgende Ausnahmen:
a) . . .
b) . . .
c) . . .“
Siehe außerdem das Beispiel zum Vorsteuerabzug oben.
§ 8 Abs 4 Z 2 lit c KStG (Mantelkauf):
„Der Verlustabzug steht ab jenem Zeitpunkt nicht mehr zu, ab dem die Identität des Steuerpflichtigen infolge einer wesentlichen Änderung der organisatorischen und wirtschaftlichen Struktur im Zusammenhang mit einer wesentlichen Änderung der Gesellschafterstruktur auf entgeltlicher Grundlage nach dem Gesamtbild der Verhältnisse wirtschaftlich nicht mehr gegeben ist (Mantelkauf) . . .“
Der Satz hat mit 45 Wörtern bereits eine Überlänge und ließe sich übersichtlicher gestalten:
„Der Verlustabzug steht ab jenem Zeitpunkt nicht mehr zu, ab dem die wirtschaftliche Identität des Steuerpflichtigen nicht mehr gegeben ist; das ist dann der Fall, wenn sich im Zusammenhang mit einer wesentlichen Änderung der Gesellschafterstruktur auf entgeltlicher Grundlage die organisatorische und wirtschaftliche Struktur nach dem Gesamtbild der Verhältnisse wesentlich geändert hat.“
Die Hauptaussage ist vorangestellt, die Spezifizierungen sind nachgestellt.
11. Regel: Vermeiden Sie „ich“ in wissenschaftlichen Arbeiten
Vermeiden Sie in wissenschaftlichen Fachpublikationen das „Ich“. Besser sind unpersönliche Formulierungen. Das „Ich“ wirkt meist eitel, es schwächt ab und lenkt von der Sache ab.
Beispiele:
– Ich habe in keinem Kommentar gefunden . . .
Alternative: In keinem Kommentar findet sich . . .
– Freilich räume ich durchaus ein . . .
Alternative: Freilich ist einzuräumen . . .
– . . . glaube ich, sagen zu können . . .
Alternative: lässt sich wohl sagen (kann man wohl sagen) . . .
– Ich halte es für unnötig . . .
Alternative: Es ist unnötig . . .
– Ungeachtet der Rechtsprechung lehne ich die Auffassung ab . . .
Alternative: Ungeachtet der Rechtsprechung ist die Auffassung abzulehnen . . .
Anmerkung: Stellen Sie nicht Ihre Person in den Vordergrund, sondern die Sache. Das „Ich“ benötigen Sie nur dann, wenn Sie den Leser direkt ansprechen wollen (zB „für Anregungen bin ich dankbar“).
12. Regel: Machen wir uns in Fachbeiträgen (wissenschaftlichen Auseinandersetzungen) nicht zum Richter
Mit Wörtern wie „unzutreffend“ und „unrichtig“ in Fachbeiträgen machen wir uns zum Richter über andere. Das steht uns nicht zu, wirkt überheblich und verletzend; auch wir hätten keine Freude, wenn jemand anderer unsere Meinung derart abqualifiziert, selbst und gerade dann nicht, wenn er recht hat und wir einen Fehler gemacht haben. Das Gleiche gilt für die Zustimmung, für das „Lob“. Auch wenn es freundlich klingt: Auch mit „zutreffend“ und „richtig“ maßen wir uns die Position des Richters an.
Schwächer, aber in der Sache nicht anders wirkt „überzeugend“ bzw „nicht überzeugend“.
Was richtig oder falsch ist, überzeugt oder nicht überzeugt, soll der Leser anhand unserer Argumente entscheiden; für die Zustimmung genügt „ebenso“ oder „ebenso bereits“. Für die gegenteilige Meinung genügt „anders“; dass Sie die andere Meinung nicht für richtig halten, ergibt sich bereits daraus, dass Sie sie nicht teilen.
Ebenso verletzend wie unnötig ist etwa die Bemerkung, der Autor habe „übersehen“ oder er „ignoriere“ oder „verkenne“. Inhaltsgleich aber nicht verletzend wäre der Hinweis: Der Autor „lässt außer Betracht“ (noch besser ist es, keinen Namen zu nennen, sondern zu formulieren: „. . . Diese Auslegung lässt außer Betracht . . .“ oder: „Dagegen lässt sich einwenden . . .“ und nicht: „Gegen NN lässt sich einwenden“).
Die Regel, wie man mit einer anderen Meinung umgehen soll, ohne den anderen zu verletzen, ist einfach und alt: „Was du nicht willst, das man dir tut, das füg‘ auch keinem anderen zu.“
Derartige Formulierungen sind unpassend und wirken anmaßend (zB: „Wie der OGH richtig erkannt hat“, oder „zutreffend OGH“ statt „Wie auch der OGH erklärt hat“ bzw „ebenso OGH“; negative Beispiele siehe ÖJZ 2016, 416).
13. Regel: Belehrungen
Auch Belehrungen sind unpassend. Formulierungen wie etwa, der Gesetzgeber „wird gut beraten sein“, sind oberlehrerhaft und befremden ebenso, wie die Empfehlung, eine unbefriedigende Rechtslage „sollte den VfGH nicht in Versuchung führen, seine Kompetenzen zu überschreiten und selbst Gesetzgeber zu spielen“. – Was erwartet sich der Autor von solchen Formulierungen?
14. Regel: Vermeiden Sie besonders hässliche Wörter (Unwörter)
Zu den besonders hässlichen Wörtern gehören zB „obig“, „vor Ort“, „oberstgerichtliche“ oder etwa „seitens“.
„Obig“ ist nicht nur hässlich, sondern dient meist nicht einmal der beabsichtigen Präzisierung. Wenn Sie „obig“ im Laufe des Textes verwenden (zB wie „obig“ erwähnt, weiß der Leser genauso viel und genauso wenig, wie wenn Sie Passagen weglassen und sich auf „wie erwähnt“ beschränken. Gerne wird „obig“ zu Beginn eines Schreibens verwendet, um das im Betreff angeführte Thema nicht wiederholen zu müssen. Flüssiger zu lesen ist es allerdings, wenn Sie das Thema im Text wiederholen.
„Vor Ort“ ist selten richtig und meist nur hässliche Journalistensprache. Wenn Sie sich am Unfallort befinden, dann sind Sie eben nicht „vor Ort“.
Der „Oberste Gerichtshof“ ist ein „Höchstgericht“ und kein „Oberstgericht“. Daher gibt es auch keine „oberstgerichtliche Entscheidung“ sondern eine „höchstgerichtliche Entscheidung“. In der Regel ergibt sich aus dem Text, welches Höchstgericht gemeint ist; ist dies nicht der Fall, müssen wir das Gericht beim Namen nennen.
Statt „seitens“ besser „von“: Nicht „seitens der Partei wurde angemerkt“, sondern „von der Partei wurde angemerkt“.
15. Regel: Wohin mit Paragraphen, Geschäftszahlen und BGBl-Zahlen?
Paragraphen eines Gesetzes und Geschäftszahlen eines Erkenntnisses oder Urteils sind zwar wichtig, meist aber nur als Zusatzinformation von Interesse. Stehen sie mitten im Satz, dann muss der Leser sie trotzdem mitlesen; setzt man sie dagegen nach der Aussage oder am Schluss des Satzes oder Absatzes in eine Klammer, dann kann der Leser diese Information überspringen. Der Text ist flüssiger zu lesen.
Beispiele:
– Der VwGH hat in seiner Entscheidung vom 1. 3. 2002, 13/14/2001, Slg 2193 erklärt, dass Aufwendungen für ein Arbeitszimmer, das den Mittelpunkt der Tätigkeit bildet, als Betriebsausgaben abzugsfähig sind.
1. Alternative: Der VwGH hat entschieden, dass . . . abzugsfähig sind (E 1. 3. 2002 . . .).
2. Alternative: Nach der Rechtsprechung des VwGH sind . . . abzugsfähig (E 1. 3. 2002 . . .).
3. Alternative: Aufwendungen für ein Arbeitszimmer sind als Betriebsausgaben abzugsfähig, wenn es den Mittelpunkt der Tätigkeit bildet (VwGH 1. 3. 2002 . . .).
– Nach § 1 EStG sind natürliche Personen mit einem Wohnsitz im Inland unbeschränkt steuerpflichtig.
Alternative: Natürliche Personen mit einem Wohnsitz im Inland sind unbeschränkt steuerpflichtig (§ 1 EStG).
– Das mit BGBl I 2007/104 geänderte Gesetz hat nunmehr folgenden Wortlaut . . .
Alternative: Das Gesetz wurde geändert (BGBl . . .) und hat nunmehr folgenden Wortlaut . . .
16. Regel: Wortwiederholungen vermeiden?
In der Schule haben wir gelernt, dass wir Wortwiederholungen vermeiden sollen.
In der Fachsprache ist dieser Grundsatz mit Vorsicht zu gebrauchen – Wortwiederholungen dienen oft der Präzisierung oder umgekehrt: Wechselt man die Begriffe, bloß um eine Wortwiederholung zu vermeiden, kann die Aussage unpräzise werden. Daher im Zweifel: Keine Scheu, dieselben Begriffe zu wiederholen, wenn dies der Klarheit dient.
17. Regel: Achten Sie auf die Stellung im Satz
Aus einer Presseaussendung:
„Die Staatsanwaltschaft darf einzig und alleine in Österreich entscheiden, ob jemand angeklagt wird oder nicht.“
Was ist hier gemeint? „Nur in Österreich darf die Staatsanwaltschaft alleine entscheiden, ob . . .“
Oder: „Nur die Staatsanwaltschaft darf in Österreich entscheiden, ob . . .“
18. Regel: „Gendern“ mit Blähsätzen?
Dass es dem Gesetzgeber vollkommen gleichgültig ist, ob ein Gesetz verständlich formuliert ist, zeigt § 41 ZahnärzteG:
„(1) Wenn eine Person . . . eine Schadenersatzforderung erhoben hat, so ist der Fortlauf der Verjährungsfrist von dem Tag an, an welchem der/die Schädiger/Schädigerin, sein/seine bzw. ihr/ihre bevollmächtigter/bevollmächtigte Vertreter/Vertreterin oder sein/ihr Haftpflichtversicherer oder der Rechtsträger jener Krankenanstalt, in welcher der/die genannte Angehörige des zahnärztlichen Berufs tätig war, schriftlich erklärt hat, zur Verhandlung über eine außergerichtliche Regelung der Angelegenheit bereit zu sein, gehemmt.“
Oder ein anderes Beispiel aus dem Oö Feuerwehrgesetz:
„§ 14 Abs 3: Die Pflichtbereichskommandantin bzw der Pflichtbereichskommandant kann im Einzelfall die Einsatzleitung einer der dazu bereiten Kommandantin bzw einem dazu bereiten Kommandanten eingesetzten Feuerwehrkräfte, der Abschnitts- oder Bezirks-Feuerwehrkommandantin bzw dem Abschnitts- oder Bezirks-Feuerwehrkommandanten, der Landes-Feuerwehrinspektorin bzw dem Landes-Feuerwehrinspektor oder der Landes-Feuerwehrkommandantin bzw dem Landes-Feuerwehrkommandanten oder deren bzw dessen Stellervertreterin bzw Stellvertreter übertragen, soweit es aus einsatztechnischen oder einsatztaktischen Gründen nötig ist.“
In ihrem „Gendereifer“ sprach die frühere Parteiobfrau der Grünen von „Elterinnen und Eltern“. Eine andere Funktionärin der Grünen sprach von „Gesetzgeber oder Gesetzgeberin“ (Im Zentrum, 9. 9. 2018).
Kritisch auch: Gerlinde Ondrej, Rechtspanorama, 13. 12. 2010 und Peter Pülzl, Salzburger Nachrichten 28. 10. 2008; abschreckend dagegen Lugner, ÖJZ 2009, 983 über die „Differenzierung zwischen Notar/e/innen und Rechtsanwält/e/innen“.
Schlussbemerkung
Die hier dargestellten Vorschläge sind relativ willkürlich, sowohl in der Auswahl wie auch in ihrer Reihenfolge, und lassen sich auch selbst wieder kritisch hinterfragen. An Stilregeln braucht man sich nicht sklavisch halten; wichtig ist jedoch, eine Sensibilität dafür zu entwickeln, ob der Text, den man geschrieben hat, für den Adressaten möglichst leicht verständlich ist.
Anhang
Drei besonders abschreckende Beispiele, zwei aus Entscheidungen des OGH, das andere aus dem Finanzstrafgesetz:
1. Aus einem Urteil des OGH zum Schadenersatz des geschädigten Unfallhelfers (OGH 10. 4. 2008, 2 Ob 43/08 z; ein Satz mit 133 Wörtern!):
„. . . Auch wenn es im dort entschiedenen Anlassfall darum ging, dass der Hilfe leistende Dritte vom ,Täter‘ selbst (der seinen Pkw nach Verursachung eines Parkschadens am Kfz der Kl schuldhaft gegen das Abrollen auf einer abschüssigen Straße nicht ausreichend abgesichert hatte, sodass sein Gegner nach Bemerken, dass das Fahrzeug zu rollen begann, hinterherlief, um es zum Stehen zu bringen, und hierbei sturzbedingt überrollt wurde) den Ersatz des bei seiner Eingriffshandlung erlittenen Schadens begehrte (und auch zugesprochen erhielt), während im vorliegenden Fall nicht der in der Gruppe der Hilfe Leistenden hineinfahrende und diese verletzende Lenker, sondern die den Hilfseinsatz auslösende Lenkerin (bzw für diese der Verband) in Anspruch genommen wird, so kann doch auch bei dieser Fallkonstellation die adäquate Verursachung dieses weiteren Folgeunfalls durch die Verursacherin des ersten Unfalls nicht ernsthaft in Zweifel gezogen werden . . .“
2. § 28 a FinStrG (Verbandsverantwortlichkeit): Selbst ein noch halbwegs kurzer Satz mit rund 40 Wörtern kann absolut unverständlich sein (weitere Beispiele aus der FinStrG-Novelle 2010 siehe Doralt, RdW 2011, 506).
„Die Verbandsgeldbuße ist, sofern in den Tatbeständen nichts anderes bestimmt wird, jedoch nach der für die Finanzvergehen, für die der Verband verantwortlich ist, angedrohten Geldstrafe, unter den Voraussetzungen des § 15 Abs 2 jedoch nach dem 1,5-fachen dieser angedrohten Geldstrafe, zu bemessen.“
Alternative: „Sofern in den Tatbeständen nichts anderes bestimmt wird, ist die Verbandsgeldbuße nach der Geldstrafe zu bemessen, die für die Finanzvergehen angedroht ist, für die der Verband verantwortlich ist. Unter den Voraussetzungen des § 15 Abs 2 erhöht sich die Geldstrafe um 50%.“
Oder noch einfacher: „. . . ist die Verbandsgeldbuße nach der Geldstrafe zu bemessen, die für den Täter angedroht ist . . .“
3. OGH zur Verhängung einer Untersuchungshaft (OGH 13. 3. 2015, 11 Os 14/15 s, ein Satz mit 165 Wörtern), ein Prunkstück an Unverständlichkeit:
„Allein der Umstand, dass im Haftrecht der StPO die Situation nicht vorgesehen ist, dass sich die aufgrund einer gerichtlich bewilligten Festnahmeanordnung in ‚Verwahrungshaft‘ zu nehmende (weiter anzuhaltende) und ohne Aufschub in die Justizanstalt des zuständigen Gerichts einzuliefernde Person bereits (unmittelbar vor der Entlassung aus einer Strafhaft) in einer Justizanstalt befindet, und dass deshalb im gegenständlichen Fall – über Veranlassung der Staatsanwaltschaft auf Grund einer dem Beschuldigten samt schriftlicher Rechtsbelehrung ausgefolgten gerichtlich bewilligten Festnahmeanordnung (ON 14 in ON 11; ON 39) – die Übernahme aus der Strafhaft in eine ‚Anhaltung‘ sowie die weitere Überstellung durch die Justizwache (vgl Vollzugsinformation in ON 11; ON 39 S 7 – 13) ohne Zwischenschaltung der Kriminalpolizei (die den Betroffenen auf Grundlage der gerichtlich bewilligten Festnahmeanordnung unmittelbar im Anschluss an die Entlassung aus der Strafhaft ohnedies lediglich in Verwahrung zu nehmen und in die zuständige Justizanstalt einzuliefern hätte) bewerkstelligt wurde, konnte – ebenso wie die unterlassene Belehrung nach Art 36 Abs 2 WÜK – keinen Einfluss auf die Zulässigkeit der nachfolgenden, die ,Verwahrungshaft’ (Anhaltung) jedenfalls beendenden (Kirchbacher/Rami, WK-StPO Vor §§ 170 – 189 Rz 6) Verhängung der Untersuchungshaft haben, weil die für eine solche geltenden Haftkriterien (§ 173 StPO; Kier in WK2 GRBG § 2 Rz 84; Kirchbacher/Rami, WK-StPO § 173 Rz 1) dadurch nicht berührt werden (vgl ON 55 S 10; mit Verweis darauf auch ON 56 S 3).“