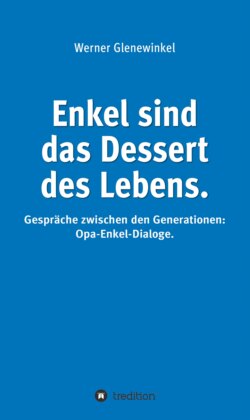Читать книгу Enkel sind das Dessert des Lebens - Werner Glenewinkel - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеKapitel I
Wie die Geschichte anfängt.
OPA, was machst du da?
Das siehst du doch. Ich fange an zu schreiben.
Mit Tinte und Papier?
Wenn mir etwas sehr wichtig ist, schreibe ich gerne mit einem Füllfederhalter auf Papier.
Was ist dir denn jetzt so wichtig?
Meine Enkelkinder!
Ich?
Ja, du auch, alle Enkelkinder.
Warum?
Weil, ähm, weil … Darüber denke ich ja gerade nach.
Was denkst du denn jetzt beim Nachdenken?
Wie ich das am besten formulieren soll.
Was denn formulieren?
Den abschließenden Brief an euch Enkelkinder.
Was für einen Brief …?
Sag mal, warum bist du überhaupt hier, heute morgen. Du müsstest doch längst in der Schule sein.
Homeschooling!
Wie bitte?
Opa, nun stell dich bitte nicht so …
Ja, ich weiß, aber hatte die Regierung nicht gerade entschieden …
… die Schulen zu öffnen, ja, das war vorige Woche.
Und heute?
Fängt der Wechselunterricht an: Diese Woche Distanz-, nächste Woche Präsenz-Unterricht.
Deshalb bist du zu Hause, verstehe. Und wo sind deine
Eltern?
Wo wohl? Arbeiten!
Hatten die nicht …
Homeoffice geht zur Zeit nicht.
Und dein Bruder?
Kita.
Kita?
Ja, in der sogenannten Notversorgung.
Und Oma?
Die ist gerade zum Einkaufen gegangen.
Dann kannst du ja jetzt deine Hausaufgaben machen.
Habe ich schon längst.
Dann kannst du die Geschichte von gestern …
Opa, du hast mir gestern fest versprochen …
Was ich versprochen habe, muss ich wohl auch halten.
Dann brauchst du ja auch nicht länger zu versuchen, Zeit zu gewinnen.
O. K. ich komme schon!
Wie und warum Enkel zum Dessert des Lebens werden.
„Großeltern sein ist definitiv das schönere Elternsein“. Sagt Uli Stein, ein Karikaturist der Großeltern-Generation, in seinem 2018 veröffentlichten Büchlein „Enkelkinder. Viel Spaß“. Von dem Spaß später mehr. (Leider ist Uli Stein überraschend dieses Jahr gestorben. Wir werden also keine weiteren Enkelkinder-Späße von ihm erhalten). Es enthält eine Fülle von witzigen Zeichnungen über das Verhältnis der Generationen. Im Klappentext heißt es dann weiter: „Weniger Pflicht und viel mehr Kür.“
GROSSELTERN UND ENKEL
Erst die Enkelkinder machen uns zu Großeltern. Damit wird klar, die Kinder der Kinder sind ein Geschenk. Weil man – so sehr man sich auch Enkelkinder wünscht – auf die Erfüllung dieses Wunsches als Großeltern keinen Einfluss hat. Auf einer Hauswand „Im Viertel“ in Bremen gibt es ein eindrucksvolles Wandgemälde: In einem geöffneten Fenster lehnen ein Opa und eine Oma nebeneinander auf der Fensterbank und schauen freundlich auf das Geschehen unter ihnen. In Ihren Blicken kann man erahnen, dass sie auch ihren Erinnerungen nachhängen.
Möglicherweise denken die beiden im Fenster über sich als Großeltern nach, wenn sie denn Enkelkinder haben. Möglicherweise denken sie auch, dass die Großeltern des 21. Jahrhunderts nicht mehr mit den Großeltern des 20. Jahrhunderts zu vergleichen sind; dass sich viel verändert hat.
Darüber komme ich ins Nachdenken: Welche Erinnerungen habe ich eigentlich noch an meine Großeltern? Es gab zwei Großmütter, die Großväter waren schon vor dem Krieg gestorben. Wie sahen unsere Großmütter aus? Welche Bilder haben sich festgesetzt? Es gab eine klare Unterscheidung: die eine Großmutter war die OMA und die andere die OMI. Hatten wir beide gleich gerne? Wohnten sie in der Nähe oder gar im selben Haus? Oder konnte man sie nur in den Ferien besuchen? An was erinnere ich mich noch genau? An was gerne?
Für Veränderungen in den Beziehungen von Großeltern zu ihren Enkelkindern gibt es viele Anzeichen: In den rechtlichen Regelungen, im Verständnis von Familie, in der Gesellschaft ganz allgemein. Das spiegelt sich auch in den Medien wider. Seit einiger Zeit gibt es Zeitschriften für Großeltern: „OMA. Das Magazin für aktive Großeltern“ heißt die eine. „Alles für meine Enkel & mich. Das Lifestyle-Magazin für moderne Großeltern“ die andere. Beide schreiben darüber, was Großeltern tun können und sollen und wie das mit dem Großeltern-Sein gehen könnte. Mittlerweile gibt es im deutsch-sprachigen Raum einen Großeltern-Tag. Am zweiten Sonntag im Oktober, ließ Markus Söder verlauten, würdigen wir Oma und Opa. Familienzentren bieten bereits Babysitting-Kurse für Großeltern an: „In acht Stunden fit für das Enkelkind“.
Somit könnten diese „modernen“ Großeltern auch ein Geschenk für ihre Kinder sein. Vitaler und flexibler als unsere eigene Großelterngeneration werden sie in Zeiten von zwei berufstätigen Eltern auch gefordert – und wollen und können mehr für Enkelkinder da sein. Die Fotografien meiner Großmütter zeigen fast immer schwarz gekleidete Frauen, in der Regel mit Handschuhen und Hut, bereit für einen Sonntagsspaziergang.
Opas und Omas haben verständlicherweise mehr Zeit und mehr Geduld als die Eltern. Ein Abholen von der Kita kann da auch mal 1½ Stunden dauern, weil auf jedem Mäuerchen balanciert wird, alle roten Autos gezählt werden und das Enkelkind das Tempo bestimmen darf.
Allerdings gibt es Menschen aus meiner Generation die – aus welchen Gründen auch immer – keine Kinder und somit keine eigenen Enkel haben. Für diejenigen, die dennoch die Großeltern-Rolle erleben möchten, gibt es eine Lösung: Man kann Paten-Oma oder Paten-Opa werden. Der Bedarf ist groß, aber die Großeltern-Rolle will gelernt sein und das gelingt nur durch eigene Erfahrungen. In dem Film „Enkel für Anfänger“ sind es die Paten-Enkel-Kinder, die den Großeltern nicht nur beibringen, was Enkel brauchen und können und wollen, sondern auch in den Begegnungen zwischen den Generationen den Alten helfen, eigene blinde Flecken zu entdecken und zu beleuchten. Das wird so witzig und humorvoll und märchenhaft überspitzt erzählt, dass auch die Paten-Großeltern verstehen werden, warum Enkel das Dessert des Lebens sein können.
DESSERT DES LEBENS
Für die meisten Großeltern (abgesehen von den jüngeren und ganz jungen Großeltern) ist die „Hauptmahlzeit des Lebens“, also insbesondere das Arbeitsleben, die Kindererziehung, das Sesshaftwerden, das Finden einer Rolle in der Gemeinschaft abgeschlossen. Jetzt ist Zeit für die Großelternrolle und die Freude an den Enkelkindern:
Die einem am Bahnhof bei einem Besuch über den ganzen Bahnsteig in die offenen Arme laufen und vielleicht beim Abschied zu ihren Eltern sagen: „Ich habe gedenkt, dass es bei Oma und Opa nicht so schön ist, aber es war doch ganz schön …“
Dazu tragen die gemeinsamen Beschäftigungen bei: „Opa, was sollen wir mal basteln?“ Uli Stein illustriert das unter der Überschrift „Basteln mit den Enkeln!“ durch ein Foto, auf dem eine Kinderhand aus Ton eine Leiter formt. Kommentar: „Wir basteln eine Tonleiter“.
Auch die vielen Geschichten, in denen man Spaß hat und Quatsch macht: Toben und (Krach-)Musik machen und Piratenschiff spielen und (Vor-)lesen und …
Das gemeinsame Fernsehgucken gehört dazu – nicht mehr „Die Sesamstraße“, aber immer noch die „Sach- und Lachgeschichten“ mit der Maus und dem Elefanten und (vielleicht als Kontrastprogramm) Videos von der Augsburger Puppenkiste wie „Die Katze mit Hut“.
Gänge durch den Wald mit Entdeckungen für Stadtkinder und unvergessenen Erlebnissen: „Wisst ihr noch, wie wir damals alle drei im Teutoburger-Wald in die Brennnesseln gefallen sind?“ Danach gab es Salbe und heißen Kakao.
Es gibt auch Sachen, die kann man nur bei den Großeltern ausprobieren, weil es dort einen Kaminofen gibt: Das Feuer im Kamin anzünden. Ein besonders langes Streichholz mit Hilfe anreißen, die Schrecksekunde über das plötzliche Aufflammen überstehen, das Streichholz in den Ofen werfen und den Flammen zusehen; Luft hinzugeben, damit sie sich in die Holzscheite fressen. Die Ofenklappe aufmachen, mit einem extra Handschuh, die entgegenkommende Hitze aushalten, ein neues Scheit Holz hineinwerfen, stolz sein!
Es ist der „Enkel-Kindermund“ mit seiner kindlichen Unbefangenheit, der fasziniert, wenn er frank und frei fragt: „Opa, warum hast du so gelbe Zähne?“ Oder: „Opa, warum hast du Haare in den Ohren?“ Und die kindliche Direktheit (die leider viel zu schnell verloren geht): „Oma, jetzt weiß ich, wo du kitzlig bist.“
Die Kinder-Logik findet immer wieder neue Ausdrucksformen, wenn z. B. am Ende einer Wanderung oben auf dem Gipfel die Erwachsenen schwärmen: „Schau doch mal, wie schön, da unten, unser Dorf!“ und die Antwort lautet: „Warum sind wir nicht da unten geblieben, wenn es da so schön ist ?“
Eine große Freude sind die anscheinend naiven und in Wahrheit sehr klugen Fragen wie: „Opa, gibt es auch einen Links-Staat?“ Und „Opa, wer hat eigentlich die Welt gemacht?“ Oder „Opa, was ist hinter dem Himmel?“ Fragen, auf die es oft genug keine passende, die kindliche Neugier zufriedenstellende Antwort gibt.
Das Dessert, eine Nachspeise oder Nachtisch, sagt der DUDEN und gibt dem Wort die „Worthäufigkeitsklasse“ zwei. Damit gehört es zu den 100 000 häufigsten Worten. Die Worthäufigkeit wird rein technisch über einen Algorithmus ermittelt. Sie entspricht nicht der Bekanntheit eines Wortes. Das Wort Dessert wurde vor weit über 200 Jahren dem französischen Wort „dessert“ entlehnt. Der „Nachtisch“ folgte der abgeschlossenen Hauptmahlzeit erst dann, wenn die Speisen „abgetragen“ waren. Das passt gut zu meinem Dessert-Gefühl: Denn wie beim Dessert, das eine gute Mahlzeit beendet, dürfen und müssen (und ehrlich gesagt wollen) die Großeltern die Enkelkinder nach einer gewissen Zeit wieder in die Obhut der Eltern zurückgeben. Ja, Enkel erinnern an das eigene Elternsein und an die eigenen Kinder – freudig oder schmerzlich oder beides oder etwas dazwischen – und gleichzeitig entsteht etwas Neues.
Dabei gerate ich unversehens in meine Kinderzeit. Seit meine beiden Eltern gestorben sind, fallen mir immer mal wieder Fragen ein, die mich beschäftigen. Fragen wie: Warum konnten sie mitten im Krieg heiraten? Woher nahmen sie den Mut, die Hoffnung? Vielleicht haben sie geheiratet, weil meine Mutter mit mir schwanger war. Ich weiß nicht, was ihre Hoffnung auf bessere Zeiten gestärkt hat. Die Fragen bleiben unbeantwortet. Zu ihren Lebzeiten hatte ich alles andere im Kopf und um die Ohren, als meinen Eltern solche Fragen zu stellen. Es ging auch wenig Initiative von ihnen aus, mich zu Fragen zu ihrem Leben zu animieren. Wenn es einmal vorkam, dann waren es Kriegsereignisse, die ich nicht hören wollte – damals. Ich hätte fragen sollen, damals – jetzt ist es zu spät und ich habe den rechten Zeitpunkt verpasst.
Enkel sind das Dessert des Lebens aus der Sicht von Großeltern. Meistens jedenfalls. Allerdings wäre es naiv zu meinen, dass ein Dessert immer nur lecker und süß und bekömmlich zu sein hätte. Denn mit Enkeln kann auch Leid verbunden sein: Sei es durch Krankheit oder Unfälle oder andere traurige Ereignisse. Leid für die Großeltern oder die Enkelkinder oder die Eltern oder für alle. Wer findet, dass das Leben sehr wohl mit einer Baustelle zu vergleichen sei, weiß, wie schnell und unerwartet und oftmals unvorhersehbar überraschend Veränderungen eintreten können. Die Großeltern wissen, dass hinter dem fröhlichen Enkel-Kinder-Leben schon der sogenannte „Ernst des Lebens“ wartet. Mit den Enkel-Kindern über die eigenen Erfahrungen des Lebens zu sprechen, ihnen davon zu erzählen und sie mit zeitgeschichtlichen Veränderungen zu konfrontieren – passt das noch zu der Freude am „Dessert des Lebens“? Ja, wenn man davon ausgeht, dass die Neugier der Enkel-Kinder die Themen (mit-)bestimmt und die Großeltern ihre Sicht auf die Welt weitergeben wollen. Nicht nur aus diesem Grund ist dieses „Dessert des Lebens“ fragil und auch nicht unbegrenzt haltbar, sondern endlich. Es hat seine Zeit. Die geht meistens bis zum Ende der Schulzeit der Enkelkinder. Denn das Dessert – der Nachtisch – beendet die Hauptmahlzeit und markiert das nahende Ende des gemeinsamen Essens. So ungefähr ist das – um im Bild zu bleiben – mit den Enkelkindern auch: Das Genießen des Desserts beginnt mit der Geburt der Enkelkinder und nähert sich von da an einem unbestimmten Ende. Das kommt in der Regel dann, wenn mit dem Ende der Schulzeit auch die Ablösung vom Elternhaus beginnt. Der Einstieg in die Berufsausbildung – meist verbunden mit dem Auszug – ist ein wichtiger Übergang. Dann ist regelmäßig auch die klassische Großelternrolle als Mittler zwischen den Generationen beendet. Mit den größer und erwachsen werdenden Enkelkindern kann eine neue Form des Kontakts beginnen – ein Kontakt auf Augenhöhe. Voraussetzung ist, dass das Leben der Enkel dafür Raum und Zeit lässt – und bei den Großeltern der Tod nicht dazwischen funkt.
GESPRÄCHE ZWISCHEN DEN GENERATIONEN
Als Opa bin ich für die Enkelkinder eine Person aus einer anderen, fremden Welt. Deshalb geben die Enkelkinder Großeltern die Möglichkeit, das eigene Leben zu rekapitulieren und zu erzählen – ohne das müde Lächeln der eigenen Kinder, die die Geschichten schon zig mal haben hören müssen. Vielleicht ist das der Grund, dass Gespräche zwischen Enkelkindern und Großeltern gut gelingen können – es liegt eine Generation zwischen ihnen. Die Gespräche sind nicht belastet von Erinnerungen, die so sehr unterschiedlich sein können: Die Erinnerungen der Kinder an frühere Ereignisse können negativ getrübt sein, was den Eltern gar nicht bewusst war. Gleichwohl sind die eigenen Kinder – als Eltern der Enkel – bei diesen Gesprächen mehr oder weniger präsent.
Das Aufschreiben der Gespräche zwischen den Generationen ist deshalb vor allem eine Liebeserklärung an die Enkel. Aber auch – bewusst und un-bewusst – eine Botschaft an die eigenen Kinder, die Enkel-Eltern ihren Vater in der Großvater-Rolle neu zu entdecken und besser kennen zu lernen. Gleiches würde natürlich auch für die Großmütter-Geschichten zutreffen.
Unversehens gerate ich in meine eigene, frühere Enkelrolle. Ich habe meine beiden Großväter nie kennengelernt. In den Geschichten, die in unserer Familie erzählt wurden, kamen die Großväter kaum vor. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich an einen Blick zurück wirklich interessiert gewesen wäre. Entsprechende Fragen an die Großmütter „Wie war das zu eurer Zeit? Was war anders als heute? Welche Unterschiede ergeben sich?“ habe ich selten gestellt. Mein Blick richtete sich vornehmlich nach vorne, in die ungewisse Zukunft. Ich erinnere mich jedoch deutlich an meine Großmutter. Die hatte eine klare Vorstellung von dem Miteinander der Generationen, vom Blick nach hinten, der Bedeutung des Heute und den Wünschen für die Zukunft. In solchen Situationen pflegte sie Gustav Mahler, dessen Musik sie sehr mochte, zu zitieren: „Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers.“ Damit meinte sie, sei alles gesagt. Übersetzt sollte das wohl heißen: Wenn ihr Jungen Tradition und Rituale nur als Asche seht, dann habt ihr das Feuer vergessen. Keine Asche ohne Feuer, und wer sagt denn, dass unter der Asche nichts mehr brennen kann. Es hat längere Zeit gedauert, bis ich mir diesen Oma-Satz wirklich zu eigen machen konnte. Als sie schon tot war, habe ich herausgefunden, dass dieser Satz von Jean Jaurès stammt, der 1910 im französischen Parlament in diesem Zusammenhang gesagt haben soll: “ … die richtige Art, die Vergangenheit zu betrachten, ist, das Werk der lebendigen Kräfte, die in der Vergangenheit gewirkt haben, in die Zukunft weiter zuführen.“ Das hätte meiner Oma gefallen und wahrscheinlich hätte sie gesagt, genau so habe ich Mahler immer verstanden.
Wäre das schön, wenn es in den Gesprächen zwischen den Generationen gelänge, die Erinnerungen und Erfahrungen aus der Vergangenheit für die Entwicklung der Enkelkinder-Generation fruchtbar zu machen. Gleichwohl sollten die Enkelkinder die Hauptrolle spielen, sie sind das Dessert, sie sind diejenigen, die die Geschichten inspiriert haben. Dazu lasse ich meine Phantasie spielen und erfinde Fragen, die die Enkel noch nicht gestellt haben, aber stellen könnten. Ich denke mir Geschichten aus, die auch von meinen Erinnerungen (samt den nicht gestellten Fragen an meine Eltern und Großeltern) leben. Sie sind also auto-fiktional. Zugleich macht das Alter meiner eigenen Enkelkinder von einem bis zehn Jahre deutlich, dass manches nur für deren Zukunft geschrieben sein kann.
Wenn allerdings Friday-For-Future-Aktive aus der Enkel-Generation diese Geschichten läsen, könnten sie feststellen, dass die Großeltern schon vor sehr ähnlichen grundsätzlichen Fragen gestanden haben: Basisdemokratie versus feste Entscheidungs- und Organisations-Strukturen? Außerparlamentarische, zivilgesellschaftliche Arbeit versus „Rein in die Parlamente“? Mitarbeit in Parteien versus Selbstorganisation?
Zugleich kann man mit diesen Geschichten auch die noch nicht geborenen Enkelkinder freudig und sorgenvoll im Blick haben. Das zeigt die Botschaft des Astronauten Gerst aus dem All (dazu Kapitel VI. An die zukünftigen Generationen).
Ermutigt von einer Geburtstagskarte meines ältesten Enkels, auf der ein bunt gestreiftes Zebra lauthals verkündet: „Sei immer du selbst. Andere gibt es schon genug!“ übernehme ich die „Steuerung“ der Geschichten. Sie zeigen meine Sicht auf die Welt, verdeutlichen meine Haltungen und betonen meine Interessengebiete. Ich wähle aus. Die sieben Kapitel dieses Buches sind wie Teile eines Puzzles mit zwei Besonderheiten: Zum einen bleibt das beabsichtigte Bild unfertig und lässt somit viele Fragen offen (To puzzle heißt im Englischen „verwirren“). Zum anderen geben die Geschichten, diese Puzzle-Teile eben, nicht die, sondern nur eine Wirklichkeit wider, eine Wahrnehmung von unendlich vielen. Das Puzzle lässt noch genug Raum, nicht nur für die eigene Phantasie, sondern auch für andere Wahrnehmungen aus derselben Zeit. Genau das macht den Reiz von Geschichten aus, weil – wie Christoph Ransmayr zu Beginn seines Buch „Atlas eines alten Mannes“ schreibt – Geschichten sich nicht ereignen, sondern erzählt werden. Das, was geschehe, könne auch von jemand anders ganz anders erzählt werden.
Der „Anfang der Geschichte“ will die Enkelkinder als ein Dessert des Leben wertschätzen und zeigen, dass die Großelternrolle eine Geschenk sein kann. Und die gesellschaftlichen Veränderungen der letzten Jahrzehnte sprechen dafür, dass auch die heutigen Großeltern ein Geschenk sein können – für die Enkel und für deren Eltern (Kapitel I).
Dann geht es um das Staunen der Enkel über Dinge aus der Zeit der eigenen Eltern und vor allem der Großeltern. Von den meisten haben die Enkel noch nie gehört oder kennen sie nur aus Erzählungen. Ich habe einiges gesammelt. Das Zeigen und Erzählen ermöglicht ein Vergleichen von damals und heute wie von alleine. Die Unterschiedlichkeit öffnet den Weg zu der Generationenfrage „analog oder digital“? (Kapitel II).
Der Ort, an dem die unterschiedlichen Generationen am häufigsten und wie selbstverständlich zusammenkommen, ist die Familie im weiten Sinne. Jeder hat da seine Erfahrungen und kennt die Geschichten, die erzählt werden – Familiengeschichten eben. Sie zeigen, wer dazu gehört und wo jeder seinen Platz in der Familie findet. Und dass auch das Bild von Familie einem Wandel unterliegt (Kapitel III).
Als Kind versteht man schwerlich, dass alle Menschen einmal Kinder waren – Eltern und Großeltern und Ur-Großeltern. Die Bedeutung der Kindheit und ihre Veränderungen ergeben eine schier unendliche Geschichte. Beides wird hier aus Großelternperspektive zum Gesprächsthema: Als eine Überlebensfrage in vielerlei Hinsichten (Kapitel IV).
Geschichte besteht aus Geschichten, heißt es. Jeder erlebt seine Geschichte(n), die privaten und die öffentlichen, die kleinen und die großen. Zeitzeuge zu sein ist immer etwas Besonderes, vor allem, wenn man die eigenen Geschichten an die Nachgeborenen weitergeben kann. Die Fertigstellung dieses Buches im Jahr 2020 ist kein Zufall. 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs gibt es viele und gewichte Anlässe für das Erinnern und gegen das Vergessen (Kapitel V).
Alles hat seine Zeit. Jede Generation hat ihre Zeit. Sie hinterlässt Spuren, mit denen nachfolgende Generationen zu recht kommen müssen. Damit stellt sich – direkt oder versteckt – die Frage nach der Generationen-Gerechtigkeit. Was hinterlässt die alte Generation der jungen? Wer oder was könnte dafür verantwortlich gemacht werden? Gibt es für diese aktuelle Situation auch eine individuelle Verantwortung der Großeltern gegenüber den Enkelkindern? Werden die Gespräche zwischen den Generationen zu einer Verständigung führen können? (Kapitel VI).
Wie wird die Geschichte weitergehen? Sie wird weitergehen. So oder so. Werden sich die Sorgen der Alten bewahrheiten oder wird der Optimismus die jungen Generationen für die Zukunft tragen? Die Zeit, die uns die Klima-Krise lässt, wird knapp. Die Herausforderungen sind enorm. Es ist 5 vor 12 (Kapitel VII).
Ich gerate ins Phantasieren und freue mich an dem Gedanken, dass irgendwann Enkel oder Urenkel in diesem Buch lesen möchten – mit Schmunzeln oder Wundern, mit Neugier oder Verdruss, mit Traurigkeit oder Staunen im Gesicht, weil sie sich ein Stückchen Welt aus der Sicht eines alten, vertrauten Menschen angeschaut haben. Sie werden dann wissen, welche Perspektive sich durchgesetzt haben wird. So! oder So?
OPA-ENKEL-DIALOGE
Mit den Enkeln ins Gespräch kommen – über meine Vergangenheit und deren Zukunft – von heute aus gesehen – das geht am ehesten über den Dialog. Opa und Enkel spielen sich die Bälle zu. An den Gesprächen ist nicht immer nur ein bestimmtes Enkel-Kind, sondern sind verschiedene Enkel unterschiedlichen Alters beteiligt. Jedenfalls sollten alle Beteiligten bei dem Spiel gleichermaßen ihren Spaß haben.
Auf dem Spielfeld habe ich einige „Eckfahnen“ platziert: Am Anfang geht es immer um die alte Standuhr. Die ist für jedes Enkel-Kind unabhängig von seinem Alter interessant: Was ist das? Wie funktioniert das? Warum steht die hier? Die Standuhr steht damit auch für die Frage nach der Zeit. Was ist die Zeit?
Eine wiederkehrende Rolle spielt die sogenannte Enkel-Kiste. Sie enthält handfeste Erinnerungsstücke, die zum Dialog anregen.
Die an den Dialogen beteiligten Enkelkinder sind pfiffig und klug. Sie lassen sich nicht von den manchmal etwas konstruierten Abfolgen irritieren. Sie nehmen die zum Teil sehr stark betonten Gegensätze zwischen den Generationen gelassen hin; sie lassen sich auch nicht von dem manchmal etwas lehrerhaften Zeigefinger beeindrucken. Im Gegenteil: Sie durchschauen dieses Spiel und lassen den Opa oftmals nicht gut aussehen.
Dieses Dialog-Muster mit den naiv-unscheinbaren oder wirklich allerletzten Fragen hat ein Vorbild. Es sind die MacherInnen von „Papa, Charly hat gesagt … Gespräche zwischen Vater und Sohn“. In den 70er Jahren hat der Norddeutsche Rundfunk jeden Samstag einen dieser Dialoge ausgestrahlt. Sie wurden sehr erfolgreich und so beliebt, dass die frechen Texte zwischen einem „achtjährigen Pfiffikus“ und seinem „mürrischen Vater“ auch als Bücher erschienen. Etwa 10 Jahre lang wurde diese Sendung ausgestrahlt und fünf Papa-Charly-Bücher erreichten bei Rowohlt riesige Auflagen. Die Gespräche zwischen Vater und Sohn dokumentierten immer auch ein Stück des jeweiligen gesellschaftlichen und politischen Alltags.
Eine Szene im ersten Band heißt „Umweltverschmutzung“. Das Gespräch dreht sich um Umweltschutz gegen eine Fabrik im Zusammenhang mit dem Rauchen des Vaters.
Die Formel „Papa, Charly hat gesagt …“ als Einstieg und gleichzeitiger Schutzschild für kritische Fragen des Kindes an den Erwachsenen ist unterhaltsam und anregend. Die Erinnerung an „Papa, Charly hat gesagt …“ ist mein Hintergrund für die folgenden Opa-Enkel-Dialoge.
Bei manchen Themen komme ich selbst noch einmal ins Grübeln und falle nachdenklich in die eigene Geschichte zurück. Daraus sind dann eigene Gedanken-Einschübe in kursiv geworden und kleine Kommentierungen zum Verhalten der Akteure.
Die Karikaturen von Uli Stein begleiten die Gespräche. Schließlich taucht an einigen Stellen ein Hinweis Für Sama auf. Das hat einen konkreten Grund, der bis zum Ende des Buches ein kleines Geheimnis bleiben soll.
Offen bleibt, wie dieses Spiel – nämlich die Beteiligten über die Generationen hinweg miteinander ins Gespräch zu bringen über Vergangenheit und Zukunft – ausgehen wird. In jedem Fall besteht die Chance, für die Gegenwart voneinander zu lernen; dort, wo ganz konkret und immer wieder das Analoge und das Digitale aufeinandertreffen. Je mehr es gelingt, den Drang zum Bewahren und den Mut zum Verändern in eine angemessene Balance bringen zu können, desto mehr wird Verständigung und gegenseitiges Verstehen gelingen.
Ich muss gestehen, manchmal sind die Dialoge ein wenig – wie soll ich sagen – in die Richtung „Opa erzählt vom Krieg“ geraten; so nach dem Motto: Was waren das für Zeiten, damals! Was haben wir nicht alles erlebt! Und was wir alles auf die Beine gestellt haben, damals! Das könnte die Verständigung mit den jungen erschweren – hoffentlich werden sie es nicht so wahrnehmen. Denn so ist es nicht gemeint. Aber jetzt ist es auch nicht mehr zu ändern.
Als das fertige Manuskript dieses Buches auf meinem Schreibtisch lag, wurde es von einem der Enkelkinder entdeckt. Darauf entspann sich folgender Dialog:
OPA, wo hast du den Spruch mit dem Dessert eigentlich her?
Den hab ich mal gehört, weiß nicht mehr wo. Er hat mir einfach gut gefallen
Er ist von Silvia.
Oma Silvia?
Nein, Königin Silvia.
Königin Silvia, wo gibt es denn die?
In Schweden.
Die hat das gesagt? Woher weißt du denn so was?
Google.
Hm.
Da steht noch mehr.
So – was denn noch?
Lauter Enkel-Dessert-Sprüche und …
… und was denn noch?
Ein Geschenk. Ich lese es dir mal vor: „Enkelkinder sind das Dessert des Lebens. DIN A5 Notizbuch, 120 Seiten liniert. Ein wunderbares Geschenk für Oma und Opa unter 10,00 Euro. Dieses besondere Notizbuch zur Anerkennung von Großeltern ist der perfekte Weg, um Ihre Dankbarkeit gegenüber den besten Omas und Opas aller Zeiten …“
Als das Manuskript endlich in den Druck gehen konnte, hatten wir schon ein Jahr Corona hinter uns. Wer zu Beginn der Pandemie vorhergesagt hätte, dass in absehbarer Zeit wir uns alle mit Masken vermummen müssten, dass Kinder sich auf Schule freuen würden, dass man zwischen Schnell-, Selbst- und PCR-Tests zu unterscheiden habe und so weiter – unvorstellbar.
Unsere neue Realität wird auch eine neue Wörter beschrieben – von Homeoffice bis Timeslot, von Mutante bis Vaccine. Diese Realität trennt Enkelkinder und Großeltern nachhaltig, wenn sie nicht ganz nah beieinander oder sogar unter einem Dach wohnen. Das ist bitter. Telefonieren und skypen und zoomen werden zu einem schlechten Ersatz.
Es wird viel zu erzählen geben in Nach-Corona-Zeiten. Die Langzeitspätfolgen für die Gesellschaft und die Menschen – insbesondere für die Kinder – sind noch nicht abzusehen. Es wird sich eine „neue Normalität“ entwickeln.“ Aber diese Zeiten verdienen eine eigene Geschichte. Die soll ausführlich ein andermal erzählt werden.
OMA, wenn Opa sagt, der Krieg ist der
Vater aller Dinge …
Sagt er das?
Hin und wieder.
Weißt du denn, was er damit meint?
Ja, so was wie Not macht erfinderisch.
Genau.
Aber was macht dann die Mutter?