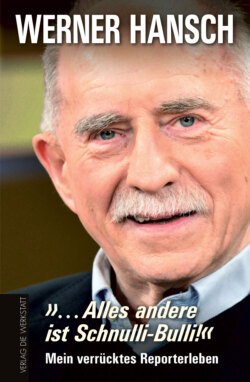Читать книгу '… Alles andere ist Schnulli-Bulli!' - Werner Hansch - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеKriegskinder
Mein Vater, ein unbekanntes Wesen
Keine sieben Wochen, bevor ich zur Welt kam, wurde mein Vater als Gefangener mit der Nummer 7824 in das Konzentrationslager Buchenwald eingeliefert. Es handelte sich um eine sogenannte Schutzhaft – mit diesem Begriff verschleierten die Nazis das willkürliche Wegsperren von politischen Gegnern. Mein Vater hatte unter dem Einfluss von Alkohol, vermutlich in einer Kneipe, seine Zunge nicht im Zaum halten können und etwas Abfälliges über den Mann gesagt, den man damals den „Führer“ nannte. Jemand muss meinen Vater denunziert haben, denn kurz darauf wurde er von der Gestapo verhaftet.
Es bestand nie eine Chance für ihn, glimpflich davonzukommen. Einige Jahre zuvor hatte man ihn nämlich wegen etwas angeklagt, das man heute wohl als Unterstützung einer terroristischen Aktion bezeichnen würde, und zu einer zweijährigen Zuchthausstrafe verurteilt. Er war also vorbestraft und dem Regime als Widerständler bekannt. Deshalb überführte ihn die Polizei zwei Wochen nach seiner Verhaftung, am 5. Juli 1938, nach Buchenwald. Meine hochschwangere Mutter saß plötzlich ohne den Ehemann und Ernährer in unserer winzigen Wohnung in Recklinghausen Süd.
Diese Wohnung befand sich in der Leusbergstraße, die allerdings zu diesem Zeitpunkt nicht mehr so hieß. Wie zum Hohn wohnte die kleine Familie des renitenten Kommunisten Stefan Hansch damals in der Hermann-Göring-Straße Nummer 28.
Viele dieser Einzelheiten weiß ich erst seit kurzer Zeit. Als junger Bursche bekam ich durch Gesprächsfetzen mit, dass mein Vater im Gefängnis gewesen war. Von alten Leusbergern erfuhr ich zudem, dass er zu einer Gruppe von Kommunisten gehörte, die sich vor Hitlers Machtübernahme mit der SA Straßenkämpfe geliefert hatte. Diese Nachbarn – vor allem Tante Anni und Onkel Leo – erzählten mir, wie die Nazis meinen Vater und andere unliebsame Leute in regelmäßigen Abständen aufs Präsidium holten. Dort legte man sie über den Tisch, und sie bekamen Prügel mit dem Ochsenziemer, einer üblen Schlagwaffe.
Mir war auch dunkel bewusst, dass mein Vater in einem Konzentrationslager gewesen war. Das hing mit dem Schrank zusammen, den wir so um 1950 herum bekamen. Heute würde man das Ungetüm mit seiner wulstigen Leiste als „Gelsenkirchener Barock“ bezeichnen. Als der Schrank geliefert wurde, stand die halbe Straße staunend vor dem Möbelwagen und hat uns ganz offen darum beneidet, dass wir uns so etwas leisten konnten. Ich wunderte mich natürlich auch, und da sagte Tante Anni zu mir: „Das ist vom KZ. Dein Papa hat Entschädigung bekommen.“
Schließlich hörte ich gelegentlich von meinem Vater selbst, dass er unschöne Dinge erlebt hatte. Denn manchmal, wenn er in der Gaststätte, über der wir wohnten, zu viel getrunken hatte, weckte er mich mitten in der Nacht und sagte, ich solle in die Küche kommen. Dann saßen wir am Esstisch, und er berichtete mir einzelne Szenen. Ich erinnere mich noch, wie er mir erzählte, dass die sogenannten Kapos am schlimmsten waren, die Häftlinge, die man im KZ mit besonderen Aufgaben betraut hatte und die auf die anderen Gefangenen aufpassten. Doch in solchen Nächten fing mein Vater meistens bald an zu schluchzen. Der Alkohol tat ein Übriges, und rasch liefen ihm die Tränen übers Gesicht. Ich saß dann einfach nur stumm auf meinem Stuhl und wartete geduldig, bis er endlich fertig war. Denn er steckte mir immer ein paar Mark zu, bevor er mich wieder ins Bett schickte.
Aber ich fragte meine Eltern nie von mir aus nach Einzelheiten oder nach den Hintergründen der ganzen Geschichte. Im Gegenteil, als junger Bursche neigte ich eher dazu, meinen Vater zu provozieren. Er war Mitglied in der VVN, der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes. Einmal im Monat kam ein Mann namens Jakubowski zu uns, um den Mitgliedsbeitrag einzusammeln. Er war ein alter Genosse meines Vaters, und wenn ich an dem Tag zufällig in der Wohnung war, habe ich die beiden gerne auf die Palme gebracht. Ich lobte dann den christlich-konservativen Bundeskanzler Konrad Adenauer über den grünen Klee. Zum Teil, weil ich da tatsächlich noch ein glühender Anhänger von ihm war. Aber auch, weil ich wusste, dass sich meinem Alten die Nackenhaare aufstellten, ohne dass er etwas tun konnte. In einer politischen Diskussion war er mir rhetorisch unterlegen. „Mensch, Stefan“, sagte Jakubowski dann traurig zu meinem Vater, „da hast du dir aber einen großgezogen.“
Das klingt vielleicht schlimm, aber in jener Zeit war das normal – als Jugendlicher rebellierte man gegen die Generation davor und war von den Kriegsgeschichten nur gelangweilt. Und als sich das änderte, da war es für mich zu spät: Ich war noch keine 23 Jahre alt, als ich beide Elternteile verlor. Deswegen weiß ich über meine Familie, nicht bloß über meinen Vater und meine Mutter, weniger, als ich heute gerne wissen würde. Das Wenige, das mir bekannt ist, beginnt in einem Land, das in meinem Leben mehrfach eine besondere Rolle gespielt hat und mir sehr am Herzen liegt – Polen.
Bergmann, Kommunist, Oppositioneller
Mein Vater Stefan Hansch wurde am 18. August 1890 in Bielewo geboren. Das ist ein kleines polnisches Dorf, in dem zu jener Zeit weniger als 400 Menschen lebten und das zum Landkreis Kosten in der Provinz Posen gehörte. Wie ich selbst später auch, so muss er früh beide Eltern verloren haben. Das weiß ich allerdings nur aus Erzählungen, aber es erklärt, warum ich nie einen Großvater oder eine Großmutter väterlicherseits kennengelernt habe.
Zusammen mit einem Onkel kam mein Vater als ganz junger Kerl, kurz nach der Jahrhundertwende, auf der sogenannten Ost-West-Wanderung der polnischen Arbeiter ins Ruhrgebiet. Dort waren die Zechen wie Pilze aus dem Boden geschossen, und es wurden dringend Bergleute gesucht. Viele Polen wanderten sogar noch weiter, bis in die nordfranzösischen Kohlereviere. Deswegen hatten wir später Verwandte in Lille, die ich als Pennäler mal besucht habe. Mein Vater aber blieb in Recklinghausen hängen und fing auf dem Pütt an, mit vierzehn oder fünfzehn Jahren.
Als er dann in das Alter kam, in dem man damals eine Familie gründete, fuhr mein Vater zurück in die Heimat, um sich eine Frau zu suchen. Er fand sie in der Gegend um die Stadt Zielona Góra, die zu jener Zeit recht wörtlich übersetzt Grünberg hieß. Er kam mit ihr zurück nach Recklinghausen, denn hier hatte er ja Arbeit, und die beiden bekamen kurz hintereinander zwei Kinder: meine Halbbrüder Marian und Felix.
Als die zwei Jungs noch klein waren, starb ihre Mutter an Lungenentzündung. Mein Vater nahm seine beiden Söhne und fuhr mit ihnen nach Sulechów, den polnischen Ort, in dem seine Schwiegermutter lebte. Und dort ging alles dann ratzfatz. Die Schwiegermutter, meine Oma, sagte zu ihrer ältesten noch ledigen Tochter: „Wir können den Stefan nicht mit den Kindern allein lassen. Jetzt musst du ihn eben heiraten!“
Eine Ehe aus Liebe sieht sicher anders aus, doch damals war eine pragmatische Lösung des Problems eben wichtiger als romantische Gefühle. Ich nehme auch an, dass Magdalena Tomczak, meine Mutter, das Ganze als Chance begriff, dem perspektivlosen polnischen Landleben zu entkommen. Sie willigte ein und wurde im Juli 1913 die zweite Frau von Stefan Hansch.
Meine Oma wollte diese neue Familie nicht von Beginn an durch die Anwesenheit zweier kleiner Kinder belasten. Deswegen sollte einer der beiden Söhne zunächst bei ihr bleiben. Es traf Marian, und so kehrte mein Vater zusammen mit seiner neuen, sechs Jahre jüngeren Frau Magdalena und seinem Sohn Felix zurück ins Ruhrgebiet. Aus dieser Ehe gingen schließlich drei Kinder hervor. Meine Schwester Gertrud wurde 1920 geboren, meine Schwester Felicitas, genannt Zita, zwei Jahre später. Tja, und dann, mit gehörigem Abstand, wurde ich in diese Welt geworfen – am 16. August 1938. (Nicht am 19., wie man manchmal liest.)
Da ging es wohl schon los mit den Zufällen, die mein Leben bestimmen sollten. Denn man darf getrost davon ausgehen, dass ich ein überhaupt nicht mehr geplanter Nachzügler war. Meine Mutter war schließlich schon über 40, als sie noch einmal schwanger wurde, mein Vater ging auf die 50 zu. Dazu kamen natürlich noch die politischen Verhältnisse. Am 30. Januar 1933 war Hitler als Reichskanzler vereidigt worden, was die Lebensumstände für jemanden wie meinen Vater dramatisch verschlechterte. Etwas mehr als ein Jahr vor der sogenannten Machtergreifung der Nazis war er nicht nur der KPD beigetreten, sondern auch einer Gruppe, die sich Revolutionäre Gewerkschafts-Opposition (RGO) nannte.
Wie so vieles, was meinen Vater betriftt, so weiß ich auch dies erst seit Kurzem – und zwar durch das Studium von Prozessakten. Ihnen entnehme ich auch, dass Stefan Hansch im Ersten Weltkrieg Soldat war und verwundet wurde. Mir hat er davon nie etwas erzählt, aber vielleicht hat ihm diese Tatsache ein wenig geholfen, als er Anfang September 1933 verhaftet wurde. Er konnte jedenfalls jeden mildernden Umstand gut gebrauchen, denn die Anklage lautete „Vorbereitung zum Hochverrat“.
Im Sommer zuvor, im Mai oder Juni 1932, hatte ein alter Bekannter meines Vaters, der Skomski genannt wurde, ihn gedrängt, Sprengstoff zu besorgen. Stefan Hansch arbeitete damals auf der Zeche Consolidation in Gelsenkirchen-Schalke. (Als ich das in den Akten las, hätte ich fast laut gerufen: „Natürlich Schalke! Wo sonst?“) Er war Gesteinshauer und hatte deswegen Zugang zu solchen Materialien. Nach anfänglichem Zögern tat er Skomski den Gefallen. Natürlich wusste mein Vater, dass Skomski Mitglied des Rotfrontkämpferbundes war und den Sprengstoff für einen Anschlag oder sogar einen bewaffneten Aufstand brauchte.
Ein paar Monate, nachdem die Nazis an die Macht gekommen waren, wurden Skomski und viele andere Mitglieder der Verschwörung verhaftet. Mein Vater hatte zunächst Glück; niemand verpfiff ihn. Doch man kann sich vorstellen, zu welchen Methoden die Nazis bei der Vernehmung der Kommunisten griffen. Nach vier Monaten in der Untersuchungshaft (und vermutlich unter Folter) gab Skomski zu, bei seiner ersten Vernehmung nicht die ganze Wahrheit gesagt zu haben. Er nannte jetzt weitere Namen, und drei Tage später wurde Stefan Hansch verhaftet. Beim Verhör gab mein Vater alles zu. In der Niederschrift seiner Aussage heißt es: „Meine damalige Handlung bereue ich aufrichtig, ich sehe aber ein, dass ich Strafe verdient habe.“ Menschen, die sich mit diesen Dingen auskennen, haben mir gesagt, dass eine solche Formulierung darauf hindeutet, dass mein Vater seine Aussage unter der Einwirkung oder Androhung von Gewalt gemacht hat.
Der Prozess fand im Frühling 1934 vor dem Oberlandesgericht Hamm statt. Unter den Nazis war das OLG Hamm vor allem für politische Verfahren zuständig. Mein Vater war zusammen mit gleich 28 anderen Personen angeklagt. Die meisten von ihnen waren Bergleute aus Recklinghausen und Westerholt, einem Stadtteil von Herten. Bei dieser großen Zahl von Beschuldigten sollte man meinen, dass es sich um eine spektakuläre, langwierige Verhandlung handelte. Doch im Archiv der Recklinghäuser Zeitung lässt sich keine einzige Zeile darüber finden. Es ist also gut möglich, dass der Prozess, wenn man ihn überhaupt so nennen will, nicht öffentlich war und die Angeklagten keinen Rechtsbeistand hatten.
Nur drei von ihnen kamen ohne Strafe davon, die anderen wurden am 27. April 1934 wegen Vorbereitung zum Hochverrat verurteilt. Einige der Männer wurden mit fünf Jahren Zuchthaus bestraft, für „Beteiligung am Rotfrontkämpferbund, ein Schusswaffenvergehen und ein Sprengstoffverbrechen“. Mein Vater kam besser davon. Ihm wurde nur das Sprengstoffverbrechen zur Last gelegt. Das Urteil lautete auf zwei Jahre Haft, allerdings wurden ihm von dieser Strafe die Monate abgezogen, die er bereits in der Untersuchungshaft verbüßt hatte.
Wenige Tage nach dem Urteilsspruch wurde Stefan Hansch vom Gerichtsgefängnis Hamm in die Strafanstalt Münster gebracht. Auf seiner Karteikarte ist vermerkt, dass er 1,78 Meter groß und von kräftiger Gestalt war, einen Schnurrbart trug und seine Initialen auf die rechte Hand tätowiert hatte. Auf der Karte steht ebenfalls, dass er zwanzig Monate später entlassen wurde, am 27. Dezember 1935 um 7.30 Uhr morgens.
Jetzt, wo ich in einem Alter bin, in dem ich auf mein eigenes, wechselhaftes Leben zurückblicke, schaue ich auf diese Karte und stelle mir Fragen. Mein Vater kam drei Tage nach Weihnachten aus dem Zuchthaus. Wie mag der Rest der Familie dieses Fest verbracht haben? Wovon hatten sie gelebt? Machte meine Mutter meinem Vater Vorwürfe? Versprach er ihr vielleicht, in Zukunft nichts mehr zu tun, was die Familie in Gefahr brachte – bis zu jenem verhängnisvollen Tag, als er zu viel trank?
Ich werde es nie wissen, denn ich kann niemanden aus meiner Familie fragen. Sie sind alle tot. Und der Einzige, der mir wirklich jede Frage hätte beantworten können, war im Grunde schon tot, als er noch lebte. Denn mein Vater war ja nicht nur vom Gefängnis gezeichnet, von den Schlägen mit dem Ochsenziemer und vom KZ. Auch seine Berufsvergangenheit forderte ihren Tribut – er wurde wegen einer Steinstaublunge frühpensioniert, als schwerkranker Mann. Und so kam er mir oft vor wie ein Fremder in unserer Mitte. Er saß mit seiner Pfeife im Sessel neben dem Radio und schaute stundenlang geradeaus, immer in dieselbe Richtung. Als ob er ins Nichts blicken würde. Oder vielleicht waren es auch Abgründe.
Dass mein Vater mir immer seltsam fremd blieb, habe ich mir selbst lange auch damit erklärt, dass ich im Grunde ohne ihn aufwuchs. In meiner Erinnerung kamen wir nach dem Ende des Krieges zurück in die Straße, die nun nicht mehr nach Hermann Göring benannt war, und da stand er plötzlich – mein Vater. Ich war fast sieben Jahre alt und sah einen von Entbehrungen gezeichneten Mann, den man gerade aus dem KZ entlassen hatte. Es war ein Fremder, ich war ihm ja nie zuvor begegnet. Seine Empfindungen mir gegenüber dürften ganz ähnlich gewesen sein, und irgendwie schafften wir es später nicht mehr, das aufzubauen, was man eine natürliche Nähe nennen könnte.
Nun aber kommt das Merkwürdige. Der Internationale Suchdienst in Bad Arolsen, ein Zentrum für Informationen über Verfolgung während der NS-Zeit, hat mir im Februar 2014 Dokumente über die KZ-Zeit meines Vaters geschickt. Aus ihnen geht hervor, dass Stefan Hansch am 21. Mai 1938 wegen „staatsfeindlicher Äußerungen“ verhaftet wurde. Die zwei Sätze, die ihn ins KZ brachten, lauteten: „Ich weiß gar nicht, wieso sie alle dem Hitler nachlaufen. Der ist doch auch bloß ein Arbeiter.“ Als man ihn deswegen zwei Wochen später nach Buchenwald brachte, wurde zwar auf seiner Häftlingspersonalkarte vermerkt, dass ihm das „in betrunkenem Zustand“ herausgerutscht war, aber vor Strafe schützte ihn dieser Umstand nicht.
Am Tag, als mein Vater nach Buchenwald kam, wurden außer ihm noch 51 andere Personen eingeliefert. Zwei von ihnen waren als sogenannte Bibelforscher verhaftet worden, was bedeutet, dass sie den Zeugen Jehovas angehörten. Sie waren dem Regime religiös unliebsam. Sechs weitere Gefangene galten als „Vorbeuge-Häftlinge“. Es steht zu vermuten, dass es sich bei ihnen um Kriminelle oder auch nur um mutmaßliche Kriminelle handelte, die ohne Gerichtsbeschluss einfach weggesperrt wurden. Die meisten der Gefangenen aber, fast drei Dutzend, hatte man als „arbeitsscheu“ festgenommen. So bezeichneten die Nazis Menschen aus der Unterschicht. Sie waren dem Regime sozial unliebsam.
Schließlich waren da noch acht politische Gefangene. Zu jener Zeit, im Sommer 1938, unterschied die SS in Buchenwald drei Gruppen von solchen Häftlingen: „einfache Politische“, „politisch Rückfällige“ und „politische Juden“. Von den acht politischen Gefangenen, die am 5. Juli ins KZ kamen, waren fünf „einfache Politische“, zwei weitere waren Juden. Wegen seiner Vorstrafe war Stefan Hansch der einzige, der als rückfälliger politischer Gefangener galt. Daher muss er eine KZ-Uniform bekommen haben, auf die ein roter Winkel (für: Politische) zusammen mit einem roten Streifen (für: Rückfällige) aufgenäht war.
Vom 20. September 1938 an wurde mein Vater dann nicht mehr als „rückfällig“ geführt, sondern als einfacher politischer Gefangener. Wie es dazu kam, kann ich nicht sagen. Vermutlich verhielt er sich konform, vielleicht spielte auch sein Gesundheitszustand eine Rolle, der zu dieser Zeit schon nicht gut gewesen sein kann. Im Oktober wurde er jedenfalls zum Gerichtsgefängnis Herne gebracht, wahrscheinlich zur Untersuchung seines Falles. Am 24. November schickte man ihn zurück nach Buchenwald, wo er eine neue Nummer bekam, die 895. Die Aufzeichnungen enden kaum drei Monate später, am 7. Februar 1939. Denn um 15 Uhr an diesem Tag wurde mein Vater zusammen mit 26 anderen Häftlingen aus dem KZ Buchenwald entlassen und nach Hause geschickt.
Ich war sehr, sehr erstaunt, als ich dies las. Das frühe Datum seiner Entlassung – sogar noch vor dem Kriegsbeginn – lässt nur drei Schlussfolgerungen zu. Entweder kehrte er vom KZ gar nicht nach Recklinghausen zurück und wurde zum Beispiel zur Wehrmacht eingezogen. Das ist allerdings unwahrscheinlich. Wohin hätte er gehen sollen, wenn nicht zu seiner Familie? Und für die Armee war er zu alt und zu krank. Die zweite Möglichkeit ist, dass ich einfach keine Erinnerungen mehr daran habe, dass er zu uns auf den Leusberg zurückkam. Das kann durchaus sein, denn ich war ja erst ein halbes Jahr alt. Drittens ist es möglich, dass mein Vater nach Hause kam – aber seine Familie schon nicht mehr dort war.
Mein Halbbruder Felix war zu dieser Zeit Berufssoldat und hatte daher sein Auskommen. Er hatte sich irgendwann in den 1920er Jahren der Armee angeschlossen, die Deutschland nach dem Ende des Ersten Weltkriegs von den Siegermächten erlaubt worden war, dem sogenannten 100.000-Mann-Heer. Felix hatte kein Abitur, aber er war ein aufrechter, strebsamer Mensch und brachte es bis zum Feldwebel. Er war also beim Militär gut versorgt, sofern man das in diesen Zeiten von einem Soldaten sagen konnte.
Auch meine beiden Schwestern waren so gut untergebracht, wie es unter den Umständen möglich war. Sie befanden sich am Timmendorfer Strand und machten das, was man eine Hotellehre nannte. An der Ostsee wurden junge Mädchen zum Bettenmachen und Putzen gebraucht. Es war die einzige Möglichkeit für die beiden, auch nur den Ansatz einer Perspektive für ihr weiteres Leben zu haben, denn eine weiterführende Schule war für sie nie infrage gekommen.
Für meine Mutter allerdings muss die Lage sehr schwierig gewesen sein – mit einem Kleinkind an der Hand und einem zweimal inhaftierten Kommunisten als Mann. Und so nahm sie mich und fuhr zu ihrer Mutter nach Polen. Wann das geschah, kann ich nicht sagen. Ich habe immer geglaubt, wir hätten Recklinghausen ungefähr 1941 verlassen. Aber ich kann auch nicht völlig ausschließen, dass es viel früher passierte – kurz nachdem mein Vater aus Buchenwald kam oder vielleicht sogar kurz vorher.
Polnische Kinderjahre
Für ein Kind war die ländliche Idylle in Polen wunderschön. Hinter dem Dorf lag ein See, drum herum Wälder. Mein Onkel hatte einen kleinen Bauernhof, und so war die Zeit alles in allem gar nicht so schlecht für uns. Ich lernte auch sehr schnell Polnisch und beherrschte die Sprache bald fließend. Dennoch war der Krieg nicht weit weg. Als die deutsche Wehrmacht Polen besetzt hatte und auf dem Marsch durch Russland war, nahm man meinem Onkel das Gut weg und stellte ihn als Knecht auf seinem eigenen Hof an. Ich kann mich an einen Mann in Uniform erinnern, der dort aufpasste. Ich weiß auch noch, dass die Bürgersteige im Dorf markiert waren, um anzuzeigen, wo Juden hergehen mussten und in welchen Läden sie nicht einkaufen durften.
Eines Tages wurden Personalkontrollen gemacht. Ein Uniformierter kam in das Haus von Oma Tomczak und sah sich die Ausweise aller Anwesenden genau an. Ich habe den Moment noch ganz klar vor Augen, als er auf den Pass meiner Mutter blickte, dann hochschaute und sagte: „Aber Sie sind ja Deutsche!“ Als meine Mutter nickte, wollte er wissen: „Warum tragen Sie dann kein Hakenkreuz?“ Ich kann mich nicht erinnern, was meine Mutter als Erklärung vorbrachte, aber es kann nicht überzeugend geklungen haben, denn der Beamte sagte barsch: „Beim nächsten Mal will ich das aber sehen!“
So klein ich war, ich spürte an den Reaktionen der Erwachsenen, dass uns plötzlich eine unbestimmte Gefahr drohte. Unsere Verwandten befürchteten offenbar, dass die Polizei von diesem Moment an mit Misstrauen auf meine Mutter schauen würde. Denn noch am Abend desselben Tages setzte uns mein Onkel mit all unseren Sachen auf einen Panjewagen, einen von einem Pferd gezogenen einfachen Heuwagen. Der transportierte uns ungefähr 30 oder 40 Kilometer weiter in ein anderes Dorf, in dem ebenfalls Verwandtschaft lebte.
Dort blieben wir bis zur großen Wende des Krieges, Stalingrad. Nach der Vernichtung der 6. Armee Anfang 1943 zogen sich die deutschen Soldaten immer weiter zurück, hinter ihnen kamen die Russen. Alle hatten Angst, aber ich nehme an, dass man sich um uns besonders sorgte, da wir ja laut Ausweis Deutsche waren. Irgendwann standen zwei Koffer gepackt vor uns, vornehmlich mit Verpflegung, und es hieß: zurück ins Ruhrgebiet.
Wir reisten über Berlin, und dort überraschte uns am Bahnhof Friedrichstraße ein Fliegeralarm. Tausende von Menschen strömten auf einmal zum Bahnhof, um Schutz unter seinem Dach zu suchen. Es herrschte ein unglaubliches Gedränge. Ich stolperte hinter meiner Mutter her, meine Hände klammerten sich an ihren Mantel. Plötzlich spürte ich, wie mir der Stoff durch die Finger glitt. Ich begann, wie am Spieß zu schreien. Ich hatte ganz einfach Angst, von den Massen erdrückt zu werden. Meine Mutter stellte einen kurzen Moment die Koffer hin, wandte sich zu mir um und packte mich. Als sie sich wieder nach vorne drehte, waren die beiden Koffer weg.
Die Fahrt von Berlin nach Hause war abenteuerlich und dauerte fast eine Woche, denn der Zug fuhr nur im Dunkeln und blieb bei jedem Luftalarm, von denen es einige gab, stehen. Aber irgendwie, irgendwann kamen wir tatsächlich in Recklinghausen an. Es muss so Ende 1943, Anfang 1944 gewesen sein. Bald darauf kehrten auch meine Schwestern von der Ostsee zurück, wohl ebenfalls aus Angst vor den anrückenden Russen. Gertrud hatte inzwischen geheiratet und war Mutter eines kleinen Jungen. Wo sich mein Vater befand, vermag ich nicht zu sagen. Ich habe jedenfalls keine Erinnerung daran, ihn gesehen zu haben, als wir aus Polen zurückkehrten.
Allerdings gab es für mich auch ein viel dringenderes Problem, als mir Gedanken über meinen Vater zu machen. Zwar waren wir wieder daheim in der Leusbergstraße – aber ich sprach kein Wort Deutsch mehr! Es klingt verrückt, vor allem wenn man bedenkt, dass meine Muttersprache später zum zentralen Element meines Berufslebens werden sollte, aber es war so: Während des Aufenthalts in der Gegend um Zielona Góra hatte ich nur Polnisch gesprochen und dabei das Deutsche verlernt. Ich kann mich noch erinnern, wie ich zurück in Recklinghausen mit Tante Anni zu dem Tante-Emma-Laden in der Leusbergstraße ging. Die Passanten sprachen mich an, aber ich starrte nur zurück und konnte nicht antworten. Mówię tylko po polsku – ich spreche nur Polnisch.
Wir blieben nicht lange im Ruhrgebiet, denn im Rahmen einer Evakuierung der durch Luftangriffe gefährdeten Gebiete kamen wir in den Ort Lütmarsen bei Höxter, zu einem Bauern. Wir, das waren meine beiden Schwestern, ich und Jürgen, der kleine Sohn von Gertrud. Meine Schwestern mussten auf dem Bauernhof arbeiten, aber für mich war es eine wunderbare Zeit. Der Bauer hatte Kinder in meinem Alter, wir tollten auf dem Heuboden herum und spielten mit den Katzen des Hofes. In dieser für mich sehr unbeschwerten Zeit lernte ich dann wieder Deutsch, wenn auch mühsam. Selbst später – während der ersten Jahre in der Volksschule – hatte ich noch Sprachprobleme und legte das Polnische nur langsam ab. Immerhin aber konnte ich mich in Lütmarsen verständigen und bekam alles mit. Auch die Befreiung.
Lütmarsen liegt in einem kleinen Tal. Eines Tages im Jahre 1945 lagen wir Kinder auf der Fensterbank in der Küche. Dort war ein großes Panoramafenster, von dem aus man einen guten Überblick über die ganze Umgebung hatte. Mit einem Mal sahen wir Gestalten, die über den Hügelkamm robbten. Wir fanden das ganz aufregend. Die Männer krochen immer so zehn bis fünfzehn Meter, dann blieben sie eine Zeit unbeweglich liegen. Für uns sah das aus wie Indianerspielen.
Es waren amerikanische Soldaten. Etwas später standen sie in der großen Diele des Bauernhauses. Ich weiß noch, wie mir auffiel, dass auch Schwarze dabei waren. Sie hatten ihre Maschinenpistolen über die Schulter gehängt und verteilten Kaugummi unter uns Kindern. In der Zwischenzeit musste die Bäuerin ihre größte Pfanne aus dem Schrank holen und für die hungrigen Soldaten Rührei machen. Staunend sah ich zu, wie sie bestimmt 50 Eier in die massige Pfanne kloppte.
Fast alle auf dem Bauernhof waren sehr froh über die Ankunft der Amerikaner. Nur eine polnische Magd, die heulte Rotz und Wasser. Als sie die Soldaten sah, wurde ihr klar, dass der Krieg bald zu Ende sein würde und sie in ihre Heimat zurückmusste. Sie wäre viel lieber auf dem Hof geblieben. Auch in der Stadt gab es kaum Wiederstand. Die Amerikaner befahlen allen Einwohnern der Gegend, ihre Waffen abzugeben, und bald türmten sich auf dem Marktplatz die Gewehre. Selbst die rostigsten Jagdflinten lagen da, denn die Leute hatten Angst und wollten wirklich alles abgeben. Nur ein einzelner Idiot hatte es sich in den Kopf gesetzt, sein Tausendjähriges Reich eigenhändig mit der Waffe zu verteidigen. Er stellte sich auf der Hauptstraße nach Höxter einem amerikanischen Panzer in den Weg und feuerte auf den Soldaten, der aus der Luke guckte. Da haben die Amis ihn gleich umgepustet.
Der Tag, an dem wir von Lütmarsen zurück nach Hause kamen, war in meiner bewussten Erinnerung der erste, an dem ich meinen Vater sah. Er war schon in unserer Wohnung in der Leusbergstraße, als wir eintrafen. Meine Mutter hatte mir nie richtig erklärt, warum mein Vater in den Jahren davor nicht bei uns gewesen war, und ich hatte sie nie danach gefragt. Ich nehme schon an, dass man mir eine kurze Erklärung gegeben hat, vermutlich ein lapidares „Er ist im Krieg“. Das dürfte mir gereicht haben, denn es war in jener Zeit ja normal, dass Väter von ihren Familien getrennt waren.
Auch Felix kam bald zurück. Er hatte Glück und verbrachte nur kurze Zeit in englischer Kriegsgefangenschaft. Da er aber nichts anderes als Soldat gelernt hatte, musste er sich nun als Handlanger verdingen. Den Rest seines Lebens arbeitete er fleißig und treu auf dem Bau. Er gründete eine Familie und wohnte später in Hochlarmark, einem Stadtteil im Süden von Recklinghausen. Er bekam drei Kinder, ich bin der Patenonkel von einem von ihnen.
Meinen anderen Halbbruder, Marian, habe ich hingegen nie zu Gesicht bekommen. Er gründete eine eigene Familie, aber in den Wirren des Zweiten Weltkriegs ging der Kontakt zu ihm verloren. Bis zum heutigen Tag habe ich keine Ahnung, was aus ihm geworden ist.
Die Leusbergstraße in Recklinghausen Süd
Mein Elternhaus, also die Leusbergstraße 28, liegt im Süden von Recklinghausen, ganz in der Nähe der Emscher und damit an der Stadtgrenze zu Herne. Das berühmte Stadion am Schloss Strünkede, die Heimat von Westfalia Herne, ist nur zwei Kilometer entfernt. Ich bin allerdings nie hingegangen, um Fußball zu sehen. Mit diesem Sport hatte ich überhaupt nichts am Hut, wie sich noch zeigen wird. Abgesehen davon war meine Kindheit allerdings geradezu eine Ruhrpottjugend aus dem Bilderbuch. Ich wuchs auf zwischen Eckkneipen, Brieftauben und Bergleuten.
Die Kneipe war sogar direkt unter uns. Wir wohnten im zweiten Stock, als eine von dreizehn Familien in dem Haus. Im Erdgeschoss befand sich die Kneipe. Hier spielte mein Vater mit seinen Kumpels gerne Doppelkopf, und ich war auch regelmäßig dort, denn ich war gut befreundet mit dem Sohn der Wirtsleute, Günther. Seinen Eltern gehörte nicht nur die Gaststätte, sondern das ganze Haus, sie waren also unsere Vermieter.
Die Kneipe war der gesellschaftliche Mittelpunkt des ganzen Viertels. Dazu gab es noch zwei Brieftaubenvereine: „Rote Erde“ und „Über Land und Meer“. Mein Vater hatte keine Brieftauben, aber Onkel Leo besaß ein paar dieser „Rennpferde des kleinen Mannes“. Sonntags musste ich für ihn oft die kantigen Spezialuhren, mit denen man die genaue Ankunftszeit der Brieftauben festhielt, zur Taubenzentrale bringen. Dort wurden die Ergebnisse dann ausgewertet.
Unsere Wohnung war klein, es gab nur einen Schlafraum und eine Wohnküche. Deswegen schlief ich bis zum Abitur im Schlafzimmer meiner Eltern. (Sie waren ja schon betagt und, ich will es mal so ausdrücken, von allem Weltlichen entfernt.) Trotz des beengten Raumes waren wir sogar zu viert in der Wohnung, denn auch meine Schwester Zita lebte bei uns. Das lag zum einen daran, dass sie unverheiratet war. Zum anderen daran, dass es auch meiner Mutter gesundheitlich nicht besonders gut ging. In den letzten Tagen des Krieges wäre sie an einer Darmverschlingung fast gestorben. Eine Not-OP bei Kerzenlicht hatte sie gerettet, doch seither musste sie dicke Bauchbänder tragen und konnte nicht einmal mehr einen Eimer Wasser heben. Deswegen führte Zita uns den Haushalt. Das war im Grunde ihr Beruf, nebenbei verdiente sie sich noch ab und zu etwas dadurch, dass sie unten in der Kneipe hinter der Theke aushalf. Sie übernachtete in einem winzigen, unbeheizten Raum unter dem Dach.
Das mag in heutigen Ohren wie eine traurige, entbehrungsreiche Jugend klingen, aber ich empfand es nicht so. Zum einen hatte ich noch eine zweite Familie, in die ich sozusagen ausweichen konnte, wenn es mir daheim zu eng wurde – die schon erwähnten Tante Anni und Onkel Leo.
Leo war so um 1920 herum, nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, aus Berlin gekommen, weil er dort keine Zukunft für sich gesehen hatte. Er fand in Recklinghausen auf der Zeche Arbeit und holte später seine Frau Anni nach. Die beiden wohnten zunächst in unserem Haus, sogar auf unserem Flur. Sie waren zwar kinderlos, aber trotzdem – oder gerade deswegen – war Tante Anni total besessen von Kindern.
Als ich 1938 geboren wurde, war die Situation in der Familie wegen der Abwesenheit meines Vaters nicht die allerbeste. Ich kann nicht einmal erahnen, wie meine Mutter in dieser Zeit über die Runden gekommen ist. Vielleicht konnte mein Bruder Felix ihr etwas Geld geben, ich weiß es nicht. Was ich aber weiß, ist dies: Vom ersten Moment an war ich so etwas wie ein Sohnersatz für Tante Anni, und sie nahm meiner Mutter viel Arbeit ab. Tante Anni, stürzte sich mit überbordender Liebe auf mich und war fortan meine zweite Mutter. Manchmal war sie sogar wichtiger für mich als meine leibliche.
Einige Zeit vor dem Ende des Krieges zogen Tante Anni und Onkel Leo zwar aus unserem Haus weg – aber buchstäblich nur ein paar Häuser weiter, in die Emscherstraße. Dort ging ich ein und aus, als wäre ich ihr eigener Sohn.
Zudem muss man sagen, dass meine Kindheit verhältnismäßig sorgenfrei war, denn es ging unserer Familie finanziell gut. Neben der einmaligen KZ-Entschädigungszahlung, von der wir uns den besagten wuchtigen Schrank kauften, bezog mein Vater eine Knappschaftsrente und bekam auch die sogenannte Opferpension. Die war von der Adenauer-Regierung für Menschen eingeführt worden, die unter dem Naziterror gelitten hatten.
Im Vergleich zu den anderen Familien auf der Leusbergstraße standen wir also gut da, denn die lebten ja ausschließlich vom Lohn des jeweiligen Vaters – der in vier von fünf Fällen ein einfacher Bergmann war. Irgendwie waren alle auf der Zeche. Damals gab es allein in Recklinghausen vier davon. Auch mein Vater hat immer zu mir gesagt: „Du gehst auf den Pütt.“ Das war kein Befehl, sondern eine Feststellung. Es war eben so auf dem Leusberg. Die Männer arbeiteten auf der Zeche, und die Söhne folgten ihnen. Aus zwei Gründen. Erstens war das ein sicherer Arbeitsplatz. Zweitens gab es Kohlen. Jeden Winter bekamen die Bergleute zwanzig Zentner Deputat-Kohlen. Damit war die Bude immer warm, damals keineswegs eine Selbstverständlichkeit.
Ich aber wollte nicht auf den Pütt. Ich weiß nicht, warum. Ich wollte es einfach nicht. Vielleicht war mir der körperliche Zustand, in dem sich mein Vater befand, eine Warnung. Jedenfalls war ich schon auf der Volksschule sehr ehrgeizig. Der Rektor Lübbert muss auch etwas in mir gesehen haben, denn ich bekam einige kleine Aufgaben. So verwaltete ich zum Beispiel die Schlüssel, und wenn es Bekanntmachungen gab, dann wurde ich mit einem Zettel durch die Klassen geschickt. Ja, man kann sagen, dass ich ein beflissener und ziemlich guter Schüler war. Das weckte in mir den Wunsch, etwas zu tun, was Jungs vom Leusberg eigentlich nicht taten. Ich wollte aufs Gymnasium gehen. Eine konkrete Berufsidee hatte ich dabei gar nicht, ich wollte einfach nur auf die höhere Schule.
Vielleicht störte es mich deswegen, dass meine Eltern sich untereinander auf Polnisch unterhielten. Dabei beherrschten sie die deutsche Sprache einwandfrei. Mein Vater sowieso, aber auch meine Mutter, die ja erst spät nach Deutschland gekommen war. Jedenfalls kann ich mich nicht erinnern, dass sie jemals einen Akzent gehabt hätte. Sie sprach genauso gut Deutsch wie alle Nachbarn. Trotzdem redete sie Polnisch mit meinem Vater. Das erboste mich immer, und ich sagte: „Ihr sollt nicht Polnisch sprechen!“ Es gab nämlich auch eine Zeit, in der wir gehänselt wurden. „Rot und blau, Pollacks Frau“, solche Sachen riefen die Kinder. Es war mir also höchst unangenehm, an meine polnische Herkunft erinnert zu werden. Heute bin ich stolz auf sie, und ich bedauere es außerordentlich, dass ich nicht mehr Polnisch spreche. Manchmal kommen einzelne Wortfetzen in meiner Erinnerung hoch, aber das ist leider alles.
Eine andere Auseinandersetzung mit meinen Eltern rückte in jener Zeit unaufhaltsam näher. Im Jahr 1952, als ich fast vierzehn war, endete für mich die Volksschule, wie damals üblich nach acht Schuljahren. Früher oder später musste eine Entscheidung über meine Zukunft fallen. So saßen wir schließlich an einem Tag im Frühjahr um den Küchentisch – meine Eltern, Zita und ich.
„Was ist denn nun mit dem Jungen, Stefan?“, sagte meine Mutter zu meinem Vater. „Der geht ja bald von der Marienschule ab. Was soll denn aus ihm werden?“
„Na, was wohl?“, erwiderte der Alte. „Der geht auf’n Pütt.“
„Nein“, rief ich, „das will ich aber nicht!“
Da ließ mein Vater Gabel und Messer fallen und blickte meine Schwester an. „Fahr in die Stadt!“, befahl er ihr mit richtig wütender Stimme. „Fahr in die Stadt und melde ihn beim Gymnasium an.“ Die Stadt, das war Recklinghausen. Wir wohnten ja in Recklinghausen Süd, wo die Malocher und Proleten lebten. In der Vorstellung meines Vaters war „die Stadt“ der Ort, wo Ärzte, Apotheker, Rechtsanwälte und Direktoren wohnten.
Die besagte Schule heißt heute Freiherr-vom-Stein-Gymnasium. Damals war es ein sogenanntes Aufbaugymnasium. Das bedeutete, dass es auf die Volksschule aufbaute und man dort nach sechs Jahren das Abitur machen konnte. Es gab auch noch die Gymnasien Hittorf und Petrinum in Recklinghausen, aber die kamen für mich nicht infrage. Denn auf sie hätte man schon nach der vierten Klasse wechseln müssen.
„Melde ihn an“, sagte mein Vater noch einmal zu Zita. „Dann muss er eine Prüfung machen – und die besteht er sowieso nicht.“ Er irrte sich. Ich bestand sie.
Das Wunder von Bern findet ohne mich statt
Etwas mehr als zwei Jahre nach diesem wichtigen Moment in meinem Leben lief ich mit meinem Freund Günther durch die Kneipe seiner Eltern. Das heißt, so richtig laufen konnten wir nicht, denn es war sehr voll. Günthers Vater hatte fast so etwas wie einen Altar aufgebaut. Da stand ein Tisch, auf ihm eine Konsole und darauf wiederum ein Fernseher. Und um den drängte sich nun nahezu die gesamte männliche Nachbarschaft. Der Fernseher war so wichtig, dass Günthers Vater von den Erwachsenen sogar 50 Pfennig Eintritt nehmen konnte, damit sie ihn anstarren durften.
Es war der 4. Juli 1954. Im Fernsehen lief das Endspiel um die Fußballweltmeisterschaft zwischen Ungarn und Deutschland. Gerne würde ich sagen können, dass ich gebannt vor dem Fernseher saß. Oder vielleicht noch besser: dass ich an diesem Sonntag vor dem Radio hockte und fasziniert der berühmtesten deutschen Fußballreportage lauschte, Herbert Zimmermanns atemlosem Bericht aus dem Berner Wankdorfstadion. Vielleicht sogar, dass diese Übertragung in mir den Wunsch weckte, mit meiner Stimme auch solche Bilder zu malen. Doch nichts dergleichen. Günther und ich würdigten den Fernseher keines Blickes. Fußball interessierte uns nicht. Selbst als die Männer alle schrien und uns erzählten, wir wären Weltmeister geworden, zuckten wir nur mit den Achseln. Na und?
Natürlich haben wir Jungs gepöhlt, als wir zehn, elf Jahre alt waren. Leusbergstraße gegen Neustraße, das waren kleine Feste für die Kinder der Nachbarschaft. Da wurde vorher sogar richtig trainiert, damit man sich gegen die anderen nicht blamierte! Gespielt wurde wirklich auf der Straße. Das war kein Problem, denn es gab in der ganzen Gegend nur ein einziges Auto, das gehörte dem Milchbauern. Der kam zweimal am Tag, und dann musste man kurz Pause machen. Aber sonst war die Straße frei. Es wurden zwei Tore durch Tornister markiert, und los ging’s.
Das Dumme war bloß: Ich durfte nie mitspielen. Ich war zwar schnell, aber ich hatte überhaupt kein Ballgefühl und fiel gerne mal über meine eigenen Beine beim Versuch, einen Pass zu spielen. Wenn Nawrath und Limbach, die beiden Stars unserer Straße, ihre Mannschaften wählten – „Ich nehm’ den“, „Dann nehm’ ich den“ –, blieb ich immer übrig. Beim Spiel stand ich hinter dem Tor und musste die selbstgebastelten Bälle wiederholen, wenn jemand vorbeigeschossen hatte. Das war nicht schön, und wahrscheinlich hat es mir den Zugang zum Spiel etwas verbaut. Die Tatsache, dass ich die Namen Nawrath und Limbach auch sieben Jahrzehnte später noch parat habe, spricht Bände.
Später gab es bei uns mal so einen DJK-Verein, die katholische Deutsche Jugendkraft, und einer in dem Klub hatte die Idee, dass man meine Schnelligkeit gebrauchen könnte. Ich habe dann einoder zweimal auf der Außenbahn gespielt, aber es war fürchterlich. Fußball war nichts für mich. Das Spiel ging mir gepflegt am Allerwertesten vorbei.
Wie schon angedeutet, konnte ich aber sehr gut laufen. Auf der Penne war ich ein relativ guter Leichtathlet und trat dann 1953 auch Viktoria Recklinghausen bei. Ich glaube, ich hätte durchaus einiges erreichen können, wenn wir damals professionelles Training gehabt hätten. Aber wir besaßen ja noch nicht einmal Spikes. Der Trainer betrieb eine Lotto-Annahmestelle und kümmerte sich nur so nebenbei um uns. Von Süd waren es gut sechs Kilometer bis in die Stadt, zum Verein. Ich fuhr mit dem Fahrrad, und am Schluss ging es nur noch bergauf. Da kam ich oft schon halbtot beim Training an.
So stümperhaft das Training auch war, ich habe den Sport mit Leidenschaft betrieben. Ich war ein so großer Leichtathletikfan, wie man heute sagen würde, dass ich sogar zu den Länderkämpfen gefahren bin, die es damals noch gab und die meistens in Düsseldorf stattfanden. Es war die große Zeit der Leichtathletik, denn seinerzeit war der Fußball noch nicht die alleinherrschende sportliche Macht. Ich habe Herbert Schade gesehen, den schmächtigen Langstreckler aus Solingen, oder Karl-Friedrich Haas. 400-Meter-Läufer wie er waren so ein bisschen meine Idole. Aber Fußballer? Nein, nicht einmal die Helden von Bern.
Trotzdem ist mir der Tag des Endspiels noch gut in Erinnerung. Es war nämlich einer der letzten, in denen unsere kleine Welt – vom dritten Stock bis zur Kneipe unten – noch in Ordnung war. Denn schon im folgenden Jahr, also 1955, gab es den schweren Unfall. Meine Schwester Zita war mit den Wirtsleuten, Günthers Eltern, in deren Wagen unterwegs auf dem Ruhrschnellweg, heute die A 40. Ungefähr auf der Höhe von Dortmund-Hombruch verlor ein stark angetrunkener Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit dem Wagen der Wirtsleute.
Günthers Mutter war auf der Stelle tot. Ihr Mann und meine Schwester wurden schwerverletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Zita hatte bei dem Unfall einen Beckenbruch erlitten, der dann leider nicht nach allen Regeln der modernen ärztlichen Kunst behandelt wurde. Beim Eingipsen muss etwas schiefgelaufen sein, jedenfalls wuchs ihr Becken nicht wieder sauber zusammen. Fortan hinkte sie leicht. Aber immerhin überlebte sie – Günthers Vater tat es nicht. Zwei Wochen nach dem Unfall starb er im Krankenhaus an einer Fettembolie, also dem Verschluss eines Blutgefäßes durch kleine Tröpfchen Körperfett.
Auf einmal stand Günther ohne Eltern da und war im Alter von gerade mal siebzehn Jahren zum Besitzer einer Kneipe und eines großen Mietshauses geworden. Er hat versucht, die Kneipe weiterzuführen, aber nach und nach ging alles den Bach runter. Er fing an zu trinken, dann kamen komplizierte Weibergeschichten dazu. Schließlich setzte ihm jemand einen Floh ins Ohr und schwatzte ihm eine Hühnerfarm auf.
Das klingt heute abwegiger, als es damals war. Eine Zeit lang, in der zweiten Hälfte der 1950er, war das eine beliebte Geschäftsidee. Man konnte Geld verdienen mit den Eiern der Hühner und ihrem Fleisch, vor allem, wenn man viele hatte. Und Günther hatte viele. Zweitausend! Leider hatte Günther keine Ahnung von Hühnern und auch keine Disziplin. Er blieb oft nächtelang weg, wegen Alkohol oder Frauen oder beidem, und viele Hühner verendeten elendig. Bald beschwerten sich die Nachbarn wegen des Gestanks, und die Stadt schloss die Hühnerfarm. Es war ein finanzielles Fiasko für Günther, nicht das letzte. Am Schluss war er pleite, und das Haus wurde zwangsversteigert. Was aus ihm wurde? Keine Ahnung, er ist spurlos verschwunden.
Der erste „Leusbub“ macht Abitur
Der Kontakt zu Günther riss auch deshalb ab, weil ich Recklinghausen 1958 verließ. Und zwar, man glaubt es nicht, zum Studium. Jawohl: Werner Hansch, der Sohns eines „Püttologen“ vom Leusberg, schaffte nicht nur sein Abitur, sondern ging auch noch zur Universität!
Ich liebte die Zeit auf dem Gymnasium. Im Grunde war diese Schule wie eine Heimat für mich, und ich ging unglaublich gerne hin. Es war auch keineswegs so, wie mein Vater befürchtet hatte, dass dort nur die Kinder der feinen Leute waren. Im Gegenteil, da es sich um ein Aufbaugymnasium handelte, kamen viele Schüler aus der Mittelschicht und aus einfachen Familien. Spätberufene wie ich, die nicht von Anfang an damit gerechnet hatten, das Abitur machen zu können.
Allerdings musste man in den ersten Jahren Schulgeld zahlen. Ich weiß noch, dass wir einmal im Monat klassenweise rauf ins Sekretariat gingen, um dort in bar zu bezahlen. So gesehen hatte ich Glück, dass mein Vater sich das erlauben konnte – und dass er auch bereit war, es zu tun.
Unser Gymnasium hatte einen sehr guten Ruf, hinter dem Petrinum mussten wir uns ganz sicher nicht verstecken, was Angebot, Anforderung und Qualität betraf. Und recht schnell entdeckte ich auf der Schule, was ich mit meinem Leben machen wollte. Ich entwickelte nämlich ein großes Faible für Geschichte. Ich weiß nicht, woher das kam, aber ich habe Bücher über Geschichte nur so gefressen.
Ab der Obersekunda, heute würde man sagen: der 11. Klasse, war der Direktor der Schule auch mein Geschichtslehrer. Es passierte nicht selten, dass ich im Unterricht aufstand und sagte: „Entschuldigen Sie bitte, Herr Fürstenau, aber ich glaube, diese Entwicklung hatte mit etwas ganz anderem zu tun.“ Das führte dann meistens zu lebhaften Diskussionen zwischen uns beiden. Er nahm es mir nicht übel, in meinem Abiturzeugnis erhielt ich in Geschichte die Note eins. Es war übrigens ein sehr gutes Zeugnis, und ich war der erste Junge von der Leusbergstraße, der nach dem Krieg Abitur machte. Ich erwähne das, weil ich fest davon überzeugt bin, dass auch viele meiner Kameraden ein mindestens ebenso gutes Abi wie ich gemacht hätten – wenn sie nicht auf den Pütt geschickt worden wären. Und ich erwähne es, weil ich glaube, dass mein Vater in diesem Augenblick stolz auf mich war. Gesagt hat er es natürlich nicht.
Was aber sollte nach dem Abi kommen? Ich kannte zu jener Zeit die Namen aller deutschen Botschafter in den wichtigsten Städten der Welt auswendig. Das war ein Thema, das mich völlig faszinierte. Vier Wochen vor dem Abitur veranstaltete dann der Rotary Club in Recklinghausen eine Art Berufsberatung, und ich wurde mit einigen anderen Schülern zu einem Rechtsanwalt geschickt, der über seinen Beruf berichtete. Als ich an die Reihe kam, sagte er zu mir: „Was zieht Sie denn in die Juristerei, was könnte Ihr Schwerpunkt sein?“ Ich entgegnete: „Also, eigentlich möchte ich ja in den diplomatischen Dienst.“ Da leuchteten seine Augen, und er war auf einmal sehr interessiert. Er wollte wissen, woher mein Interesse dafür kam. Ich erzählte ihm, dass ich es mir toll vorstellte, ins Ausland zu gehen und Botschafter zu sein. „Da sind Sie bei mir genau richtig!“, sagte der Anwalt. „Ich kann Ihnen auch sagen, was Sie tun sollten. Studieren Sie Jura und verbinden Sie das mit Neuerer Geschichte, dann sind Sie gut gerüstet.“ Er setzte erklärend hinzu: „Bei der Aufnahmeprüfung, die man machen muss, wenn man in den Auswärtigen Dienst will, geht es viel um Verfassungsrecht. Außerdem fragen die immer nach geschichtlichen Dingen. Mit einem Jura- und Geschichtsstudium sind Sie da bestens ausgerüstet.“
Ich folgte seinem Rat und schrieb mich für Juristerei und Moderne Geschichte an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster ein. Und so verließ ich im Sommer 1958 für immer, das dachte ich jedenfalls, die kleine Wohnung in der Leusbergstraße und nahm mir im 60 Kilometer entfernten Münster meine erste eigene Bude. Ich war voller Vorfreude. Was ich dem Rechtsanwalt vom Rotary Club nicht gesagt hatte, war nämlich, dass mich am Diplomatendasein auch der Status eines solchen Berufes reizte. Der polnische Vater auf’m Pütt, der Sohn im Auswärtigen Dienst der Bundesrepublik Deutschland! So jedenfalls lautete der Plan.