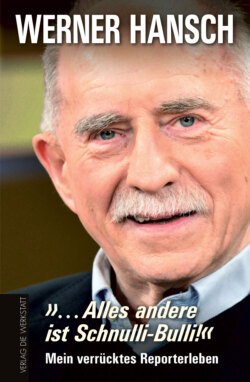Читать книгу '… Alles andere ist Schnulli-Bulli!' - Werner Hansch - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеBildungsprozesse
Wer den Tod nicht scheut, fährt Lloyd
In meinem Studentenleben – oder besser: in dem ersten meiner insgesamt drei Leben als Student – lief zunächst alles glatt. Ich fand schnell eine Bleibe, die ich mir mit einem Schulfreund teilte. Finanzielle Sorgen musste ich mir nicht machen, da mein Vater mich unterstützte. Ich bekam zudem eine gewisse Förderung durch das Honnefer Modell, einen BAföG-Vorläufer. Und was das Studieren selbst angeht, so war ich mit Hingabe und Akribie bei der Sache.
Der besagte Schulfreund hieß Jochen Richter. Er wollte eigentlich Pilot werden und hatte sich in Bremen beworben, bei der Pilotenausbildung der Lufthansa. Er wusste aber nicht, ob er dort zur Prüfung zugelassen würde, also schrieb er sich sicherheitshalber auch in Münster ein, für Deutsch und Englisch.
Jochens Vater war Polizist in Datteln und besaß eines jener Autos, die man damals als „Plastikbomber“ bezeichnete, einen Lloyd 300. Innen war alles aus Kunststoff, daher der Name. Diesen Wagen lieh er uns in den Ferien nach dem ersten Semester, damit wir in den Zelturlaub fahren konnten – quer durch Italien, bis nach Neapel. Das heißt, Jochen fuhr, denn ich hatte noch keinen Führerschein.
Der Wagen war bis unters Dach vollgepackt mit Konserven, Geschirr, Klamotten. Wir konnten uns buchstäblich kaum bewegen in dem Ding, so eng war es. Aber lange fuhren wir sowieso nicht. Denn in der Nähe von Stuttgart machte es plötzlich Klingeling, der Wagen rollte aus, und nichts ging mehr. Wir öffneten die Motorhaube, konnten aber keinen Fehler finden. Als der ADAC schließlich eintraf, warf der Mechaniker nur einen kurzen Blick auf das Auto und sagte: „Friede seiner Asche. Da muss ein neuer Motor her.“ Die Pleuelstange war gebrochen.
Der ADAC schleppte den Wagen in die nächste Werkstatt. Dort war kein Lloyd-Motor vorrätig, also mussten wir zwei Tage warten, bis aus Bremen, dem Sitz der Firma, einer eintraf. Der Motor und sein Einbau waren nicht billig, deswegen war ich der Meinung, wir sollten umkehren und den Urlaub abbrechen. Jochen aber sah das anders, also reisten wir weiter. Wenn man das „reisen“ nennen kann. Denn damals musste man neue Motoren noch einfahren – und zwar ganz langsam und sachte. Also tuckerten wir in einem völlig überladenen Plastikbomber im Schneckentempo über die Alpen.
Irgendwann hatten wir es endlich geschafft, kamen runter nach Italien, fuhren an Mailand vorbei und fanden einen Campingplatz bei La Spezia, an der Italienischen Riviera. Wir schlugen unser Zelt auf und verbrachten ein paar schöne Tage am Strand des Mittelmeeres. Ganz in der Nähe war ein gutes Restaurant mit einem schönen Garten. Am Wochenende gab es dort Livemusik, damit die Leute tanzen konnten. Jochen und ich schlenderten also am Samstag hin, um uns das mal anzusehen. Plötzlich ging die Tür auf, und wer oder was kam rein? Eine ganze Busladung junger, bildhübscher Schwedinnen! Wir zwei machten natürlich große Augen und waren ganz begeistert. Es dauerte aber keine halbe Stunde, da konnte man die Mädchen gar nicht mehr sehen. Denn in einem weiten Halbkreis standen lauter junge Italiener um sie herum, alle mit offenen weißen Hemden und schwarzen Haaren (auf dem Kopf und auch auf der Brust). Da hatten Jochen und ich natürlich nichts mehr zu melden. Wir schlichen als verhinderte Casanovas zurück zum Campingplatz, während links und rechts der Straße die Pärchen im Gras lagen.
Bald darauf brachen wir auf und machten uns auf den Weg nach Neapel. Wir wollten in Etappen fahren, so etwa 200 Kilometer pro Tag hatten wir uns vorgenommen. Wieder kamen wir nicht weit. Hinter uns im Wagen klapperte etwas, vielleicht das Schloss einer geöffneten Aktentasche. Anstatt mich zu bitten, mal nachzusehen, drehte sich Jochen selbst um und verriss dabei das Lenkrad. Plötzlich stand sie im Weg – die dicke Palme, die für einen kleinen Plastikbomber viel zu mächtig war. Ich schlug mit dem Kopf durch die Scheibe und zerschnitt mir das Gesicht. Jochen zog sich nur eine leichte Prellung zu. Zum Glück passierte uns nichts Schlimmes. Ein damals oft gehörter Spruch besagte nämlich „Wer den Tod nicht scheut, fährt Lloyd“.
Gegenüber der Unfallstelle war ein Friseursalon. Binnen Minuten waren wir von aufgeregten Italienern umringt. „Mamma mia!“, riefen sie und holten mich in den Laden, wo sie mir das Gesicht säuberten und mich von den Glassplittern befreiten. Als ich wieder vor die Tür trat, sah ich, wen von uns dreien es am schlimmsten erwischt hatte: den Lloyd. Totalschaden. Zerknirscht rief Jochen seinen Vater an und gestand ihm, dass wir gerade sein Heiligtum, den schönen Plastikbomber, zu Schrott gefahren hatten. Man kann sich vorstellen, wie der Polizist daheim in Datteln tobte.
Aber was sollten wir nun tun? „Komm, lass das Ding hier einfach stehen“, sagte ich. „Wir nehmen unsere Koffer raus und fahren mit dem Zug nach Hause.“ Doch das konnten wir natürlich nicht machen. Also schleppten wir den Lloyd in eine Werkstatt. Und hatten Glück. Der Meister war ein sehr netter Mann und dazu noch äußerst pfiffig. Er hatte in seinem ganzen Leben noch keinen Plastikbomber gesehen, aber nachdem er sich den Wagen genau angeschaut hatte, meinte er, man könnte das Auto wiederbeleben, und bestellte in Mailand eine Reihe von Ersatzteilen. Auf die mussten wir allerdings eine Woche lang warten.
Während dieser Zeit schauten wir jeden Tag in der Werkstatt vorbei. Wie sich herausstellte, frönte der Meister einem herrlichen Hobby: Hinter seiner Werkstatt hatte er einen eigenen kleinen Weinberg. Er lud uns zu mehr als nur einem Umtrunk ein, und als die Ersatzteile aus Mailand endlich eintrafen, pflegten wir schon ein herzliches, fast freundschaftliches Verhältnis zu dem Mann. Er stellte uns am Ende sogar eine doppelte Rechnung aus, damit Jochens Vater aus dem Schneider war und die Kosten von der Versicherung übernommen wurden. Allerdings sind wir nicht weiter nach Neapel gefahren. Wir wollten unser Glück nicht überstrapazieren, sondern machten uns sogleich auf den Rückweg, zurück über die Alpen und wieder recht langsam. Denn nach dem Unfall schlossen die Türen nicht mehr richtig, und wir mussten sie von innen mit einem Strick zuhalten, damit sie uns bei dem Wind in den Bergen nicht um die Ohren flogen.
Kurz nach unserer Rückkehr bekam Jochen den Bescheid aus Bremen, dass er zur Prüfung zugelassen war. Er ist dann in der Tat, wie er es von Anfang an geplant hatte, Pilot bei der Lufthansa geworden und flog um die ganze Welt. Leider schlief der Kontakt zu ihm irgendwann ein. Jochen ist also der nächste wirklich gute Freund, von dem ich nicht weiß, wo er heute ist und wie es ihm geht.
Eine neue Welt in Berlin
Damals war es üblich, während seines Studiums zumindest einmal die Uni zu wechseln, um nicht so eingleisig durchs Leben zu fahren. Ein ehemaliger Schulkollege von mir studierte zu jener Zeit schon seit einigen Jahren in Berlin und schwärmte in den höchsten Tönen von dieser Stadt. Also entschloss ich mich nach dem Ende des zweiten Semesters, für ein Jahr an die Freie Universität Berlin zu gehen.
An einem Samstag im Herbst 1959 kam ich mit einem kleinen braunen Pappkoffer und einem Persilkarton, der durch einen Strick zusammengehalten wurde, in Berlin am Bahnhof Zoo an. Ich hatte weder eine Unterkunft noch irgendeinen Kontakt, denn die Adresse meines Schulkollegen kannte ich nicht. Ich trat aus dem Bahnhofsgebäude ins Freie und bekam einen Schreck, an den ich mich noch heute genau erinnern kann. Diese riesigen Häuser! Diese gigantischen Straßen! Ich kannte ja nur Recklinghausen und Münster, nun fühlte ich mich, als wäre ich in eine Betonschlucht gestürzt.
Ich stolperte in die erste U-Bahn-Station, die ich sah, und setzte mich in den nächstbesten Zug. Er fuhr zufällig nach Charlottenburg. Wie betäubt saß ich in der Bahn und ließ mich ziellos durch Berlin treiben. Irgendwann blickte ich auf die Uhr und stellte fest, dass es schon später Mittag war. Kohldampf hatte ich auch. Und es half ja nichts – ich konnte nicht den Rest meines Lebens in dieser U-Bahn sitzen bleiben. Also entschloss ich mich, an der nächsten Station auszusteigen und ein Lokal zu suchen, in dem ich etwas essen konnte.
Die Haltestelle hieß Sophie-Charlotte-Platz. Ich irrte die Straße entlang, bis ich eine Kneipe sah, das „Zille-Eck“. Ich muss einen ziemlich bedröppelten Eindruck gemacht haben, als ich mir eine Bockwurst mit Kartoffelsalat bestellte und mich an einen Tisch setzte. Denn einer der Thekengäste blieb auf dem Weg zur Toilette neben mir stehen.
„Na, junger Mann“, berlinerte er. „Se kieken aber nicht so fröhlich aus der Wäsche, wa?“
„Nein, es geht mir auch nicht gut“, erwiderte ich. „Ich bin gerade in Berlin angekommen, um zu studieren. Aber ich habe nicht mal ein Zimmer.“
„Uiuiui“, sagte er. „Na, dann wird’s aber Zeit.“ Und damit ging er weiter.
Es dauerte kaum zehn Minuten, ich hatte meine Wurst gerade auf, da stand er mit einem Zettel wieder vor mir. „Jehn Se ma vorbei“, sagte er und deutete auf eine hingekritzelte Adresse. „Könn Se ma fragen. Vielleicht nehm se Se.“
Mit dem ersten „se“ war eine Familie Kasüschke gemeint, die ursprünglich aus Breslau stammte, wie alle guten Berliner. Ihre Wohnung lag nur 300 Meter entfernt, im zweiten Stock eines typischen Berliner Altbaus. Ich klingelte, die Tür öffnete sich einen Spaltbreit, und eine Frau musterte mich misstrauisch. Ich erklärte stockend, worum es ging und zeigte ihr den Zettel. Da murmelte sie: „Na, komm Se ma rin.“ Ein paar Augenblicke später saß ich auf der Wohnzimmercouch, eine halbe Stunde danach kannte ich die komplette Familienhistorie einschließlich aller Krankengeschichten. Zwischendrin sagte die Frau zu meiner großen Erleichterung: „Se könn natürlich bleeben.“ Die Familie hatte ein Zimmer, das nicht benutzt wurde. Das könnte ich beziehen, sagte Frau Kasüschke. Wie sich herausstellte, war der Kneipengast, der mir den Zettel in die Hand gedrückt hatte, ihr Ehemann.
Zwei Tage später, am Montag, fuhr ich raus nach Dahlem, um mich einzuschreiben. Und da sah ich tatsächlich vier, fünf vertraute Gesichter – Studenten, die ich aus Münster kannte und die wie ich vorübergehend die Uni gewechselt hatten. Wir bildeten schnell eine kleine Münsteraner Fraktion in Berlin und unternahmen viel zusammen. Das sollte für mein späteres Leben noch wichtig werden, wenn auch nur auf einer ganz persönlichen Ebene.
Es passierte, wie immer, aus Zufall. Einige Monate nach meiner Ankunft, irgendwann im Sommer, traf ich einen dieser Kameraden. Er sagte: „Hör mal, wir wollen heute Nachmittag nach Ostberlin. Komm doch mit.“
„Nein, das geht nicht“, antwortete ich. „Nächste Woche ist Klausur in Strafprozessordnung, dafür muss ich ein bisschen was machen.“
„Schade“, meinte er. „Wir wollen in die Oper.“
Da musste ich laut lachen. „In die Oper? Na, das ist sowieso nichts für mich.“
„Aber das ist doch nur Beiwerk“, sagte er. „Wir gehen da nur hin, um zu tauschen. Am Bahnhof Friedrichstraße, zum Kurs von eins zu sieben!“ Damals stand die Mauer ja noch nicht, und man konnte problemlos vom Westteil der Stadt in den Osten fahren. „Wenn wir getauscht haben“, fuhr mein Kommilitone fort, „gehen wir in die Oper, es kostet nur 20 Pfennig Eintritt, Westgeld. Aber wir gehen natürlich nicht wegen der Musik dorthin, sondern weil man da Kaviar essen und Krimsekt saufen kann!“
„In der Oper?“, fragte ich entgeistert.
„Ja klar“, sagte er. „Nur das allerbeste Zeug, für ganz kleines Geld.“
Das wollte ich mit eigenen Augen sehen, daher änderte ich meinen Plan und fuhr mit den anderen Münsteranern in den Osten. Erst tauschten wir Geld, dann gingen wir die paar Hundert Meter zur Komischen Oper und kauften Karten. Gleich danach eilten wir zum Buffet. Es war alles haargenau so, wie mein Kommilitone gesagt hatte. Vor uns war roter und schwarzer Kaviar ausgebreitet – und die Getränke waren auch nicht zu verachten. Ich muss vom Sekt schon etwas beschwipst gewesen sein, als mir einfiel, dass ich ja eine gültige Opernkarte in der Tasche hatte. War es die Neugier? War es die Aussicht, in einem bequemen Sessel gemütlich zu verdauen? Ich weiß es nicht mehr genau, jedenfalls beschloss ich, mich in die Loge zu setzen, für die ich eine Karte hatte.
Gespielt wurde Der Rosenkavalier, inszeniert von der Regielegende Walter Felsenstein. Ich hörte die wundervolle Walzermusik, komponiert von Richard Strauss, und war sofort gefesselt. Es mag seltsam klingen, aber dies war ein ganz zentraler Moment meines Lebens. Plötzlich machte es, wie man sagt, „Klick“. An diesem Tag öffnete sich für mich ein Tor, und dahinter tat sich eine völlig neue Welt auf. Ich trat hindurch und bin seitdem ein großer Liebhaber der klassischen Musik. Richard Strauss steht bis heute ganz oben bei mir. Die Walzersuite aus dem Rosenkavalier ist noch immer eine Pflichtnummer, wenn ich etwas brauche, das mich aufbaut.
Übrigens bekam diese Geschichte noch eine späte, kleine Pointe. Fast ein halbes Jahrhundert nach jenem Tag, im Januar 2006, erhielt ich einen Anruf. Die Stimme am anderen Ende sagte: „Hallo, mein Name ist Olaf Fischer. Ich bin der Künstlerische Leiter der Komischen Oper in Berlin.“
„Da müssen Sie falsch verbunden sein“, erwiderte ich. „Ich bin von Beruf Sportreporter.“
„Das weiß ich“, sagte Fischer. „Genau deswegen rufe ich ja an.“
Er stellte mir dann ein Projekt vor, das zur Fußball-WM im Sommer stattfinden sollte, ein sogenanntes Fußball-Oratorium mit dem Titel Die Tiefe des Raumes. Erzählt und besungen wurde der Aufstieg eines Spielers von den Anfängen bis zur Nationalmannschaft. Komponiert hatte das Stück der Frankfurter Moritz Eggert, die Texte stammten von Michael Klaus aus Gelsenkirchen. Es war 2005 bei der Ruhrtriennale in der Bochumer Jahrhunderthalle uraufgeführt worden. Nun nahm die Komische Oper dieses Musikwerk wegen der anstehenden WM in Deutschland in ihr Programm auf.
Im Prinzip handelte es sich um eine Oper mit großem Orchester, großem Chor, vier Solostimmen und drei Sprechrollen. Bei der Aufführung in Bochum hatte der Intendant Jürgen Flimm diese Sprechrollen – ein Trainer, ein Spieler, ein Reporter – mit drei Schauspielern besetzt. Die Berliner wollten aber eine möglichst originalgetreue Besetzung. So ganz original ging es nicht, daher gab Schauspieler Peter Lohmeyer den Trainer. Der Spieler war der ehemalige Profitorwart Lars Leese, über den Ronald Reng ein schönes Buch geschrieben hat. Und der Reporter sollte ich sein.
Während Fischer mir die ganze Sache am Telefon erklärte, stiegen in meinem Hinterkopf Bilder hoch. Ich sah mich im Berlin des Jahres 1960 in der Loge sitzen und zum ersten Mal den Rosenkavalier genießen. „Herr Fischer, Sie können aufhören“, unterbrach ich ihn. „Ich mache das.“
Und so betrat ich im Juni 2006 selbst die Bühne der Komischen Oper in Berlin. Drei Tage haben wir intensiv geprobt, denn unsere Rollen erforderten gutes Timing. Wir saßen auf der großen Bühne, etwas am Rand, hinter uns waren die Sänger. Es war aber nahezu unmöglich, den Einsatz präzise herauszuhören, deswegen hatte man einen sogenannten Subregisseur in die erste Reihe platziert. Wenn ein Einsatz nahte, hob er langsam seinen Finger und zeigte dann im richtigen Moment auf einen von uns dreien. Das Ganze hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber nach vier Vorstellungen war es leider vorbei, denn auch die schönste WM geht mal zu Ende.
Waise mit Anfang zwanzig
Nach zwei Semestern in Berlin kehrte ich zurück nach Münster, noch immer guter Dinge und fest entschlossen, mein Studium durchzuziehen. Wie motiviert ich weiterhin war, kann man vielleicht daran sehen, dass ich Anfang März 1961, kurz vor dem Ende des fünften Semesters, nach Vlotho fuhr, weil dort ein Lehrgang für politische Bildung stattfand.
Wir hörten gerade einen Vortrag, als sich die Tür leise öffnete und eine Sekretärin in den Raum trat. Unsere Köpfe drehten sich fragend zu ihr um. Sie sagte: „Herr Hansch möchte bitte mal raus auf den Flur kommen.“ Sie hatte den Satz noch nicht beendet, da wusste ich schon, worum es ging. Draußen sagte sie mir, dass mein Vater gestorben war; ich nickte nur stumm. Ich hatte damit rechnen müssen. Er war 70 Jahre alt und hatte mindestens die letzten fünfzehn davon komplett arbeitsunfähig mit einer anerkannt hundertprozentigen Steinstaublunge gelebt. Er war regelrecht eingetrocknet. Am 4. März starb er in seiner Wohnung in der Leusbergstraße, im Grunde an Erstickung. Wer weiß, vielleicht saß er in seinem Sessel und blickte gerade in die Ferne.
Der Tod meines Vaters war also keine Überraschung. Dass meine Mutter ihm weniger als sieben Wochen später folgte, traf mich dagegen völlig unvorbereitet. Ich kam damals an den Wochenenden immer nach Hause und fuhr montags zurück nach Münster. An einem frühen Montagmorgen Mitte April lag ich noch im Bett, als ich aus der Küche einen dumpfen Knall vernahm. Ich sprang auf und sah meine Mutter am Boden liegen. Ich trug sie ins Bett und lief nach unten in die Gaststätte, denn dort befand sich das einzige Telefon im ganzen Haus. Ich rief unseren Hausarzt Dr. Steinberg an. Er stellte einen Schlaganfall fest und ließ meine Mutter ins Krankenhaus bringen.
Ich war jung und hatte keine genaue Vorstellung davon, was diese Diagnose bedeutete. Am nächsten Tag besuchte ich meine Mutter im Krankenhaus und hatte das Gefühl, dass sie auf dem Weg der Besserung war. Ihr Mund stand nicht mehr so schief wie am Tag zuvor, und man konnte sich sogar mit ihr unterhalten. „Das wird bald wieder“, sagte ich zu ihr. Pustekuchen. Als ich am folgenden Vormittag ins Krankenhaus kam, eilte mir eine Schwester entgegen, um mir zu sagen, dass meine Mutter im Koma lag.
Ich stand erst ein paar Augenblicke an ihrem Bett, als drei große Gestalten in weißen Kitteln ins Zimmer traten. Es waren die Chefärzte der Chirurgie, Neurologie und Inneren Medizin. „Herr Hansch“, sagte die Schwester, „Sie müssen jetzt mal rausgehen.“ Ich trat vor die Tür auf den Flur und wartete. Nach einer Viertelstunde kamen die drei wieder raus und schritten den Gang hinab. Plötzlich blieben sie stehen. Sie tuschelten einen Augenblick, dann drehte sich einer von ihnen um und kam auf mich zu. „Ich nehme an, Sie sind der Sohn“, sagte er. „Es sieht nicht gut aus. Sie hat heute Nacht einen zweiten Schlaganfall erlitten, der sehr heftig ist. Ebenso schlimm ist, dass sie eine Thrombose im linken Bein hat. Wir können das nicht operieren. Wir müssten also das Bein amputieren, aber das wird sie in ihrem Zustand nicht überleben.“ Er nahm meine Hand und drückte sie. „Es tut uns leid“, sagte er und ging.
Meine Mutter starb am nächsten Tag, dem 20. April, im Alter von 64 Jahren. Ich stand wie unter Schock. Ich weiß noch, wie ich in die zwei offenen Gräber starrte und beide Male nicht einmal weinen konnte. Mir war sofort klar, dass die zwei kleinen Zimmer in der Leusbergstraße nun wieder mein Zuhause sein würden, zumindest bis alle Formalitäten erledigt waren. Dort lebte auch noch meine Schwester Zita, noch immer unter dem Dach. Sie war allerdings inzwischen – endlich, möchte ich fast sagen – eine richtige Beziehung eingegangen und hatte mit Ende dreißig sogar geheiratet. Kurz nach der Beerdigung meiner Mutter ging ich zurück nach Münster, in der festen Absicht, das Studium zu beenden. Zita blieb zunächst in der Leusbergstraße wohnen. Erst mehrere Jahre später zog sie zusammen mit ihrem Mann in eine kleine Wohnung in der Bochumer Straße, gar nicht weit weg von unserem Elternhaus. Alfred arbeitete als Altgeselle in einer großen Recklinghäuser Metzgerei, daher war der Kühlschrank der beiden immer voll. Anfangs hatte ich Zitas Verbindung mit Alfred durchaus skeptisch gesehen. Alfred ging gern mal in die Kneipe und zwitscherte einen. Doch Zita hing an ihm, und er war sozusagen ihre letzte Chance, ein wenig kleinbürgerliches Glück zu erleben. Meine Bedenken schwanden auch bald. Die zwei führten eine wunderbare Ehe. Alfred trank so gut wie gar nicht mehr und war wirklich eine Seele von Mensch. Die beiden konnten sich sogar ein kleines Auto leisten, mit dem sie manchmal ins Münsterland fuhren. Leider dauerte ihr Glück nur etwa zehn Jahre. Dann bekam Alfred mitten in der Wurstküche einen Herzanfall und fiel tot um.
Bis heute jammert mich Zitas Schicksal, und es gibt mir immer einen kleinen Stich ins Herz, wenn ich über sie spreche oder schreibe. Sie hatte kein einfaches Leben, und ich möchte behaupten, dass die Jahre mit Alfred die einzigen waren, in denen sie wirklich glücklich war. Sie weigerte sich, ihre kaputte Hüfte noch einmal operieren zu lassen, und ihre Verfassung verschlimmerte sich zusehends. Schließlich ging sie stark gebeugt, wie ein halbaufgeklapptes Taschenmesser. Weil sie in ihrer Wohnung immer wieder stürzte und vom Notarzt ins Krankenhaus gebracht werden musste, kam sie schließlich in ein Pflegeheim. Sie blieb dort zehn Jahre lang. Die letzten fünf davon verbrachte sie nur noch im Bett liegend, dement und blind.
Jobberei, Ehe und ein neues Studium
Der Tod meiner Eltern war ein größerer Schlag für mich, als ich mir damals eingestehen wollte, und in gewisser Weise begann damit ein für mich dunkles – oder zumindest sehr schwieriges – Jahrzehnt. Ich konnte nicht richtig trauern, hatte zuerst keine Zeit, das Geschehene zu verarbeiten. Aber man kann vor so etwas nicht weglaufen. Es holte mich immer wieder ein. Diese psychische Belastung war sicherlich ein Grund, warum ich das Studium schließlich abbrach.
Es gab aber auch rein materielle Gründe. Nach dem Tod meines Vaters hatte ich einen Anspruch auf Knappschafts-Kinderrente, man könnte es auch Waisenrente nennen. Aber es dauerte mehr als ein halbes Jahr, bis deren Höhe errechnet wurde. Bis dahin musste ich regelmäßig beim Studentenwerk vorstellig werden, meine Lage erklären und um einen Vorschuss auf die erwarteten Zahlungen von der Knappschaft bitten. Ich bekam dann jedes Mal etwas Geld. (Das ich natürlich später zurückzahlte.) Das ging vielleicht zwei Monate so, dann hing es mir zum Hals raus, betteln zu müssen. Ich musste etwas finden, von dem ich leben konnte. Die Waisenrente – sie betrug am Ende knapp 125 Mark im Monat – reichte dafür nicht aus. Und so schmiss ich im sechsten Semester mein Studium und ging wieder zurück nach Recklinghausen, um mir Jobs zu suchen.
Die folgenden knapp drei Jahre sehe ich in der Rückschau wie durch einen Nebel. Ich arbeitete mal hier, mal dort – was man halt so machen kann, wenn man keine Ausbildung hat: Tiefbau, Hochbau, Handlanger auf Baustellen. Maloche, wie man im Ruhrgebiet sagt. Mal wohnte ich bei meiner Schwester – also wieder zurück in der Leusbergstraße, von der ich doch glaubte, ich hätte sie hinter mir gelassen, um im diplomatischen Korps durch die weite Welt zu reisen – und eine Zeit auch bei Tante Anni und Onkel Leo. Anders gesagt, ich war in die erste von zwei Lebenskrisen geschlittert, die dieses Jahrzehnt für mich bereithalten sollte.
Es half mir ganz ohne Frage, dass ich nicht alleine war. Wenige Monate vor dem Tod meiner Eltern hatte ich ein sehr hübsches, nettes Mädchen namens Ingrid kennengelernt. Ich war mit einem ehemaligen Klassenkameraden zum Silvesterball nach Herne gefahren, ins Café Central. Sie war auch dort, mit einer Freundin. Wir haben zusammen getanzt, und weil sie ebenfalls aus Recklinghausen Süd stammte, brachte ich sie später, in der Neujahrsnacht, nach Hause. Es entwickelte sich das, was manchmal aus solchen zufälligen Treffen entsteht. Knapp vier Jahre später heirateten wir.
Ingrid kam aus einem gutbürgerlichen Geschäftshaushalt, ihre Eltern hatten eine alteingeführte Lotto-Annahmestelle, in der man auch Tabakwaren und Zeitschriften kaufen konnte. Für jemanden von der Leusbergstraße war es schon ein kleiner sozialer Aufstieg, in eine Familie zu kommen, in der man sonntags an gedeckten Tischen saß und aus feinem Porzellan Kaffee trank. So etwas kannte ich gar nicht. Aber ich wurde herzlich aufgenommen, vor allem, als ich nach dem Tod meiner Eltern moralische Unterstützung benötigte.
Die Beziehung zwischen Ingrid und mir war erheblich turbulenter, als diese Worte es klingen lassen. Vor der Heirat waren wir verlobt, dann entlobt, dann wieder verlobt. Zum allergrößten Teil lag die Schuld bei mir. Ich war in jener Zeit nicht leicht zu nehmen und sicher auch sehr unreif. Vor allem aber, da bin ich mir heute sicher, war ich einfach mit mir und meinem Leben zutiefst unzufrieden. Mein Traum vom Botschafterposten an einem exotischen Ort war geplatzt, und ich hatte ihn nicht durch einen anderen ersetzt, sondern ließ mich nur treiben und war auf dem besten Weg zum Tunichtgut. Eine Zeit lang tingelte ich sogar durch Spielcasinos, verdingte mich als Croupier und fing selbst an zu zocken. Vielleicht hatte ich deswegen später, als Geschäftsführer einer Trabrennbahn, ein gutes Gespür für die Mentalität des zwanghaften Spielers.
Zum Glück hatte ich in jener Phase dann doch noch einen lichten Moment. Nach drei Jahren fühlte ich mich, als würde ich immer mit dem Schädel gegen eine Wand rennen. „Um Himmels willen, das kann doch nicht mein Leben sein!“, schoss es mir durch den Kopf. „Ich muss doch etwas machen, was einen Sinn hat.“ Naheliegend wäre gewesen, das alte Studium wieder aufzunehmen. Ich dachte auch kurz daran, stellte aber schnell fest, dass ich zu viel Abstand gewonnen hatte. Dieser ganze Juristenkram war mir fremd geworden. Außerdem hätte es bis zum Staatsexamen noch einige Zeit gedauert, und ich brauchte eine Ausbildung, die ich zügig abschließen konnte. Das soll man im Leben nie tun – etwas machen, nur weil es schnell geht. Aber diese Lektion hatte ich damals noch nicht gelernt.
Zu jener Zeit konnte man durch ein Studium von sechs Semestern Volksschullehrer werden. Zwei davon würde man mir erlassen, weil ich aus Münster und Berlin ein Vorstudium nachweisen konnte. Das hieß also: Ich konnte in nur zwei Jahren, nach vier Semestern, Lehrer werden. So begann im Jahr 1964 an der Pädagogischen Hochschule in Dortmund mein zweites Leben als Student.
Wovon aber sollte ich während der vier Semester leben? Die Lösung des Problems hätte meinem Vater vermutlich sehr gefallen. Sein Sohn, der nie auf den Pütt wollte, finanzierte sich sein Studium unter Tage, auf der Zeche General Blumenthal. Natürlich war ich nicht wie mein Vater im Streb, wo die Kohle abgebaut wird. Stattdessen wurde ich zwei alten Hauern im sogenannten Streckenvortrieb als Gehilfe zugeteilt. Es wurde in zwei Schichten gearbeitet. Die erste Schicht bohrte Löcher und sprengte; die zweite, das waren wir, legte Schienen und baute die Strecke aus. Zuvor mussten aber natürlich die Steinbrocken vom Sprengen aus dem Weg geräumt werden. Das war mein Job: Steine zum Abtransport in die Lore schaufeln. Harte Arbeit für zarte Studentenhändchen.
Eines Tages, während der Butterbrotpause, kam der Steiger zu mir. „So, Hansch“, sagte er. „Jetzt wollen wir uns mal einen Streb ansehen.“ Auf dem Arschleder rutschten wir in Schräglage runter auf die nächste Sohle. Und dort habe ich dann gesehen, unter welchen Bedingungen mein Vater 36 Jahre lang geschuftet hatte. Nicht erst seit diesem Tag habe ich Respekt und große Ehrfurcht vor der Arbeit der Kumpel.
Es ist schon seltsam: Obwohl ich mich als Junge mit Händen und Füßen dagegen gewehrt hatte, auf den Pütt zu gehen, ist es mir heute sehr wichtig, dass ich dann doch noch dort gewesen bin, wenn es auch nur sechs Wochen in den Semesterferien waren. Viele Jahre später, Ende der 1990er, lernte ich den Vorstandsvorsitzenden der Ruhrknappschaft zufällig kennen, und wir unterhielten uns über die große Zeit der Zechen. Ich erwähnte, dass ich auch mal eine Zeit auf dem Pütt gearbeitet hatte, was ihn sehr interessierte. Etwa drei Wochen später bekam ich Post von ihm. Er hatte in alten Unterlagen gewühlt und tatsächlich meine Knappenkarte aus den 1960ern gefunden. Ich habe sie noch heute – und bin sehr stolz auf sie. Onkel Leo hat es leider nicht mehr erlebt, dass sein Ersatzsohn auf die Zeche ging. Ich war noch nicht lange wieder im Studium, da kam ich eines Tages nach Hause, in die Leusbergstraße, und fand Zita und Tante Anni tränenüberströmt vor.
„Was ist passiert?“, fragte ich entgeistert.
„Onkel Leo ist tot“, schluchzte Zita.
„Wo ist er?“, wollte ich wissen.
„In unserer Wohnung“, sagte Tante Anni.
Sie hatte noch keinen Bestatter gerufen. Ich machte augenblicklich kehrt und eilte hinüber zur Emscherstraße. Onkel Leo saß auf der Couch, als ob er darauf warten würde, dass seine Frau zurückkommt. Es war das erste Mal, dass ich so etwas sah: Jemand, der vom Tod überrumpelt worden war. Vielleicht nicht direkt in der Blüte seiner Jahre, aber auch nicht in einem hohen Alter. Onkel Leo war erst Mitte sechzig, als er starb. Tanne Anni überlebte ihn sehr lange. Sie ist 1987 gestorben.
Meine kurze Karriere als Lehrer
Bei meinem zweiten Anlauf schloss ich das Studium tatsächlich ab, sogar mit einem buchstäblich ausgezeichneten Examen. Auch die erhoffte Anstellung fand ich sehr schnell, an einer Volksschule in Dortmund-Nette. Von Lehrerarbeitslosigkeit konnte damals noch keine Rede sein. Und im Jahr, nachdem Ingrid und ich geheiratet hatten, wurde ich auch noch Vater. Am 9. April 1966 kam mein Sohn Oliver zur Welt, auf den ich sehr stolz bin und dessen eigene Familie heute mein großer Lebensanker ist. Oberflächlich betrachtet, schien also alles in bester Ordnung zu sein und in traditionellen, gesellschaftlich akzeptierten Bahnen zu laufen. Wir planten sogar noch ein zweites Kind, hofften auf ein Mädchen und hatten uns auch schon auf einen Namen geeinigt – Jennifer.
Doch nach und nach bekam ich das Gefühl, vom Regen in die Traufe gekommen zu sein. Das fing an mit dem Beruf, von dem ich schon nach kurzer Zeit merkte, dass er nichts für mich war. Ich trat meine Stelle nach den großen Ferien an, zusammen mit einem anderen Neuen. Die Schule in Nette war sehr groß, es gab knapp tausend Kinder und 25 Lehrer. Es herrschte ein unglaubliches Gewimmel, und wir zwei wurden nur beiläufig wahrgenommen. Schließlich schellte es, und alle eilten in ihre Klassen. Wir beide standen da wie bestellt und nicht abgeholt.
Nach einiger Zeit kam die Rektorin auf uns zu. Sie hatte einen Bubikopf, trug eine Hornbrille und sah für mich irgendwie aus, als wäre sie aus dem Dritten Reich übrig geblieben. (Was vermutlich auch stimmte. Sie war trotzdem eine sehr nette Frau.) „Tja, was mache ich denn mit Ihnen?“, murmelte sie. „Herr Hansch, übernehmen Sie doch einfach mal die 7b. Ich muss Ihnen aber gleich sagen, dass das vielleicht nicht so einfach wird. Die hat aus Krankheitsgründen schon länger keinen richtigen Klassenlehrer mehr gehabt.“
Ich ging die Treppen hoch und konnte schon von Weitem hören, wie die Schüler im Klassenraum über Tische und Bänke stiegen. Ich hatte auf der Hochschule vom Pädagogen Hugo Reiring gelernt, dass man auch kleine Kinder ernst nehmen muss und im Grunde wie Erwachsene behandeln sollte. Mit dieser Einstellung trat ich vor die Klasse. „Kinder, seid doch vernünftig!“, sagte ich. „Wenn alle durcheinander schreien, kann niemand was verstehen.“ Man muss wohl sagen, dass dieser Ansatz nur bedingt Erfolg zeitigte. Jedes Mal, wenn ich zur Großen Pause ins Lehrerzimmer trat, schauten die Kollegen auf meinen hochroten Kopf und sagten: „Sie haben sich ja schon wieder total aufgeregt, Herr Kollege. Wenn Sie so weitermachen, werden Sie es hier nicht lange aushalten.“
In meiner Klasse war ein Schüler namens Egon. Er war älter als die anderen, weil er schon zweimal sitzengeblieben war, und betrachtete sich als Anführer der Klasse. Eines Tages schrieb ich etwas an die Tafel und hörte hinter mir den üblichen Lärm. Da drehte ich mich um, baute mich vor den Tischen auf und blickte Egon an.
„Egon, du bist doch der Chef hier“, sagte ich. „Also sage ich dir jetzt mal, was als Nächstes passiert. Du kommst hier nach vorne, und dann kriegst du von mir eine gescheuert.“
Er kam tatsächlich – und grinste mich an. Ich weiß nicht, ob er mich provozieren wollte oder ob er glaubte, meine Ankündigung wäre nur eine leere Drohung. Er stellte sich vor mich. Ich hob die rechte Hand (an der ich damals noch einen Siegelring trug) und haute ihm mit voller Wucht in die Fresse. Augenblicklich war es totenstill in der Klasse. Egon schwankte, aber er fiel nicht. Er rieb sich die Wange, machte kehrt und schlich sich zurück zu seinem Platz. Von diesem Moment an galt die 7b als ruhigste Klasse der gesamten Schule. Und zwar weil Egon mein bester Verbündeter war. Sobald mich etwas störte, sah ich ihn an und sagte: „Egon, hast du deine Truppe nicht mehr im Griff?“ Dann guckte er nur zweimal böse in die Runde, und sofort war Ruhe im Karton.
Am Tag nachdem ich Egon geschlagen hatte, klopfte es kurz vor der Großen Pause an die Tür zum Klassenraum. Ich hatte sofort ein ungutes Gefühl, deswegen nahm ich auf dem Weg zur Tür meinen Schlüsselbund in die Faust. Vor der Tür stand ein Mann in Maurerkleidung, den ich noch nie gesehen hatte, mindestens einen Kopf größer und gut doppelt so breit wie ich. „Sind Sie Herr Hansch?“, fragte er. Das konnte ich schlecht verneinen, und so fuhr er fort: „Ich bin der Vater vom Egon.“
Ich sagte zu den Schülern, ich käme gleich wieder, trat hinaus auf den Gang und zog die Tür hinter mir zu. Ich war auf alles gefasst. „Ich habe gehört, was Sie gestern gemacht haben“, sagte Egons Vater. „Ich weiß, wie schwierig der Junge ist.“ Er machte eine kurze Pause, holte Luft und sagte: „Ich wollte Ihnen nur sagen: Das können Sie ruhig öfter machen!“ Darauf war ich nun allerdings nicht gefasst gewesen. „Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis“, sagte ich, „aber ich glaube, das wird in Zukunft nicht mehr nötig sein.“
Meine Erleichterung war so groß, dass ich ihm fast um den Hals gefallen wäre. Denn ich hatte mir natürlich große Vorwürfe gemacht und insgeheim schon mit der Entlassung gerechnet, vielleicht sogar mit Schlimmerem. Man konnte doch nicht vor der ganzen Klasse einen Schüler mit vollem Vorsatz auf diese Weise körperlich züchtigen. Es war ja fast wie eine Exekution! Da hätte ich schon wissen können, dass ich nicht zum Lehrer taugte.
Abgesehen von dieser Episode hatte ich allerdings mit den Kindern eigentlich keine Probleme. Eine viel größere Hürde war zum Beispiel der Lehrplan. Als Klassenlehrer unterrichtete ich alle Fächer – auch Religion. Später wurde dies geändert, aber als ich mich für Pädagogik einschrieb, war es noch fester Bestandteil der Studienbedingungen, dass man auch die Lehrbefähigung für Religion erwarb. Darauf hatte ich nun wirklich keinen Bock, denn mein Verhältnis zur Religion war inzwischen äußerst weltlich. Kurz vor der Prüfung bat ich den Regierungsvertreter, der in der Prüfungskommission saß, um ein Gespräch und schilderte ihm meine Bedenken. Er sagte: „Ich verstehe Sie, Hansch, aber Sie müssen da durch. Ich versichere Ihnen, dass ich bei der Prüfung anwesend sein werde, und dass ich darauf achte, dass es keine Gesinnungsprüfung wird, sondern eine Wissensprüfung.“
So war es dann am Ende auch. Ich brachte die Prüfung mit einem „Befriedigend“ (meiner schlechtesten Note) hinter mich und war im Besitz der Missio canonica, wie die katholische Lehrbefugnis heißt. An der Schule sagte ich dann der Rektorin sogleich, dass sie mich für alle Fächer einteilen könne, aber bitte nicht für Religion. Doch da war nichts zu machen. Ich war einer von nur drei Katholiken im gesamten, großen Lehrkörper. Also biss ich in den sauren Apfel und zog den Katechismus durch, an den ich selbst nicht glaubte. Es war ein weiteres Detail, das mich störte und meine Unzufriedenheit im Beruf wachsen ließ.
Dazu kamen private Probleme. Vielleicht trug ich die Frustration, die ich tagsüber als Lehrer spürte, in meine Ehe hinein. Vielleicht war es auch umgekehrt. Jedenfalls vertieften sich auf allen Ebenen, zwischenzeitlich sogar in finanzieller Hinsicht, die Krisen, in die ich nach und nach hineinschlitterte. So wenig, wie ich zum Lehrer taugte, so wenig schien ich zum Ehemann zu taugen. Jedenfalls nicht zum Ehemann von Ingrid. Unsere Beziehung war eine von diesen seltsamen, in denen die beiden Partner einfach nicht miteinander leben können, dann jedoch – nach der Trennung – zu den besten Freunden werden. Wir ließen uns im November 1968 scheiden, aber ich hatte danach ein wunderbares menschliches Verhältnis zu Ingrid, und als sie im September 1999 an den Folgen von Brustkrebs starb, mit gerade einmal 59 Jahren, da war ich es, der ihr die Augen für immer schloss.
Im Nachhinein war die Scheidung für alle Beteiligten die beste Lösung, und ich bin dem Schicksal wirklich dankbar, dass vor allem für den Jungen alles gut ausging. Oliver blieb bei Ingrid, die wenige Jahre später einen neuen Lebenspartner fand, mit dem ich mich gut verstand. In der Schule hatte mein Sohn nie Probleme, legte ein tolles Abitur hin und zog sein Studium in einer Weise durch, wie es seinem Vater nicht vergönnt gewesen war. (Was hätte Stefan Hansch wohl erwidert, wenn ihm gesagt worden wäre, dass eines seiner Enkelkinder in England promovieren und dann in den USA an der Universität lehren würde?)
Wer nur wegen seiner Kinder zusammenbleibt, obwohl keine Liebe mehr da ist, der tut weder sich noch seinen Kindern einen Gefallen. Das ist die Lehre, die ich aus dieser Geschichte gezogen habe. Aber das konnte ich natürlich 1968 noch nicht ahnen, als mein kleiner Sohn zu einem Scheidungskind und ich zu einem Wochenendvater wurde. Man muss es so deutlich sagen: Vor mir selbst – und es gibt keinen härteren und wichtigeren Kritiker – war ich privat und beruflich brutal gescheitert. Es war der zweite Tiefpunkt des Jahrzehnts für mich, und diesmal hatte ich nicht die leiseste Ahnung, was ich tun sollte. Noch war ich Beamter auf Widerruf, aber die zweite Staatsprüfung rückte unaufhaltsam näher. Was viele Leute sich erträumen, erschien mir wie der Eintritt in die Vorhölle – verbeamtet zu werden und den Rest meines Lebens als Lehrer zu arbeiten. Also bat ich um meine Entlassungsurkunde.
Zum ersten, aber nicht zum letzten Mal in meinem Leben war es eine entweder unerwartete oder sogar rein zufällige Begegnung mit einem fast Fremden, die mich auf einen neuen Lebensweg stupste. Später hießen die Menschen, durch die sich alles ändern sollte, Günter Siebert oder Kurt Brumme. Bei diesem ersten und am Ende wahrscheinlich wichtigsten Mal war es ein Mann namens Werner Korte. Ich hatte nur eine ungefähre Ahnung, wer er überhaupt war, als er mich ansprach. Irgendwie kannten wir uns über die Penne, glaube ich. Jedenfalls arbeitete Korte inzwischen als Geschäftsführer der Trabrennbahn in Recklinghausen. Und in dieser Eigenschaft rief er mich eines Tages aus heiterem Himmel an.
„Werner, ich weiß ja, dass du so ein bisschen schreiben kannst“, sagte er. Ich kann nur vermuten, dass er sich entweder auf ein gewisses Talent im Umgang mit Sprache bezog, das ich auf der Schule gezeigt haben musste, oder auf meinen Lehrerberuf. Denn bis dahin war ich nicht journalistisch und schon gar nicht schriftstellerisch auffällig geworden. „Ich möchte hier auf der Trabrennbahn was ganz Neues machen. Ich möchte eine kleine Presseabteilung aufbauen, um den Sport etwas populärer zu machen“, fuhr Korte fort. „Wäre das was für dich? Du kannst es dir ja mal überlegen.“
Er kann nicht gewusst haben, dass ich meinen Beruf aufgegeben hatte. Schließlich posaunte ich meine Seelenlage ja nicht in die Welt hinaus, außerdem kannten wir uns nur flüchtig. Seine Anfrage kam also rein zufällig im richtigen Moment. Andererseits hatte ich keine besonders große Beziehung zu Pferden. Onkel Leo hatte mich in den 1950ern ab und zu mit auf die Rennbahn genommen, aber meistens zu den Autorennen, die damals noch dort veranstaltet wurden. (Der Rennfahrer Walter Komossa war unser Lokalheld.)
Beim Trabrennen war ich einige wenige Male, in erster Linie, weil man als Recklinghäuser gar nicht daran vorbeikonnte. Die Bahn war eine der ältesten Turfstätten in Westdeutschland und das größte Aushängeschild der ganzen Stadt. Als ich während meiner Schulzeit mal einen Job für die Sommerferien gesucht hatte, war mir zuerst die Rennbahn eingefallen. Etwa vier Wochen lang mistete ich als Schüler die Boxen aus. Darauf beschränkten sich also meine Erfahrungen mit dem Pferderennsport.
Etwa zwei Wochen lang schob ich die Entscheidung hin und her. Doch im Grunde stand mein Entschluss schon kurz nach dem Anruf fest. Mein Gehalt als Lehrer hatte 1.250 Mark netto betragen. Nicht zu verachten in jener Zeit, aber auch keineswegs bemerkenswert. Korte stellte mir mehr Geld in Aussicht und mehr Freiheit. Nach zweieinhalb Jahren im Schuldienst bekam ich meine Entlassungsurkunde („Mit dem Dank des Landes“) und begann Ende 1968 ein neues Leben – auf der Trabrennbahn.