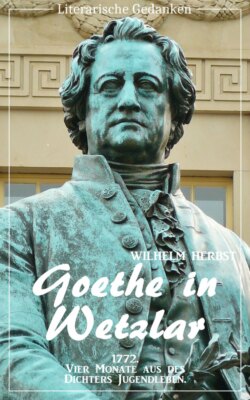Читать книгу Goethe in Wetzlar (Wilhelm Herbst) (Literarische Gedanken Edition) - Wilhelm Herbst - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel I. – Zur Einleitung.
ОглавлениеZwei Vorfragen, beide wieder unter sich in engem Zusammenhang, fordern an der Schwelle dieser Schrift eine Antwort. Einmal, ob diese kurze Episode ein inneres Recht hat, aus dem Gesamtbilde von Goethes Leben und Dichtung herausgenommen und als ein gesondertes Ganzes behandelt zu werden; dann die Frage nach der menschlichen und dichterischen Gestalt, in welcher Goethe bei seinem Übergang in die Wetzlarer Verhältnisse vor uns tritt.
Der Satz wird kaum einem Widerspruche begegnen, daß es — gegenwärtig oder überhaupt — fast unmöglich ist, den ganzen Goethe biographisch zu erschöpfen. Die bisherigen Versuche, so willkommen und dankenswert an sich, beweisen nur diese Unmöglichkeit. Der Stoff dieses überreichen Menschen-und Dichterlebens ist zu breit und groß, um die äußeren und inneren Seiten seiner Entwicklung gleichmäßig zur Anschauung bringen zu können. Und doch hemmt hier die Fülle — die Größe der Aufgabe wie die Masse des zu bewältigenden Materials — kaum drückender als der Mangel. Denn so reich jetzt auch die ursprünglichen Quellen fließen, so massenhaft die peripherische Litteratur angeschwollen ist und täglich weiter schwillt, doch gähnen noch empfindliche Lücken, die selbst die noch immer aussichtslose Öffnung des hermetisch verschlossenen Familienarchivs in Weimar nicht alle füllen würde. Hat doch der Dichter nach mäßigem Anschlag mehr denn zehntausend Briefe während seines langen Lebens ausgehen lassen. Die Folge des bezeichneten Notstandes ist, daß man sich entweder an einer skizzenhaften Zeichnung des Gesamtlebens und Dichtens genügen läßt, oder daß nur der äußere Goethe betrachtet wird, der innere Lebensgang und das poetische Schaffen aber uncharakterisiert und der parallellaufenden Lektüre entweder der Dichtungen selbst oder von deren Interpreten überlassen bleibt; oder endlich es wird, wie von H. Grimm, nur das poetische Schaffen in seinen Spitzen genetisch und analytisch vorgeführt, während das äußere Lebensbild völlig zurücktritt. Alle diese Methoden aber, die natürlichen Folgen einer von der Sachlage aufgedrungenen Resignation, führen nur zu Fragmenten, nicht zu einer Totalität. Um ein Ganzes, gleichmäßig ausgeführt, zu erreichen, dazu wäre schon nach dem jetzt zugänglichen Material ein Werk erforderlich, das die einer Biographie gesteckten Schranken überspringen oder sprengen müßte, und ein universeller Geist, wie ihn die Gegenwart schwerlich birgt. Und doch — gerade hier, bei diesem unvergleichlichen Ineinander äußerer Verhältnisse und inneren Werdens, bei dieser organischen Verbindung des Einzellebens mit der Kultur seiner Zeit in all ihren Lebensregungen führt jeder Verzicht auf die Würdigung eines dieser Faktoren zu einem unbefriedigenden Ziele.
So liegt es nahe, statt der totalen, die noch nicht an der Zeit sind, partielle Versuche in der Art zu wagen, daß man zunächst einzelne Abschnitte dieses Dichterlebens heraushebt, diese aber nach allen Seiten, den realen wie idealen, zu würdigen strebt. Auch solchen Versuchen wird die mit Vorliebe gepflegte, methodisch-kritische und resultatreiche Goethe-Forschung unserer Tage auf Schritt und Tritt förderlich sein. Erst nachdem eine Reihe biographischer Einzelabschnitte durchgearbeitet vorliegt, wird sich allmählich ein Gesamtbild zusammenfügen können, wenn die gestaltende Meisterhand darüberkommt.
Freilich haben solche Versuche nur dann ein Recht und einen Sinn, wenn man die rechten Abschnitte herausgreift, d.h. solche, die wirklich loslösbar sind von dem Vor- und Nachher des Lebens; die auch bei aller Zeitkürze gehaltvoll genug erscheinen, um der Episode ein charakteristisches Gepräge aufzudrücken; endlich, wenn der gewählte Teil die volle Kenntnis des Ganzen zur lebendigen Voraussetzung hat. Alle Willkür würde das erstrebte Schlußziel mehr hinausschieben als näher rücken. Denn darüber darf kein Zweifel bleiben, daß dieses vor vielen organische Leben überall in sich zusammenhängt, daß es im Fluß bleibt, daß man den fortlaufenden Faden weder durchschneiden will noch kann. Solche Gruppen treten in Goethes Leben mehrfach hervor. So, um nur Beispiele zu nennen, die Leipziger, die Straßburger Zeit, so die Frankfurter Periode von 1771-1772, von 1773-1775, so das erste Jahrzehnt in Weimar bis zur italienischen Reise, so der Glanz- und Höhepunkt unserer Dichtungsgeschichte, der Dichterbund mit Schiller. Es fragt sich, ob sich, mit diesen Maßstäben gemessen, auch die Wetzlarer Episode als ein relativ selbständiger Abschnitt aussondern läßt. Unter allen aufgeführten Gruppen wäre diese allerdings die kürzeste. Wird diese Kürze aufgewogen durch inneren Gehalt und fortwirkende Tragweite? Denn daß hier das Leben des Dichters sich auf neuer Scene bewegt, ist kein ausreichendes Motiv für die Sonderung. Das hieße dem Rahmen größeres Gewicht beilegen als dem Bilde, das er umschließen soll. Immerhin ist es ein Motiv, wenn auch ein sekundäres; denn ein solcher Scenenwechsel, ein neuer örtlicher Schauplatz, neue Menschen und Verhältnisse, neue Thätigkeiten und Interessen bilden allerdings eine wesentlich neue Welt für das Werden des Dichters. Dabei bleibt das Vergangene und Errungene sein Eigentum, aber er tritt ihm in freierer Sammlung gegenüber. So wird durch den Ortswechsel, der nie bloß ein äußerer Vorgang bleibt, der Abschnitt dem Betrachter eben abtrennbar von dem Vor- und Nachher. War aber der Gehalt dieser »Glückseligkeit von vier Monaten« bedeutsam genug, um ihn als ein selbständiges Ganzes darzustellen? Der Dichter selbst scheint einer solchen Annahme zu widersprechen, wenn er in seiner Selbstbiographie sagt: »was mir in Wetzlar begegnet, ist von keiner großen Bedeutung«, und wenn er »auf Mangel oder Stockung der Produktionskraft« dort hindeutet. In der That, wenn es sich in dem poetischen Schaffen um sicht- und greifbare Früchte handelt, war der Wetzlarer Sommer für den Dichter wenig ergiebig; rechnen wir aber zu der produktiven Arbeit auch deren Vorstadien, das stille unterirdische Reifen, die Sammlung und die Kontemplation, das weitaussehende Planmachen, die realen Bedingungen neuer größerer Schöpfungen, so werden jene Monate nicht arm und leer erscheinen, vielmehr bewegt von den größten Intentionen, welche Goethes Frühzeit überhaupt bewegen. Allerdings nicht in dem Sinne, als ob in die Wetzlarer Zeit nachweisbar große epochemachende Impulse fielen; aber gerade die innerste Triebkraft seiner Dichtung, die ihr den Stempel ihrer Größe und Eigenart, den Zauber und die Gewalt ohnegleichen aufprägt, ist dem Dichter hier klarer wie je zuvor in das Bewußtsein getreten. Die Erkenntnis nämlich, die wie eine Inspiration über ihn kam, daß die poetische Gestaltung nur des Selbsterlebten die Bürgschaft ewiger Dauer und Lebensfähigkeit in sich trage. Diese Erfahrung, die er längst an der Lyrik gemacht hatte — der sie am nächsten liegt —, verallgemeinert sich ihm jetzt für das gesamte Gebiet der Dichtung. Daß darum der Dichter den Menschen voraussetze, und daß, je reicher und lebensvoller dieser dastehe, jener um so tiefer und schöner erscheine, diese Erfahrung wurde ihm in dieser Zeit gewiß. Eben darum wurde ihm das Leben an sich, der Zuwachs an innerem und äußerem Erleben so bedeutsam, darum das Betonen und Hervortreten des psychologischen Moments als der Seele seiner Dichtung, auch der dramatischen und epischen. Dieser springende Punkt in Goethes Schaffen tritt aber am kühnsten und energischsten im »Werther« hervor, der gerade darum einen Wendepunkt unserer Dichtungsgeschichte bedeutet. Solche Enthüllungen der Menschennatur, mit einer Naturnacktheit vorgetragen, die nur dadurch möglich war, daß Held und Autor ein' und dieselbe Person sind, sie waren bis dahin unerhört. Wurde der Dichter aber erst durch seine Wetzlarer Erlebnisse an die Quelle seiner Dichtergröße geführt, so liegt hierin auch ein ausreichendes Motiv, dieses Stück Goethescher Lebensgeschichte besonders zu behandeln. Es ist eben der Vorhof und die Rüstezeit zur größten Erhebung seiner Jugendpoesie. Selbst der »Götz« schreitet nicht über diesen Vorhof hinaus in das innerste Heiligtum. Denn so mächtig er Goethes Dichterberuf überhaupt offenbart, die eigentliche Seele seiner Poesie enthüllt er doch nur halb, d.h. jene psychische Meisterschaft, die nur aus dem persönlichen Moment der ganzen oder annähernden Identifizierung des Dichters mit dem Helden stammen kann. In »Werther«, »Faust«, in »Iphigenia«, in »Tasso«, in »Wilhelm Meister«, in den »Wahlverwandtschaften« ist das Beste und Tiefste aus der eigenen Brust geschöpft, im Götz, dem unter dem Wehen des Shakespeareschen Geistes empfangenen Drama, sind es höchstens partikulare Konfessionen, die in Nebenpersonen (wie in Weislingen) wiederklingen. Wie viel weiter ab lag ihm doch dieser historische Stoff, an den ihn keine unmittelbare Erfahrung band, der den Nerv seines Lebens nicht traf — so jugendwarm er ihn umfaßte und den überlieferten poetisch weiterbildete und belebte —, als Werther, den er nach eigenem Bekenntnis gleich dem Pelikan mit seinem Herzblut gefüttert hatte. Sehen wir also zunächst in dem Wetzlarer Leben Goethes einen Grund, dem flüchtigen Intermezzo einen dauernden und hohen Wert beizulegen, so giebt uns hierzu vor allem der Dichter selbst das Recht. Nicht freilich in dem matteren Abendrote der Selbstbiographie. Aber auch in diesem betont er als Grund seiner Enthaltung, er habe schon, von seinem Genius getrieben, in »vermögender Jugendzeit« im Werther das Bild jener Zeit festgehalten. Wie mochte er eine Tautologie wagen, die unmöglich die volle Farbe des Lebens tragen konnte? Vollends aber im Spiegel der gleichzeitigen Briefe betonte der Dichter immer und immer wieder, mitunter in halb träumender Ekstase, den einzigen Charakter dieser Wochen. Aber dieser Realität, die doch erst um einige Zeit später ihren poetischen Ausdruck findet, geht sofort ein ideales Moment zur Seite, die ahnende Erkenntnis, von der ich sprach, daß sein poetisches Schaffen mit der Vertiefung in die Wirklichkeiten des Menschenlebens, des eigenen vor allem und nie ohne die tiefste Beteiligung des eigenen, stehe und falle. Nicht das Völkerleben mit seinen Kämpfen war seine natürliche Welt, sondern das Einzelleben mit seinem lösungsbedürftigen inneren Widerstreite, wo in allem Wandel der Zeiten das Dauernde und Ewige seine Stätte hat. Innerhalb dieser Innenwelt war ihm nichts Menschliches fremd; er ist darum, wie kein anderer aufnehmend und gestaltend auch der Dichter des Zeitalters der Humanität geworden, so wenig wir ihn, den zeitlosen und unsterblichen, in diese zeitlichen Schranken bannen dürfen. Rühre ich hiermit an das Ziel und die Summa Goethescher Dichtung, und hat das ahnende oder vorschauende Bewußtsein dieser seiner Lebensbestimmung, das sich zuerst in Straßburg regte, in Frankfurt nach Bethätigung suchte, in der Wetzlarer Sammlung einen merklichen Schritt vorwärts gethan, so liegt hierin ein zweites, dem realen ebenbürtiges Motiv, diese Episode als eine relativ selbständige aus dem Zusammenhang des Goetheschen Lebens herauszuheben.
Dann stehen wir vor der zweiten Frage, wie d.h. in welchem Stadium seines menschlichen und poetischen Werdens der junge Dichter in die neuen Verhältnisse eintrat. Die Antwort auf diese Frage stellt den Anschluß dieses Abschnitts an die nächste Vergangenheit her, und es ist natürlich, daß wir Goethe in Wetzlar und das, was ihm dieser Aufenthalt eingebracht, erst dann verstehen, wenn wir wissen, was er mitgebracht. Freilich liegt eine volle Antwort auf diese Frage in der ganzen Vorgeschichte, in der genetischen Entwickelung, auf die wir hier verzichten müssen. Nur mit kurzen Strichen kann das Bild des Dichters im Frühjahr 1772 gezeichnet werden.
Wir erinnern uns daran, daß Goethe menschlich und poetisch in Straßburg eigentlich aufzuleben begonnen hat. Was weiter zurücklag, namentlich die Leipziger Zeit, zeigt mehr eine Verhüllung als eine Entfaltung des wahren Goethe. Sind doch die Jugenddramen, die »Mitschuldigen« und die »Launen des Verliebten« nach Art und Geist so grundverschieden von den poetischen Früchten, die in Straßburg und Frankfurt reifen oder ansetzen, als ob es Kinder verschiedener Väter wären. In der Straßburger Zeit hat vor allem Herders überwältigende Einwirkung und die Liebe zu Friederike herausgebildet, was in dem Jüngling schlummerte. Man hat die Folgejahre wohl Goethes deutsche Periode genannt. Und sie war es, wenn man auch richtiger den allgemeineren und umfassenderen Namen »germanische« Periode wählen sollte, womit neben dem hervorbrechenden Eigenen auch die mitwirkenden Kräfte von außen, Shakespeare und Ossian und der englische Roman bezeichnet würden. Und alle diese Hilfskräfte von außen vertritt dem ahnenden und suchenden Dichter Herders entscheidender Rat; und hinter Herder und von diesem dem Dichter nahe gerückt steht die sibyllinische Weisheit des nie gesehenen Magus im Norden. Aber derselbe Herder wird ihm auch zum Vertreter der Antike, der hellenischen Dichtung. Und wenn die in Straßburg beginnende Homerlektüre und die Erweiterung seiner griechischen Studien in Frankfurt und Wetzlar auch nicht unmittelbare Früchte reifen, die jener deutschen Periode alsbald eine klassische gegenüberstellten, so sieht doch jede schärfere Betrachtung, daß die Reaktion griechischer Einfalt und Plastik gegen ungefüge germanische Formlosigkeit alsbald und lange vor »Iphigenia«, »Tasso« und »Hermann und Dorothea« hervorscheint. Gewiß nur als ein edles naturverwandtes Pfropfreis, nicht als ein Fremdes und Aufgedrungenes. Denn Goethes schlichtem Naturgefühl kam die Antike nur bestätigend, fördernd entgegen. Selbst in den bewegtesten Teilen des »Werther« erkennen wir den besonnenen Zügel des Künstlers, der das Gesetz der Harmonie in sich trägt. Es ist, als ob die Motive der deutschen Renaissancezeit schon in dem jungen Goethe mit ursprünglicher Kraft wiederkehrten. In ihm vertrug sich das scheinbar Fernste hellenischer Poesie, das er sich mit wunderbarer Aneignungskraft zu eigen machte, mit dem von Natur Nächsten, Vaterländischen.
Nach Frankfurt von der Universitätszeit heimgekehrt, geht Goethe sofort zur praktischen Anwendung des in Straßburg Erlebten und Erlernten über. Gleichzeitig tritt er ein Amt an und versucht zum erstenmale den höheren dramatischen Flug. »Götz« und die Advokatur gehen im ersten Quartal des Winters von 1771 auf 1772 neben einander her. Es sind die Konsequenzen und Fortwirkungen der Straßburger Zeit. In dem zweiten Quartal aber dieses merkwürdigen Winters vertieft er sich in die griechischen Studien und tritt zugleich in jenen Darmstadt-Homburger Kreis ein, der ihm menschlich so ungemein viel wurde. Man darf sagen: es waren bei seinem Eintritt in Wetzlar fast alle Elemente zusammen, die den Dichter gründeten und bedingten; in Wetzlar selbst wurden diese Elemente ergänzt und vervollständigt. Und dabei bedeutet der Zeitpunkt jene fesselnde Lage unmittelbar vor dem Aufthun der Schranken, aus denen er zu poetischen Großthaten in die weite Arena unserer Litteratur hervortreten sollte. Wohl war man schon aufmerksam auf den Dichterjüngling in engeren Kreisen, aber nach außen hin war er ein noch unberühmter Name. Er selbst aber glaubte an seinen Beruf von Gottes Gnaden und er führte in dem ersten noch unfertigen Entwurf des »Götz«, den nur wenige kannten, sein Probe-, wenn auch noch nicht sein Meisterstück mit nach Wetzlar. So war es ein eigener Mittelzustand zwischen glücklicher Verborgenheit, welche hinter den Coulissen der großen Welt die volle Unbefangenheit zuließ, und den inneren Ansprüchen einer genialen Natur, die ihrer selbst gewiß geworden war. Ein litterarisches Inkognito, aber mit erprobtem Kraftgefühl und poetischer Legitimation, die sich noch steigerte durch die Mitwirkung an dem nun auftauchenden und den neuen Geist verkündenden kritischen Institut der Frankfurter Gelehrten Anzeigen. Und für dieses große Streben war es charakteristisch, daß der Dichter wie instinktiv damals nach Stoffen von universeller und prinzipieller Tragweite suchte, in denen er dichtend zugleich eine Weltanschauung aussprach. Auf dieser Linie bewegen sich in dieser und der nächstfolgenden Zeit Stoffe wie Sokrates, Prometheus, Cäsar, Ahasverus, Mahomet, Faust, die alle auszutragen auch über seines Geistes Maß ging; und an dem einen Stoff, von dem er nicht abließ, trug er sein Leben lang. Und dies eben darum, weil es von allen der zugleich universellste und persönlichste war. In welchem Grade Faust gerade ein Spiegel eigener Konfessionen war, zeigt jede neue Forschung immer heller. Es wird uns unten entgegentreten, wie Goethe selbst bei seinem Übergang nach Wetzlar mitten in einer inneren Gährung und Krisis steht. Dies überreiche Ausgeben setzte ein reiches Einnehmen, und nicht bloß aus Büchern, sondern aus lebendigem Menschenverkehr voraus. Ein solcher fehlte in dem denkwürdigen Frankfurter Winter von 1771 bis 1772 nicht. Doch fand ihn der Dichter ungleich weniger in der Vaterstadt, die er überhaupt schon damals nicht mit sympathischem Blick ansah, als in der Nachbarschaft, in Darmstadt und Homburg. Hier erschloß ihm der geistig gemütliche Verkehr mit Merck und jener Dreizahl der Freundinnen Louise v. Ziegler, Fräulein v. Roussillon und Karoline Flachsland — oder in der poetischen Sprache: Lila, Urania und Psyche — eine neue Welt. Bildete sich auch zu keiner ein leidenschaftliches Verhältnis, weil dem Dichter noch die verlassene Friederike in dem Elsässer Dörfchen in Erinnerung und Gewissen zu gegenwärtig war, so streifte doch die Hinneigung zu Lila namentlich dergestalt an Liebe, daß die weiche Schwärmerin unter ihren »Lauben und Rosen und ihrem Schäfchen, das mit ihr ißt und trinkt«, selbst an eine solche glaubte und den Dichter bedauerte, daß neben einer anderen Neigung in ihr auch die unübersteigliche Mauer des Standesunterschiedes sie trennte. Es war dort die modische Empfindsamkeit in der sublimiertesten und ätherischesten Gestalt zuhause, und für den Dichter war es wie ein Resonanzboden, worin jedes poetische Erzeugnis und jede poetische Regung des Moments verständnisvollen Wiederklang fand. Und unter dieser weiblichen Dreizahl befand sich Herders Braut, die somit zum Wärmeleiter und zur Vermittlerin zwischen dem oft verstimmten Meister und dem vertrauenden Jünger wurde.
Und dieses Zaubernetz, in welchem Goethe sich nicht nur wohl, sondern selig fühlte, das er im Frühjahr 1772 wiederholt als stürmischer »Wanderer« aufsuchte, sollte nun zerrissen werden. Gleichwohl war es nicht bloß das Leidgefühl, das Goethe bewegte, als er der Vaterstadt auf Monate den Rücken kehrte. Vielmehr war es ein gemischtes Gefühl und eine Doppelstimmung. Von Frankfurt selbst, das er gelegentlich eine »Spelunke« nennt, und von der kaum begonnenen, aber von vornherein verhaßten und als Nebensache betriebenen Advokatur, aber auch von dem Vaterhaus und speziell von dem Vater selbst, dem vielfachen Beschränker seiner genialen Lebenswünsche und Gewöhnungen, trennte er sich leicht. Freilich war es gerade des Vaters juristischer Fortbildungsplan, der ihn nach Wetzlar trieb, und die väterliche Hoffnung, er werde dort tiefer in die Rechtspraxis eingeführt werden und dadurch größeren Geschmack an seinem eigentlichen Lebensberufe finden. Trat er damit doch nur in die Fußtapfen des Vaters, der in jungen Jahren gleichfalls den Reichsprozeß an dieser Quelle studiert hatte. Ja es ist nicht unwahrscheinlich, daß der Vater zeitweise noch weitergehende Gedanken an diese Wetzlarer Digression knüpfte, den Wunsch nämlich, daß sich der Sohn vielleicht dauernd dort als Advokat oder Prokurator festsetzen würde. Es war dies wohl ein Reserveplan, wenn der ursprüngliche, sich durch die vaterstädtische Anwaltschaft zu städtischen Ämtern geschickt zu machen, scheitern sollte. War dies des Vaters Plan, so hatte der Sohn schon einen Gegenplan im Kopfe, als er gen Wetzlar zog. Stritten in Frankfurt unter des Alten Augen Themis und die Musen um seinen Besitz, so gedachte er, der väterlichen Kontrolle ledig, in Wetzlar diese Geteiltheit abzuschütteln und der Themis zeitweise Valet zu sagen.
So war der Wetzlarer Sommer auch ideell die natürliche Fortsetzung des Frankfurter Winters, und die Fäden, die beide Zeiten zusammenknüpfen, sind unzerreißbar. Aber es war von Bedeutung, daß Goethe aus dem volleren Strome des Außenlebens in stillere Zustände und in die Möglichkeit strengerer Sammlung und Vertiefung überging. Ja man kann sagen, daß er auch die geistige Atmosphäre, die seinem »Werther« Hintergrund und Stimmung gibt, von Frankfurt nach Wetzlar mitbrachte. In Wetzlar herrschte durchaus eine andere Temperatur, als in Darmstadt-Homburg, wo weibliche Elemente den Ton angaben. Dort war diese weiche, dämmernde, weltschmerzliche, marklose Art zuhause, dieses Lächeln unter Thränen, dieses kränkelnde Schwelgen in verstiegenen Gefühlen. Auch Goethe wurde von der sentimentalen Modekrankheit stark berührt. War er doch mit krankem Herzen aus dem Elsaß und von seiner tiefsten, schuldvoll abgebrochenen Jugendliebe heimgekehrt, und diesem Herzen that die Krankenstubenluft, in der sich so anmutige Pflegerinnen bewegten, ganz wohl. Blieb doch selbst der mannhafte, verstandesscharfe, aber im eigenen Hause nicht glücklich befriedigte Merck nicht frei von der Influenza der Zeit, die gerade in Darmstadt der zweideutige Leuchsenring großziehen half. Bei Goethe schlossen sich diese pathologischen Anwandlungen an die tieferen religiösen Stimmungen, wie sie von der Klettenberg, auch jetzt wieder des Dichters origineller Seelsorgerin, geweckt und genährt wurden. Das innerste Leben Goethes wurde von dieser eigenartigen Mystik getroffen, die in Grundtrieben seiner angeborenen Natur Anschlußpunkte genug fand, und so bildete sich aus Erlebtem und Erlerntem, aus Alchimie und Mystik, aus spekulativen Einzelanstößen und selbstherrlicher Phantasie jenes elementare Chaos, aus dem nur das gestaltende Schaffen den Ausweg finden mochte. Es sind die Elemente und Voraussetzungen, denen die Faustidee, deren erstes Regen der nämlichen Zeit angehört, zum Leben verhalf. Zu den Voraussetzungen gehört aber neben dem dämonischen Universalismus und der Vertiefung in die Geheimnisse alles Lebens die tragische Idylle von Sessenheim und das nach Entlastung verlangende Schuldgefühl, dem die poetische Befreiung näher lag und leichter fiel als die ethische.—
Wenn wir schon in dieser Frühzeit auf das Höchste der Goetheschen Poesie, wenn auch als ein embryonisch werdendes, hinweisen dürfen, so sagt dieser Hinweis genug, welchen Vorsprung schon der Genius vor der gleichzeitigen Litteratur gewonnen hatte. Aber eben dieses Unterscheidende erinnert uns auch daran, daß Goethe sich von der Quintessenz alles Lebenskräftigen, was die deutsche Dichtung der Zeit ihm zutragen konnte, hatte berühren und befruchten lassen: von dem hohen Flug des Odensängers, von Lessings dramatischer Dialektik, von Wielands weltmännischer Eleganz. Aber auch die Emanzipation von diesem Triumvirat, die erst dem Eigenen vollen Raum schafft, beginnt in diesem und den nächsten Folgejahren. Unmittelbar vor der Wetzlarer Reise war »Emilia Galotti« erschienen. Dem tieftragischen Stoff sieht Goethe des Dichters korrekte Geistesklarheit doch nicht völlig gewachsen. Er erklärt das Stück, »so ein Meisterstück es sonst sei«, für »nur gedacht«. Dem Messias-Dichter sagt er allerdings erst 1776 ab und aus Gründen, die nicht in poetischen, sondern in realen Differenzen liegen. Aber im litterarischen Gegensatz bewegte er sich längst, und in gewissem Sinne, wenn auch völlig absichtslos, ist sein Faust ein Anti-Messias. Der Widerspruch gegen Wieland trat wenige Jahre darauf in »Götter, Helden und Wieland« scharf zutage.
Herder aber, nicht selbst Dichter, doch in ahnungsvoller Theorie jene Trias überragend, bildete ein Zwischenglied zwischen dieser und dem Dichter der Zukunft, den er prophetisch vorverkündigte. Es war darum nur natürlich, daß Goethe diesen übermochte, sobald er dessen Programm durch seine Schöpfungen zu That und Leben geführt hatte.