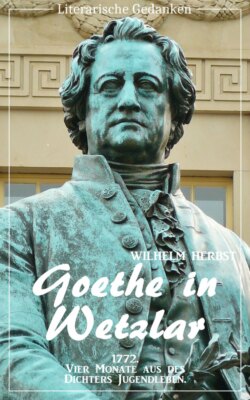Читать книгу Goethe in Wetzlar (Wilhelm Herbst) (Literarische Gedanken Edition) - Wilhelm Herbst - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel II. – Wetzlar.
ОглавлениеNoch vor wenig Jahrzehnten trug das äußere Bild Wetzlars in Stadt und Land ein Gepräge, das uns leichter denn das gegenwärtige an den Zustand der reichsstädtischen und Goetheschen Zeit erinnern konnte. Noch bestand das stille Naturbild des anmutigen Lahnthales unverwandelt und unaufgeregt von den modernen Errungenschaften seines eisernen Zeitalters, den Eisengruben, den Eisenwerken mit ihren Hochöfen und den sich kreuzenden Eisenstraßen; noch war das Innere der Stadt fast getreu geblieben dem längst vergangenen Zustand, denn größeren Konservatismus, oder soll ich sagen größere Stabilität und Stagnation als hier gab es damals kaum anderswo in deutschen Landen. Das Lokal hatte sich mit geringen Änderungen erhalten; man brauchte darum die andersartigen Zustände der Goethe-Werther-Periode, das Reichskammergericht und das Leben der Reichsstadt dem Gebliebenen nur gleichsam einzuzeichnen, um das Jetzt dem Einst völlig ähnlich zu machen. Das ist heute anders geworden. Damals trat der Grundton der Landschaft, das Ineinander von Natur und Geschichte um so reiner und stärker hervor. Ein breites, wiesengeschmücktes Flußthal, sanfte Hügelrücken, unten mit Korn, oben mit Wald bedeckt, überragt von einzelnen charakteristisch geformten, stolzeren Bergen, von denen der Dünsberg und die Basaltkuppe des Stoppelberges zur rechten und zur linken als die Herrscher des Thales sich emporstrecken; der sich in schönen Windungen hinziehende Fluß und, in die Lahn einmündend, die Dill, die den Blick in ein still-anmutiges Seitenthal öffnet, das auch nicht ohne historische Bezüge und Ehren ist. Ersteigt man den Lahnberg auf der linken Flußseite, der einen alten Wartturm wie ein Luginsland auf seiner Höhe trägt und in Goethes Leben wie in Werthers Leiden eine Rolle spielt, so tritt das stimmungsvolle dieser Landschaft alsbald vor das Auge. Nichts in der weiten Umschau imponiert dergestalt, daß es Blick und Sinn gefangen nähme und durch überwältigenden Eindruck dem Sinnen und Träumen keinen Raum ließe, vielmehr schmiegt sich das Äußere dem Inneren weckend und stimmend an; ahnungsvolle Sehnsucht, leise Melancholie, stilles Wohlgefühl finden ihr Echo. Es ist eine tiefpoetische Landschaft und eben darum eine Landschaft für Poeten, von welcher der sinnige Betrachter das Recht von Goethes Lobwort im »Werther«: »ringsumher ist eine unaussprechliche Schönheit der Natur«, und das Wort von den »täuschenden Geistern, die um diese Gegend schweben« gar bald versteht. Das weite Lahnthal schneiden engere Querthäler, darunter das der Wetz, die der Stadt den Namen gab, das bedeutendste. In dieser vielgestaltigen Terrainbildung liegt der Charakter der Landschaft. Nicht viele Gegenden Mitteldeutschlands mögen so reich an Variationen sein wie diese. Hat doch ein besonders bewanderter Kenner des Thales neunzig Spaziergänge mit stets veränderten Aussichtsbildern verzeichnet. Das am meisten Charakteristische ist eben die Verbindung freier Fernsichten mit der knappsten Enge malerischer Nahesichten. Auch die wetterauische Fruchtbarkeit des Thales, die Obstwälder ringsum, die heitere Gartenumgebung gehören zu dem anmutenden Landschaftsbild. Nur die Reben, die vergangene Jahrhunderte, minder anspruchsvoll in ihren Genüssen, auch hier vielfach gepflegt hatten, sind heute so gut wie verschwunden.
Und dieser fesselnde Naturreichtum ist verwachsen mit der Mannigfaltigkeit des historischen Lebens, das überall seine Spuren, seine Reliquien diesem Boden eingedrückt hat. Ja, ein geschichtlich gesättigter Boden überall, wo Römertum und Mittelalter sich in dem Volksglauben wenigstens — und sollte es zum Teil Aberglaube sein — die Hand reichen. Lag doch die Stätte des späteren »Wetafalar« innerhalb des altrömischen Pfahlgrabens. Die der Stadt unmittelbar gegenüber gelegene malerische Burg Kalsmunt führt der Stolz der Bürger, wenn auch mit sehr zweifelhaftem Recht, auf römischen Ursprung zurück; um die Wälder des fernen Dünsberges spielen Sagen von germanisch-römischen Kämpfen. Überall in den Buchen- und Eichenwäldern zerstreut liegen keltische und altdeutsche Grabhügel. Vor allem doch hat die gestaltenreiche und wechselvolle Geschichte des Mittelalters ihre Spuren hinterlassen. Die großen Formen des mittelalterlichen Lebens leben und lebten vollends zu Goethes Zeit ringsum fort. Die Schlösser der kleinen Dynasten krönen die Berggipfel; so Hohensolms und Greifenstein in tiefer Waldeinsamkeit; so das malerische Braunfels, noch heute der stolze Sitz des Fürsten; so Ritterburgen, wie Hermannstein; auf den ferneren Höhen Fetzberg und Gleiberg bei Gießen; so Mönchs- und Nonnenklöster, damals ihrer ersten Bestimmung noch nicht entzogen, unter ihnen vor allem das weithin winkende Prämonstratenser-Frauenkloster Altenberg, die Gründung der heiligen Elisabeth. Und damit nichts fehle von den charakteristischen Reliquien des Mittelalters, so lag um die Stadt mannigfacher Besitz des Deutschordens mit einem Deutschordenshaus innerhalb der Stadtmauern; — für den Goethefreund der wichtigste Punkt Wetzlars.
Das lebendigste Stück Mittelalter ist aber die alte Reichsstadt selbst, und sie war dies damals noch ganz anders wie heute. Sie ist eine Bergstadt, schiefergedeckt, die Straßen klettern die Höhe hinan, mitunter so steil, daß sich die Gäßchen in Treppen verwandeln. Noch standen damals die Stadtmauern mit ihren sieben Türmen nach der Zahl der sieben alten Zünfte unversehrt; noch wurden die alten Stadtthore von ihren Wächtern, den nicht gar martialischen Stadtsoldaten, gehütet. Die Lahnbrücke trug noch ihre beiden Brückenthore. Zwei Warttürme lagen auf den Höhen zu beiden Seiten der Stadt, deren schmales Gebiet durch eine »Landwehr« zum Schutze gegen rasche Reiterangriffe eingehegt war. Im Inneren gab es wenig von architektonischem Schmuck. Immer wiederkehrende Drangsal im dreißigjährigen Krieg und gleichzeitig (1643) zerstörende Feuersbrunst, in der über siebzig der »fürnehmbsten Häuser abgebronnen« waren, hatten ein gut Teil der baulichen Überlieferung des Mittelalters zerstört. Wohl hatte das Reichskammergericht manchen schmucken Neubau gebracht; das achtzehnte Jahrhundert vornehmlich war die Bauzeit für Wetzlar; aber die stattlichen Häuser der Assessoren und Prokuratoren versteckten sich guten Teils in den Winkeln der Straßen. Vor den Bürgerhäusern lagen noch vielfach Düngerhaufen, Kot, Knochen, Austernschalen, darunter, wie ein zeitgenössischer Beobachter berichtet, »noch vieles aus dem vorigen, d.h. also dem siebzehnten Jahrhundert«; und aus den Drachenköpfen an den Giebeln spieen nicht bloß Regengüsse auf die engen, zum Teil ungepflasterten Gassen und auf die Häupter der Passanten. Die gar gelinde reichsstädtische Polizei war auch in diesem Stück überkonservativ. Es ging das Gerede, in Wetzlar seien die Häuser aus Kot gebaut — und in der That gab es nur einzelne massive Steinbauten —, und die Straßen mit Marmor gepflastert, der vor den Thoren gebrochen wurde. So war das Bild der Stadt nichts weniger als ein erfreuliches, und Goethe hatte recht, wenn er im »Werther« die alte Reichsstadt im Gegensatz zu dem Zauber der umgebenden Natur eine »unangenehme« oder in »Wahrheit und Dichtung« eine »kleine und übelgebaute« nennt. Nur das Zentrum der Reichsstadt, der stolze Dom, überragt nicht bloß durch seine Höhe, sondern nicht minder durch den Wert seiner Architektur die Stadt zu seinen Füßen. Der unvollendete und halbruinenhafte Bau zeigt den ganzen Wechsel der Baustile des Mittelalters vom elften Jahrhundert, in das der Ursprung des »Heidenturms« fällt, bis zum Jahrhundert der Reformation. Ob ihm der Dichter, der sich kurz vorher an Erwin von Steinbach berauscht hatte und bald begeistert davon zeugte, irgendein Interesse abgewonnen, davon findet sich allerdings keine Spur.
Ein Blick auf das innere Leben der Stadt darf hier nicht fehlen; es bildet den Hintergrund für des Dichters poetisches Sommerleben.
Wetzlar gehörte zum oberrheinischen Kreise. Auf dem Regensburger Reichstag nahm es den letzten oder vierzehnten Platz der rheinischen Städtebank ein und folgte nach der Reichsstadt Friedberg, mit welcher es nebst Frankfurt und Gelnhausen den wetterauischen Städtebund bildete. Auch den oberrheinischen Kreistag, der damals meist in Frankfurt am Main zusammentrat, hatte es zu beschicken. Ebenso war die Stadt in der Reichsarmee, und zwar mit einem Kontingente von acht Mann zu Fuß, pflichtmäßig vertreten, und zur Reichs-Operationskasse (den sogen. Römermonaten) steuerte sie nach der Reichsmatrikel 32 Gulden. Freilich eine Macht- und Kraftentfaltung, die uns heute lächeln macht; aber solche Impotenzen gehörten eben untrennbar zum alten und hinwelkenden Reichskörper. Es waren absterbende Glieder, die den Leib nicht zu stärken und zu erhalten vermochten. Die winzige Reichsstadt hatte fast kein Territorium — etwa eine halbe Quadratmeile —, sie war vielmehr eng eingeschränkt von den kleinen, der verrosteten Reichsfreiheit keineswegs holden Nachbarstaaten, der Landgrafschaft Hessen-Darmstadt, den Fürstentümern Nassau-Weilburg und Dillenburg, Solms-Hohensolms und Solms-Braunfels. Von einem seiner Warttürme ließ es sich bequem in vierer Herren Länder schauen. Hatte Wetzlar selbst auch niemals eine große geschichtliche Rolle gespielt noch seiner Kleinheit wegen spielen können, doch führte man mit Stolz die Freiheiten der Reichsstadt auf Kaiser Rotbart zurück, und die Überlieferung von dem Afterkaiser Tilo Kolup, der nach der Sage im »Kaisersgrund« sollte gerichtet worden sein, leben noch heute in der Bürgerschaft fort.
Das war Romantik gegenüber der gesunkenen Gegenwart. Die Stadt hatte ihr reichliches Teil an der Fäulnis und Misère, die damals auf allen, zumal den kleinen Reichsstädten lag. Sie waren nur Städte geblieben, als ringsum sich Staaten bildeten, und konnten nur, indem sie wieder Glieder von Staaten wurden, aus der höheren Einheit neues Leben gewinnen. Verarmt, zerrüttet, der eigenen Lebenskraft entbehrend, hatte auch Wetzlar keinen Weg, sich aus sich selbst zu erheben.
Die eingeborene Bürgerschaft, die noch nicht 5000 Köpfe zählte, wurde durch die zugewanderte Bevölkerung des Kammergerichts von etwa 900 Personen durch Besitz, Rang, Bildung, soziale Ansprüche überschattet.
Die mittleren Klassen des Wetzlarer Bürgertums zeigten sich im Gefühl ihrer Abhängigkeit vom Reichskammergericht fügsam und rücksichtsvoll gegen die Wünsche und Ansprüche dieses dominierenden Elementes. Anders stand es mit den unteren Volksschichten, die zwar auch gutenteils ihre Nahrung von jenen höheren Regionen bezogen, denen aber die Bildung und der Überblick abgingen, um deshalb besondere Rücksicht zu nehmen. Überhaupt lag in dem reichsstädtischen Pöbel auch hier ein starker Rest von Trotz und stolzem Selbstgefühl. Die reichsstädtische Polizei ermangelte, wie in fast allen Reichsstädten, der Autorität; das eigene Militär — und welches Militär! — war aus der Bürgerschaft hervorgegangen und darum wenig gefürchtet; das hessische Kontingent aber, das in der Stadt lag, war allezeit ein Gegenstand der Opposition oder der Antipathie für die Gesamtbürgerschaft. Aber auch die städtische Obrigkeit — die beiden Bürgermeister, die Ratsschöffen und Ratsherren — besaß keine durchgreifende Autorität. Gewaltthaten gegen den Stadtrat kamen nicht selten vor. Die Justiz war ohne Kraft. Die Stadt besaß ein Zucht- und Korrektionshaus; man entledigte sich der Verbrecher möglichst bald durch Überlassung an die fremden Werber. Namentlich waren es zwei Punkte, gegen welche sich die Widerstandslust der niederen Volksschichten Wetzlars wiederholt aufbäumte: das unbedingtere Hervortreten des Katholicismus und die Hoheits- und Vogteirechte (seit 1536) des Landgrafen von Hessen.
Wetzlar war (seit 1542) eine streng protestantische Stadt. Die Bürgerschaft wachte eifrig und eifersüchtig über diesen ihren Charakter. Ja sie war wiederholt, während des Abfalles der Niederlande im sechzehnten (1586) und nach Aufhebung des Edikts von Nantes im siebzehnten Jahrhundert, eine Freistatt für niederländische und französische Flüchtlinge geworden. Nun lag es aber in der Natur der Dinge, daß, seitdem die Reichsstadt das Reichskammergericht herbergte, die Forderung der Parität und Kultusfreiheit sich auch zugunsten der Katholiken gebieterisch geltend machen mußte. Das katholische Element erhob stärker das Haupt. Schon bei dem Einzug des Gerichts wurden nicht ohne anfänglichen Widerstand des Stadtrats Bedingungen derart gestellt und schließlich (1692) bewilligt. Und gerade die katholischen Mitglieder des Gerichts, der Chef als der richterliche Vertreter kaiserlicher Majestät an der Spitze, traten durch Rang und Reichtum hervor. Der katholische Gottesdienst fand, wie noch heute, im Chor des Doms statt, wo, um alle Kollisionen zu vermeiden, die Uhren aufgehalten wurden. Auch ein Kloster bestand in Wetzlar selbst und zwar gesetzwidrig, da im Normaljahr 1624 sich noch keine Klöster in Wetzlar fanden. Auch die Jesuiten fehlten nicht; sie hatten ein Kollegium und die gelehrte Schule der Stadt. Doch alles dies ließ sich die Bürgerschaft, da sie es nicht ändern konnte, gefallen. Da aber die Katholiken, auf Grund allerdings des ursprünglichen Abkommens von 1692 und getrieben von jesuitischen Einflüssen, einen Schritt weiter thaten und im Frühjahr 1770 zur Feier der Papstwahl Klemens' XIV. und des von diesem angeordneten Jubiläums wiederholt Prozessionen in Scene setzten, ohne sich auch dabei an die gezogenen Grenzen zu halten, da brach der Unwille des Volkes los, es setzte Schläge und Rauferei, der die Stadtsoldaten und die hessische Besatzung steuern mußten. Die Bürgerschaft hatte das Gefühl, nicht mehr Herr zu sein im eigenen Hause. Kriegerischer als diese Religionskriege en miniature sah der hessische Krieg gegen Wetzlar vom Jahre 1763 aus; an Tragikomik jenem Wasunger Krieg nicht unähnlich, gleich nach dem Ausgang des siebenjährigen, in welchem die hessischen Truppen, namentlich bei Roßbach, keine Lorbeeren erkämpft hatten.
Hessische Händel mit der trotzigen Reichsstadt waren nicht neu, schon 1613 überzog der Landgraf mit 10 Fähnlein Fußvolk und 8 Geschützen die Stadt und brachte die widerwillige zum Gehorsam. Eine ähnliche Fehde endete 1763 mit der Eroberung und Besetzung Wetzlars. Die Stadt hatte damals eine Hessische Besatzung von 123 Mann, die mit den Bürgern gemeinsam das Oberthor bewachten und die Ehrenposten am Reichskammergericht stellten. Hessen hatte neben anderen Hoheitsrechten das Geleitsrecht beim Durchzug fremder Truppen. Die reichsfreien Bürger verlangten dies Recht für sich, und so kam es zu wiederholten Zerwürfnissen. Im Jahre 1763 setzten die Bürger ihr Geleitsrecht mit Gewalt durch und entwaffneten die hessischen Truppen; diesem ersten Exzeß folgte wenige Wochen darauf ein zweiter, sogar von einzelnen Ratsherren geschürt, der mit der Flucht der bedrohten Hessen endete. Aber der Tag der Züchtigung kam. Im Mai 1763 setzte sich ein hessisches Kontingent von über 1700 Mann, Fußvolk, Reiterei und Artillerie, in Bewegung, überrumpelte die Stadt in frühester Morgenstunde und zwang den Stadtrat zu der Erklärung, daß künftig der Friede mit dem Schutzherrn erhalten und demselben größere Ehrfurcht erwiesen werden solle. Die Rädelsführer aus der Bürgerschaft, so weit sie nicht entkommen waren, führte man mit gen Gießen, wo einzelne von ihnen Stockhaus und Schanzarbeit erwartete. Nicht einmal die sacrosancten Personen des Kammergerichts wurden respektiert. Einzelne von diesen, die ohne Gruß an den Siegern vorübergingen, erfuhren brutale Behandlung. Bei Kaiser und Reich fand die gedemütigte und gebrandschatzte Stadt kein Gehör. So war es nach innen und außen kein glänzendes und glückliches Bild, das die Reichsstadt, deren Freiheit nicht leben konnte und nicht sterben wollte, damals bot, wenn auch die Friedensjahre nach dem Schluß des siebenjährigen Krieges auch für sie eine Zeit der Erholung waren.
Seinen sozialen Charakter erhielt das damalige Wetzlar durchaus durch das Reichskammergericht. Man sollte nun denken, Reichsstadt und höchstes Reichsgericht, beide wurzelnd in den Traditionen des alten Reiches, hätten sich als zu einander gehörig harmonisch zusammenschließen müssen. Und dies nicht bloß in der Erinnerung an die gemeinsame Wurzel, sondern auch aus dem Triebe der Selbsterhaltung. Denn der ganze Geist der neuen Zeit, der absolute Territorialstaat, von Preußen am glänzendsten vertreten, widerstrebte jenen hinwelkenden Bildungen, die da standen und fielen mit dem Bestande des Reiches. Zunächst aber gehen wir noch nicht ein auf das Reichskammergericht als Rechtsinstitut, vielmehr beschäftigt uns dasselbe hier nur als der sozial in der kleinen Reichsstadt völlig maßgebende Faktor. Denn von den beiden Elementen der Bevölkerung Wetzlars galt nur das reichskammergerichtliche als die eigentliche Gesellschaft. Das Wetzlarer Bürgertum bildete diesem aristokratischen Elemente gegenüber, obwohl es numerisch etwa fünffach überlegen war, doch kein ausreichendes Gegengewicht. Fast wie Arbeitgeber und Arbeitnehmer verhielten sich zu einander die beiden Bestandteile. Der Bürger lebte eben gutenteils von dem Verdienste, den ihm die Gerichtszugehörigen zuwandten. Es war viel Geld im Umlauf und schuf den meisten Bürgern ein behagliches Leben; aber von Gewerbfleiß und Unternehmungslust regte sich wenig. Ackerbau, Handwerk und Kleinhandel war der Betrieb der Bürgerschaft, von Großhandel zeigte sich keine Spur; ein Patriziat mit altem Besitz und Namen fehlte, die äußerst wenigen altwetzlarer Patriziergeschlechter, die noch nicht ausgestorben waren, wie die v. Klettenberg, v. Rolshausen, waren nach Franken, nach Frankfurt am Main ausgewandert; das Vermögen der Stadt war gering, die Schulden drückend. War doch gerade die Armut der herabgekommenen Reichsstadt achtzig Jahre zuvor der Grund gewesen, das Reichsgericht zu begehren und aufzunehmen, dessen Aufnahme z.B. von dem reichen bürgerstolzen Frankfurt verweigert worden war. Das Reichskammergericht aber brachte an sich schon ein beträchtliches Kapital in die Stadt. Waren der Kammerrichter und die beiden Präsidenten doch Mitglieder des höchsten Reichsadels, deren fast fürstengleiche Stellung sich auch gesellschaftlich ausprägte. Erschien doch der oberste Gerichtschef wie ein Souverän, wenn er aus seiner Wohnung in der oberen Stadt in der vierspännigen Staatskarosse unter dem Vorritt von Läufern in ihrer theatralischen Tracht mit Kaskett und Knallpeitsche, Schuhen und weißen Strümpfen durch die halsbrechenden Gassen zu dem Gericht fuhr, wo die Supplikanten zu Dutzenden ihre Bittschriften hoch hoben. Ein Palais für den Kammerrichter und die Präsidenten, überhaupt nur eine angemessene Dienstwohnung gab es nicht. Die gesellschaftlichen Repräsentationen der meist an Schlösser und Paläste gewöhnten hohen Herren mußte sich in bescheidenen Miethäusern mit bürgerlicher Enge, Knappheit und Niedrigkeit der Räume behelfen. Trotzdem gab der Adel des Gerichts keinen Titel von seinen Ansprüchen und seiner Exklusivität auf. Die spanische Tracht schon, die an die Stelle der französischen getreten war, hob das Erscheinen der Assessoren ab von ihrer Umgebung. Die Genüsse vornehmer Bewirtung, welche die gerngroße Kleinstadt selbst nicht zum Kaufe bot, wurden von dem unfernen Frankfurt am Main verschrieben, wohin wöchentlich dreimal der Köln-Frankfurter Postwagen und einmal die »Kameral-Kutsche« über unchaussierte Naturstraßen — und nur mit großer Anstrengung in einem Tage — fuhr. Nur wer sich auf Wappen und Adelsbrief berufen konnte, hatte unangefochtenen Zutritt in die erste und eigentliche Gesellschaft. Ja es war eine Form der Einladung, zu manchen Ballfesten jeden Adeligen, aber auch nur diese, zu bitten. Die verletzende Ausweisung eines Bürgerlichen, des jungen Jerusalem, die Goethe im »Werther« als mitwirkendes Motiv seiner Dichtung verwendet hat, wie sie ein Motiv der Zerrüttung und des Untergangs Jerusalems gewesen, haben wir unten noch einmal zu berühren. Das ohnehin schon starke Adelselement des Gerichtes wurde noch verstärkt durch die Mitglieder der großen Kammergerichtsvisitation, die überhaupt zu einer Überfüllung der Stadt führte, durch die jungen Praktikanten und Sollicitanten von Adel und durch den steten und starken Zufluß Durchreisender und durch Besuche bei den Edelleuten des Gerichts. In der That war es in dem engen Reichsstädtchen wie ein buntes Stelldichein aus dem gesamten Reichsadel, der sich wie zu einem großen sozialen Turnier hier traf. Die lässige Bequemlichkeit der Österreicher, die unbequeme Straffheit der Preußen, die einen mit gehobenem Selbstgefühl auf ihren Joseph II., die andern mit trotzigem Stolz auf den großen Friedrich schauend, Katholiken und Protestanten, Norddeutsche und Süddeutsche, alle Schattierungen und Gegensätze trafen sich hier auf schmalstem Raum. Den Österreichern und denen »aus dem Reiche« war dieses Reich noch eine volle Realität, die Norddeutschen sahen mit einer Art Ironie auf die abgelebte Hohlheit der Reichsformen. Zugleich hatte diese Aristokratie des Reichsgerichts gesellige Fühlung mit den kleinen Dynastenhöfen der Nachbarschaft. Es versteht sich, daß die Verkehrssprache der bescheidenen Salons die französische war, der Praktikant wurde zum practicien, und als Visitenkarten dienten meist Spielkarten mit der Aufschrift z.B.
de G.
Assesseur de la Chambre
Impériale et de l'Empire
avec son Epouse.
Natürlich fehlte es dieser sozialen Enge nicht an dem haut goût wuchernder Juden, sittenbedenklicher Häuser. Selbst ein genuesisches Lotto tauchte im Anfang der siebziger Jahre für kurze Zeit auf, dessen Gedächtnis noch lange in dem Namen des »Lottohauses« fortlebte. Italienische und französische Sprachmeister, Tanz- und Fechtlehrer, Perückenmacher, Gold- und Silbersticker und was sonst zum Apparat einer residenzartigen Stadt des vorigen Jahrhunderts gehört, fehlten nicht. Im Sommer boten die meist von vornehmen Kammergerichtsbeamten angelegten und zum Teil ungemein malerischen, mit Landhäusern geschmückten Gärten den aristokratischen Zirkeln die gesellschaftlichen Trefforte. Auch außerhalb der Familie war für mannigfache Lustbarkeit gesorgt. Seit 1768 hatte der Gasthof zum Römischen Kaiser einen stattlichen Saal für Redouten und Konzerte hergestellt, der auch zu theatralischen Aufführungen diente. Der Einzug einer Wandertruppe war auch dem Bürger ein Ereignis, und wenn sie auch nur die Schauerdramen mit Dolch, Gift und Ketten oder schwächliche Rührstücke brachte. Und mochte auch bei diesen die Darstellung in der Regel unter aller Kritik sein, so hat gerade in jenen Jahren (1770/71) doch selbst ein Eckhof es nicht verschmäht, sich mit der Ackermann-Seylerschen Truppe auf diesen Brettern sehen und bewundern zu lassen. Die litterarische Nahrung, so weit es deren bedurfte, bezog das damalige Wetzlar meist von dem nahen Gießen, wo der Universitäts-Buchhändler Joh.Phil. Krieger — ein Kuriosum an Vielseitigkeit, denn er vertrieb neben seinen Büchern mit gleichem Eifer Häringe und Lotterielose, war Pferdeverleiher und Speisewirt — schon 1750 eine Lesebibliothek gegründet hatte, die, nicht sehr gesichtet, deutsches und französisches Lesefutter auch nach Wetzlar hin lieferte. Doch gab es auch in Wetzlar selbst eine Buchhandlung, sogar eine Verlagshandlung und Druckerei von E.G. Winkler, in demselben Hause betrieben, worin sich später der junge Jerusalem erschoß. Daran schloß sich eine Leihbibliothek, die als mumienhafte Antiquität aus der Reichskammergerichtszeit noch weit in dieses Jahrhundert hinein fortmoderte. Sie begann mit Talanders (August Bohses) schlüpfrigen Romanen aus dem Ende des siebzehnten Jahrhunderts und zog sich auf gleicher Höhe oder in gleicher Niederung herab bis auf Chr.H. Spieß, Fr. Laun, K.G. Cramer und A. Lafontaine, um endlich des wohlverdienten Todes als Makulatur zu sterben.
Eine Zeitung dagegen besaß die Reichsstadt damals noch nicht. Erst die Wehen der beginnenden Revolutionszeit trieben eine solche seit Mitte 1789 hervor. Gleich die Vignette mit dem doppelköpfigen Adler neben dem blasenden Postreuter zeigt symbolisch den Reichsstandpunkt. Und dies war offenbar auch die dort herrschende und durchschlagende Stimmung. Nach Wien als der Reichsmetropole waren über Frankfurt und Regensburg die Blicke gerichtet; vom Reichskammergericht, dem auch die Zeitung einen breiten Raum widmet, über die Krönungsstadt und den Reichstagssitz zum Kaiser und dem Reichshofrat, von dessen Urteln immer ein Extrablatt der Zeitung handelt.
In Goethes flüchtigem Sommerleben dort wird uns noch begegnen, was die Stadt in der guten Jahreszeit an ländlichen Luftorten bot, bei denen die liebliche Natur weitaus das Beste that. Aber sogar ein »Vauxhall« finden wir in jenen Jahren erwähnt, und an Gartenkonzerten fehlte es nicht. Der ungewöhnliche Fremdenverkehr, zu dem das nahe Gießen auch sein Kontingent an wanderlustigen Studenten stellte, füllte die Gasthöfe und Wirtshäuser. Zählte man doch mitunter an 250 Parteien, die ihre Prozesse persönlich betrieben. Die Bauern kamen aus weiter Ferne in hellen Haufen, in dem guten Glauben, das diene zur Förderung ihrer Rechtssache. Es kam vor, daß solche »Wartboten« unter Androhung von Turmstrafe weggewiesen werden mußten. So bewegte sich allezeit ein ameisenhaftes Menschengewimmel in den engen, steilen Gassen, und man mag bedauern, daß nicht ein Chodowiecki zur Hand war, die bunten Typen festzuhalten. Neben der privilegierten Klasse des hohen Richterkollegiums stand eine zweite Rangklasse, die Prokuratoren, Advokaten, die Protonotarien, Notarien, Sekretäre, Leser d.h. Registratoren, und während die Aristokratie des Gerichts mit der reichsstädtischen Bürgerschaft durchaus keine soziale Fühlung hatte, bestand eine solche wohl zwischen dem höheren Bürgerstande und jenen mehr subalternen Bestandteilen des Gerichts. Diese waren in beträchtlicher Zahl vorhanden — z.B. zählte man zu Goethes Zeit 62 Advokaten und Prokuratoren — und machten sich als solche durch ihre schwarze Tracht auch auf der Straße kenntlich. So sehr auch das Bürgertum in die Ecke gedrängt war, von dem alten reichsstädtischen Trotz und Stolz war, wie wir sahen, wenigstens ein gewisser Unabhängigkeitssinn geblieben, der bis zu den unteren Schichten herab sich gegen Zwang und Unterdrückung wehrte. Es war nur natürlich, daß dem sozialen Alleinrecht des Adels gegenüber sich die Versuchung auch unter den bürgerlichen Richtern regte, sich den Adel zu verschaffen, ja mitunter auch bei zweifelhaftem Recht ihn eigenmächtig sich anzudichten. Aber ein neues unabhängiges Element bildete sich in der Jugend, die als Praktikanten wie als Sekretäre der Visitationsdelegierten in Wetzlar weilten, junge Leute, meist eben von Hochschulen kommend, denen der alte soziale Zopf ein Dorn im Auge war, und die darum ihrer Opposition oft mutwillig und übermütig Luft machten. Hier mischten sich unterschiedslos Geborene und Nichtgeborene in halbakademischer Gleichheit und Brüderlichkeit. Die Praktikanten, junge Volontäre, die sich von der Gunst oder Abgunst ihrer Vorgesetzten ziemlich unabhängig wußten, aus eigener Tasche lebten, fühlten sich wenig gebunden von Autorität und Rücksicht; die jungen Sekretäre aber, wenn auch amtlich strenger verpflichtet, hatten vollends als Zugehörige zu der prüfenden Kommission etwas von deren Geist kritischer Überlegenheit. Diese Kreise werden uns bei Goethes Eintritt in Wetzlar näher treten. Aber auch direkt hielt sich der spottende Gegensatz schadlos für erlittene oder drohende Zurücksetzung. So hat der Dichter Gotter, von dem später mehrfach die Rede sein wird, sich an einem anonymen Pasquill beteiligt, das einen großen Teil der Wetzlarer Gesellschaft, die Damenwelt nicht ausgeschlossen, vor seine scharfe Klinge forderte. Man kann nicht sagen, daß das buntbewegte Treiben der Reichsstadt einen gesunden und frischen Eindruck machte. Es war vielmehr die auf die Spitze getriebene Einseitigkeit einer absterbenden Ständeschroffheit. Der ungemessene Standesstolz, die altfränkische Etikette, die schwerfällige Pedanterie und das zopfige Zeremoniell an dem Sitze des höchsten Reichsgerichts waren fast sprichwörtlich. Goethe hat, da er nur das freiere Sommerleben dort verbrachte, jenen sozialen Zwang und Druck nicht unmittelbar empfunden, gleichwohl haben sie auf ihn gewirkt. Sein »Werther« ist des Zeuge. Auf größerem Schauplatz konnten sich diese sich abschließenden Gegensätze entfalten, ohne sich auf Schritt und Tritt zu stoßen; hier aber auf engstem Raum erschienen sie entweder verletzender oder (in den Augen der sich freier Fühlenden) hochkomisch. Allerdings zeigten kleine deutsche Höfe der Zeit ähnliche Karikaturen. Aber immerhin lag dort im Fürsten selbst ein Regulator, der die ständischen Standesgegensätze, wenn nicht ausglich, so doch milderte, und unter den sogen. aufgeklärten Fürstenpersönlichkeiten der Zeit gab es manche, die auch eine Geistesaristokratie anerkannten und großzogen. Von dem allen kannte Wetzlar nichts. Es war darum ein soziales Unikum im Reiche, wohl verhältnismäßig die größte Anhäufung aristokratischer Elemente, vielleicht noch am nächsten kommend den inneren Zuständen der fränkischen, rheinischen, westfälischen Bistümer, wo der Landesadel sich in fast erblichem Besitz der Domstifter und Prälaturen wußte und in sklavischer Nachahmung des französischen Geschmacks in Tracht und Tafel das Äußerste that. Nur daß in Wetzlar, wo noch weniger bloß lokaler Adel saß, sondern der Adel des gesamten Reiches vertreten war, die Mischung eine weit buntere sein mußte. An barocken Originalgestalten konnte es nicht fehlen, an denen sich der Witz und Humor der Jugend rieb; ja noch ein Menschenalter nach dem Ende des Reiches und Reichskammergerichts schlichen einzelne dieser altgewordenen Reichskammergerichtsfiguren wie Revenants durch die stillgewordenen Straßen der weiland Reichsstadt. Auch der »Werther« verfehlt nicht, des Barockstils der Garderobe zu gedenken, wo »Reste des Altfränkischen mit dem neust Aufgebrachten kontrastieren«, und in der exklusiv adeligen Gesellschaft, in der Werther zu sozialem Fall kommt, einen Baron »mit der ganzen Garderobe von den Krönungszeiten Franz' I. her« vorzuführen. Der große Strom des deutschen Lebens, das sich damals gerade in den Friedensjahren nach dem siebenjährigen Kriege mit neuem Lebensgehalte füllte, ging nicht durch Wetzlar. Nur wenige Jahre nach Goethes Aufenthalt bezeugt (am 20. November 1777) der Freiherr vom Stein in einem ursprünglich französisch geschriebenen Briefe an seinen Freund v. Reden den dort herrschenden kleinlichen Gesellschaftsgeist: »Im übrigen ist der Aufenthalt in Wetzlar auf die Dauer recht langweilig, denn der gesellige Ton ist steif und bürgerlich, und man findet sehr wenig Einklang. Ein Ort, wie dieser, wo wichtige Angelegenheiten verhandelt werden, muß immer geteilt sein und es finden sich dort notwendig Parteien, welche von einander unabhängig ihre Feindschaften selbst auf die Vergnügungen erstrecken. Kennt man die Lage der Dinge, so weiß man vorher, wer zu einem gewissen Gastmahl gehören, wer in einer gewissen Gesellschaft zugelassen, wer davon ausgeschlossen sein wird. Alles dieses verscheucht die Einigkeit aus den Gesellschaften, macht sie weniger angenehm, verbannt daraus Leichtigkeit und Wohlbehagen und beengt bisweilen den Fremden, der auf beiden Seiten achtungswerte Menschen findet und sich ihnen nicht nach seinem Geschmack hingeben kann. Zudem besteht unsere Gesellschaft allein aus Rechtsgelehrten, deren Beruf durch die Masse der Begriffe, womit er das Gedächtnis belastet, den Geist ermüdet und alle Einbildungskraft erstickt — woraus man leicht folgern kann, daß unsere Männer nicht gerade zu den liebenswürdigsten gehören. Unsere Weiber sind größtenteils Kleinstädterinnen, denen der Kaiser durch das Adeln ihrer Männer nicht auch ihren kleinen kreischenden, kleinlichen, förmlichen Ton genommen hat. Vergebens also sucht man bei uns höfliche, unterhaltende Menschen voll Aufmerksamkeit — sondern man findet sie entweder in einer Ecke über ihre Rechtshändel sprechend, oder die Karten in der Hand, und sie nehmen die Artigkeit, welche man ihnen erzeigt, entweder mit einer unpassenden Rauhheit, oder mit lächerlicher Verwirrung auf, oder finden keine Worte, sie zu erwidern. Kurz, Wetzlar hat die Mängel der kleineren Städte, in einer großen Stadt erzeugt der Zufluß der Menschen einen lebhaften allgemeinen Wetteifer, von den Fehlern der Personen, aus denen die Gesellschaft besteht, kennt man manche nicht und vergißt viele; oder hier wird alles strenge, oft falsch beurteilt und macht dauernde Eindrücke. Da ich zum Arbeiten unter einem kenntnisreichen und verdienstvollen Assessor zugelassen bin, und aus den Senatsprotokollen Gelegenheit habe, meine Kenntnisse zu erweitern durch Untersuchung der merkwürdigsten Rechtsfälle, welche das Gericht entschieden hat, so wird mir dadurch der Aufenthalt angenehm und die hier verlebte Zeit kostbar... Außer dem Reichskammergerichtsprozesse macht die Zahl der hier zur Entscheidung kommenden Fälle das Rechtsstudium anziehender und giebt der Theorie das für die Ausübung erforderliche Leben...« Wenn sich die adelige Gesellschaft nach der bürgerlichen Seite hermetisch abschloß, so ging es bei ihr nach innen doch keineswegs immer harmonisch und friedlich zu. Gerade weil es in ihr, deren Leben sich um sich selbst drehte, an Inhalt, an großen Lebensinteressen aus Politik oder Litteraur gebrach, war die moralische Luft geschwängert von Klatsch, Intrigue und jeder Art sozialer Nichtigkeit. Vor allem nährten die Frauen diesen kleinlichen Geist. Der um siebzehn Jahre zurückliegende Fall steht nicht allein da, wo ein Assessor des hohen Gerichts sich in einem Promemoria öffentlich beklagt, auf dem von dem hochfürstlichen Herren Kammerrichter gegebenen Fastnachtsball hätte die Frau Präsidentin öffentlich deklariert, ihre Tochter als stiftmäßiges Fräulein habe das Recht des Vortanzes vor sämtlichen Assessorsfrauen; ja sie hätte »selbige sogar Seiner Hochfürstlichen Durchlaucht erstem Hof-Cavalier von der Hand und Stelle weggezogen«. Darnach aber hätte »jeder unstiftmäßige Cavalier, Er stehe in einem Character, wie Er wolle, sogar jeder Cammer-Gerichts-Præsident selbst, wenn er nicht just Stiftmäßig, einem jeden Stiftmäßigen Kind in der Wiegen schon den Vorzug zu gestatten«. Vorgänge aber, wie jenen Ballskandal, unwidersprochen zu dulden, das würde
»der Authoritaet dieses Höchsten Reichs-Gerichts und jedem dessen Mitglied (sic) aber viel zu verkleinerlich« sein. Ganz anders noch wurde dieser Geist sozialer Disharmonie geweckt und gereizt, seit die große Gerichtsvisitation Mitglieder des Richterkollegiums selbst auf die Anklagebank gebracht und die Integrität anderer zeitweise in Zweifel gezogen hatte. Es werden uns diese Skandale unten begegnen. Diese Kontrolle, die zugleich einer Revisionsinstanz gleichkam, setzte natürlich in den Augen des Publikums die Autorität des Kammergerichts und nicht bloß zeitweise herab. Die Rivalität erstreckte sich auch auf Außendinge. Der kaiserliche Prinzipalkommissarius an der Spitze der Visitation, der regierende Fürst Karl Egon von Fürstenberg-Stühlingen, hielt mit dem zweiten Kommissarius, dem verdienstvollen Freiherrn Georg v. Spangenberg, am 11. Mai 1767 seine erste Auffahrt in einem sechsspännigen Staatswagen, der von Fürstlich Fürstenbergschen Hofkavalieren zu Pferd und der sämtlichen Dienerschaft in Gala begleitet war. Man muß das Terrain und die steilen Gassen der guten Reichsstadt kennen, um das Wagnis solcher Prachtentfaltung zu würdigen. Aber der Kammerrichter mußte doch überboten werden. Alle Glocken läuteten, die wetzlarische Bürgerschaft wie die darmstädtische Besatzung machten die Honneurs. Selbst in den Frieden der Kirche drängte sich die Rivalität. Man stritt, wer im Kirchengebet den Vortritt haben solle, das Kammergericht oder die Visitatoren, bis das Erzmarschallamt für die letzteren entschied.
In diese Tage und Stimmungen fiel Goethes kurzes Verweilen in Wetzlar und am Reichskammergericht.