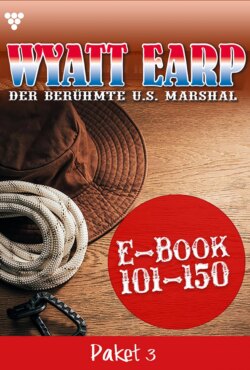Читать книгу Wyatt Earp Paket 3 – Western - William Mark D. - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDer Tod des Richters war beschlossene Sache. Und was die Galgenmänner einmal beschlossen hatten, führten sie auch durch – um jeden Preis.
Der eine der beiden Männer, die diesen Auftrag durchzuführen hatten, steckte im Gefängnis von Tombstone. Es war der Mestize Batko. Wyatt Earp hatte ihn ins Jail bringen lassen. Und dieses Jail wurde von Jonny Behans Helfer Imre Koreinen bewacht.
Als der Bandit Halman Somers, der von dem Boß der Galgenmänner den Auftrag hatte, den Richter zu töten, in der Nacht in die Stadt einritt, suchte er Rozy Gingers Bar auf.
Zwei Männer standen noch bei der hübschen, etwas verlebten jungen Frau an der Theke, und das Orchestrion wimmerte zum zwanzigstenmal den Arizona Doodle.
Rozy Gingers riß die Augen sperrangelweit auf, als sie Somers sah.
»Hal, Sie?«
Der Mann schlug den Staub aus seinem Hut drinnen in der Schenke an einem Eckpfeiler aus und kam an die Theke.
»Ja, ich, Rozy. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen!«
Die Frau blickte verstört in das häßliche Gesicht des Desperados. Wußte sie doch, daß er nach seiner Verurteilung vor zwei Tagen mit den anderen Tramps zusammen von Hilfssheriff Behan nach Phoenix ins Straflager gebracht werden sollte. Nun war zuerst Batko zurückgekehrt – und jetzt kam auch er.
»Wo ist Batko?« schnarrte Somers heiser.
Die beide Männer, die an der Theke gelehnt hatten, drehten jetzt erst die Köpfe nach ihm um. Der eine von ihnen hatte ein blaurotes wildes Gesicht und gelb glimmende Augen. Es war Phineas Clanton, der Bruder des einst so berühmten und gefürchteten Bandenführers Ike Clanton. Der andere Mann war James Curly Bill Brocius.
Als Somers die Augen Phins auf sich gerichtet sah, hielt er unwillkürlich inne.
»Ich… bin zurückgekommen, Phin«, stotterte er.
Der sah ihn nur an, sagte aber nichts.
»Weil der Auftrag noch nicht ausgeführt ist. Und Batko – er müßte schon in der Stadt sein…«
»Yeah!« schnarrte James Curly Bill heiser, »er ist schon in der Stadt. Und zwar schon eine ganze Weile. Er war so gescheit wie du und stürzte gleich in eine Schenke, wo er prompt in eine Schießerei geriet, aus der ihn sich der Marshal herausgeholt hat.«
»Was… soll das heißen?« stammelte Somers.
»Er sitzt im Knast, Mensch!« giftete ihn James Curly Bill an.
»Im Jail?«
»Yeah, im Jail. Und Behans Helfer bewacht ihn. Jonny Miller sitzt im gleichen Stall.«
Somers, der den Blick nicht von Phin Clanton wenden konnte, entgegnete: »Ich hole ihn heraus. Batko und ich haben einen Auftrag auszuführen, der ausgeführt wird.«
Er sagte es und dachte dabei: Ich habe ja gar keine andere Wahl. Denn wenn ich den Auftrag nicht durchführe, wird er morgen an mir durchgeführt. Unten im engen Hof meines Elternhauses wird ein Galgen stehen, und ich werde irgendwo im Haus, im Hof oder in der Scheune mit einem Messerstich im Rücken liegen…
Zehn Minuten später stand er ganz plötzlich im Marshals Office vor Koreinen.
Mit dem Revolver in der Hand.
Der Deputy blickte ihn entgeistert an. »Somers?«
»Ja, Boy!« preßte der Verbrecher durch die Zähne.
»Sie sind auf dem Transport entsprungen! Wo ist Behan? Was ist mit ihm geschehen? Batko ist auch entsprungen!«
»Halt keine Reden, Mensch. Hol den Schlüssel!«
»Was wollen Sie?«
»Batko!«
»Batko? Aber… ich bitte Sie! Wyatt Earp selbst hat ihn festgesetzt, wegen…«
»Das interessiert mich nicht, Boy! Hol ihn raus! Und zwar sofort, sonst bist du bereits am Ende deines Lebens angekommen.«
Der Hilfssheriff Imre Koreinen war dreiundzwanzig Jahre alt. Er nahm seinen Job ernst, ein wahres Wunder bei einem Boß wie er ihn hatte. Denn Sheriff Behan, der im Grunde selbst nur Hilfssheriff war, gab ihm kaum ein gutes Beispiel. Hatte es doch sicher im Westen keinen zweiten Sheriff wie diesen Jonny Behan gegeben, einen Gesetzesmann, der so lasch war, so lau, so schwach und wankelmütig und der sich doch so lange hatte halten können wie gerade dieser Mann. Daß Behan sich so lange hatte halten können, war allerdings nicht sein Verdienst. Es gab eine Front in Tombstone, die diesen schwachen Mann brauchte, eben weil er so schwach war. Die Front der Desperados.
Koreinen, der nichts über die Hintergründe um Jonny Behan wußte, entgegnete rauh: »Somers, ich muß Sie festnehmen.«
»So? Festnehmen? Du Verrückter! Fahr zur Hölle!« Da surrte die Klinge schon auf den Gesetzesmann zu, traf ihn in die Brust und riß ihn nieder.
Röchelnd sank er gegen den schweren Schreibtisch Virgil Earps und fiel rückwärts auf den Boden.
Somers warf kaltherzig einen Blick auf ihn, stürmte dann über den Niedergestochenen hinweg, riß den großen Ring mit den Schlüsseln an sich, rief mit halblauter Stimme: »Batko!«
Der Mestize federte von seiner Pritsche hoch und lauschte in die Dunkelheit. War das nicht die Stimme seines Kumpans?
»Hal?« fragte er noch ungläubig.
»Ja! Wo steckst du?«
»Hier, in der dritten Zelle!«
Somers probierte einen Schlüssel nach dem anderen. Seine Hände begannen zu zittern. Dicker Schweiß perlte auf seiner Stirn; denn er wußte ja, in wessen Office er hier eingedrungen war.
»Los, beeil dich doch!« forderte ihn der Gefangene ungeduldig auf.
»Mensch, mach mich nicht nervös! Ich finde den Schlüssel nicht!«
»Wenn du noch länger suchst, kannst du gleich hierbleiben. Wyatt Earp kann jeden Moment zurückkommen. Er hat mich eingelocht.«
»Ist es meine Schuld?« keuchte Hal. »Du hast ihn schließlich so schlecht mit dem Gewehrkolben getroffen, nicht ich.«
»Was ist mit Koreinen?« fragte Batko heiser.
»Der Deputy? Ich habe ihn aus dem Weg räumen müssen.«
»Tot?«
»Stumm, ja.«
Endlich paßte ein Schlüssel, knirschend sprang das Schloß auf.
Batko stieß die Tür auf und rannte hinaus. Vorn im Office brannte noch die kleine Lampe. Er löschte sie sofort, ohne den am Boden liegenden Mann eines Blickes zu würdigen.
»Und jetzt nichts wie weg!« krächzte der Mestize, als er seine Waffen wieder an sich gebracht hatte.
Sie verließen das Office durch die Hoftür, denn es war ja nicht ausgeschlossen, daß der Eingang doch bewacht wurde. Zwar würde dann auch Somers gesehen werden, aber das war jetzt unwichtig. Sie mußten zusehen, daß sie unbemerkt davonkamen.
Kurz darauf tauchten beide in Rozy Gingers Saloon auf.
Immer noch lehnten die beiden Zecher an der Theke.
Triumphierend rief Somers in den Schankraum: »Den ersten Teil habe ich erledigt!«
Der Mann, dem er das mitteilen wollte, nämlich Phin Clanton, drehte sich nicht um.
Dafür aber rollte James Curly Bill Brocius sich herum und stierte den beiden aus glänzenden Augen entgegen.
»Ah, da seid ihr vier ja wieder…«
Phin stieß ihm den Ellbogen so derb in die Seite, daß er zurücktorkelte.
»Du bist dran, Idiot.«
»Womit?« krächzte James.
»Mit der nächsten Runde!«
»Ach ja, Rozy, geben… geben… geben… Sie uns noch… n… och ein... ein Doppeldrink… Doppel…«
»Halt’s Maul!« fauchte Phin ihn an. »Sie hat schon verstanden, die Schöne!« Er hob den Schädel und blickte aus glasigen Augen auf die Wirtin.
Rozy Ginger zuckte unter diesem wilden, begehrenden Blick des Mannes zusammen. Sie hatte Angst vor diesem Phineas Clanton. Es hatte einmal eine Zeit gegeben, wo dieser gefürchtete Mann um sie geworben hatte. Zwar nicht wie ein Gentleman – mit netten Worten oder gar Liebesbriefen – aber der Cowboy hatte sie zur Frau haben wollen.
Sie hatte den alkoholsüchtigen, streitsüchtigen und unberechenbaren Phineas Clanton abgewiesen, obgleich sie befürchten mußte, sich die Rache dieses Mannes, all seiner Freunde und jener Männer, die Angst vor ihm hatten, zuzuziehen.
»Nicht wahr, Miß Rozy«, stieß Phin jetzt mit schwerer Zunge hervor.
Die Frau dachte daran, daß er einmal ein gutaussehener Mann gewesen war, daß sich die Mädchen in der Stadt nach ihm umgesehen hatten. Aber sein wüstes Leben hatte ihm sein gutes Aussehen geraubt. Trotz seiner einunddreißig Jahre – älter war er noch nicht – wirkte er verbraucht, schwammig, vorzeitig gealtert.
Nur die Angst der Menschen vor dem Clanton war geblieben.
Rozy schenkte ein.
Man hatte sie den ganzen Abend über in Ruhe gelassen und nur getrunken. Plötzlich aber schoß Phins Rechte über das Thekenblech, umspannte das linke Handgelenk der Frau und preßte es, daß die Saloonerin leise aufschrie.
»Rozy!« Er lachte zynisch.
Sie sah in seine gelblichen rotunterlaufenen Augen.
»Lassen Sie mich los, Phin!«
»Sag Darling!« krächzte er.
»Nein!«
Da glühte es gefährlich in der Tiefe seiner Augen auf.
»Ich möchte wissen, zu wem Rozy Ginger Darling sagt!« steigerte er sich in seinen Zorn hinein.
»Lassen Sie mich los!«
»Vorwärts, rede!«
»Sie sollen mich loslassen…«
Da schleuderte er ihre Hand zurück und stieß ein wildes barbarisches Gelächter aus, das die beiden nüchternen Tramps vorn an der Tür erzittern ließ.
Es war das ungebärdige Lachen der Clantons. So hatten sie Ike früher lachen hören und auch Billy, dessen junges Banditenleben vor zwei Jahren im O.K. Corral geendet hatte.
Plötzlich wirbelte Phin herum.
In jeder Hand einen seiner großen Hampton-Revolver. Er fletschte die Zähne und schrie Batko und Somers an: »Was steht ihr da und gafft, ihr Hunde!«
Die beiden rührten sich nicht. Der Schreck schien sie versteinert zu haben.
»Raus!« donnerte Phin ihnen entgegen.
Diese Aufforderung ließen sie sich nicht zweimal sagen.
Als sie kehrtgemacht hatten, jagte Phin jedem zwei Schüsse nach, die ihre Stiefelabsätze aufrissen.
Weder Batko noch Somers hatten den Mut, dem angetrunkenen Schützen zu antworten.
Mit welch unheimlicher Bewegungslosigkeit er plötzlich dagestanden hatte, der gleiche Mann, der eben noch so schwer angetrunken schien! Wieder einmal hatte er ihnen bewiesen, wie gefährlich und unberechenbar er war, der zweite Clanton.
Batko und Somers stahlen sich davon und gingen auf das Courthouse zu, um endlich ihren »Auftrag« auszuführen, der nicht mehr aber auch nicht weniger von ihnen forderte, als den Tod des Richters.
Als sie den Platz erreicht hatten, blieb Somers stehen.
»Der Galgen ist verschwunden!«
»Na und, wundert dich das? Glaubst du, der Marshal ließe die Dinger als Schmuckstücke für die Stadt stehen.«
»Aber es ist doch Vorschrift…«
»Was ist Vorschrift?« unterbrach ihn der Mestize brüsk. »Vorschrift ist nur, daß der Galgen aufgestellt werden soll. Das ist geschehen. Mir ist nichts darüber bekannt, daß er zweimal aufgestellt werden muß. Vorwärts, wir haben in der Schenke schon zuviel Zeit verloren! Wenn sie den Toten im Office finden, ist die Hölle in der Stadt los!«
Mit raschen, huschenden Schritten überquerten sie den kleinen Platz vorm Courthouse und starrten auf das große Haus, in dessen rechten Flügel die Wohnung Richter Gordons lag…
*
Der Marshal hatte sich nach einem Bad in seinem Zimmer zur Ruhe begeben.
Nelli Cashman, die Inhaberin des Hotels, stand auf dem Flur vor der Zimmertür des Missouriers und sah Doc Holliday an, der ihr gegenüberstand.
»Er hat anscheinend Scheußliches durchgestanden?«
»Darauf können Sie sich verlassen«, entgegnete der Spieler. »Aber wie ich ihn kenne, schüttelt er das in einer Nacht ab. Er muß nur schlafen.«
Die Frau nickte und ging mit dem Georgier in die Halle.
Da saß der riesige Texaner Luke Short, kniff das linke Auge ein und blinzelte durch den Rauch seiner Strohhalmzigarre auf das Kartenblatt, das er sich selbst gelegt hatte.
Als er Holliday entdeckte, rief er: »Ah, da kommen Sie ja, Doc! Wollen wir eine Runde spielen?«
Der Spieler schüttelte den Kopf.
»Ich habe aber noch keine Lust, mich schon hinzulegen«, meinte der Tex bedauernd.
»Die Absicht hatte ich auch nicht. Im Gegenteil, ich werde noch einmal ins Office gehen«, versetzte der Spieler.
Short stand sofort auf.
»Ist mir auch recht. Nur noch nicht die Koje!«
Sie verließen das Russian Hotel und gingen zur Allenstreet hinauf.
Holliday blieb sofort stehen, als er einen Blick auf die gegenüberliegende Häuserfront geworfen hatte. Das fünfte Haus war das Marshals Office.
»Was ist los?« fragte der Hüne, der auch stehengeblieben war.
»Wahrscheinlich der Teufel«, entgegnete Holliday leise. »Das Licht im Office ist aus!«
»Und?«
»Wyatt hatte dem Deputy aufgetragen, es unter keinen Umständen verlöschen zu lassen.«
»Stimmt!« erinnerte sich Luke. Dann rieb er sich das Kinn.
»Ist es richtig, wenn ich diesmal den Part des Marshals übernehme und von vorn komme, und Sie wie immer durch die Hintertür marschieren?«
»Ja. Aber warten Sie drei Minuten!«
Der Riese ließ drei Minuten verstreichen, betrat dann den Vorbau, zündete ein Stück Zeitung an, trat die Tür auf und warf das brennende Blatt in den Raum.
Beide Türen standen offen, zum Hof und zum Zellengang.
Und am Boden lag der Hilfssheriff Imre Koreinen.
Luke sprang ins Büro, löschte das Papier und zündete die Lampe an. Dann rannte er in den Zellengang, stoppte aber sofort wieder, als er die offene Gittertür sah.
»Damned, Wyatt wird sich freuen.«
Als er zurückkam, sah er den Georgier schon neben dem Deputy knien.
»Tot?« fragte er nur mit belegter Stimme.
Holliday richtete sich auf.
»Nein. Aber er hat einen lebensgefährlichen Messerstich direkt neben dem Herzen…«
»Soll ich Ihre Tasche holen?« Luke war schon an der Tür.
Holliday nickte.
»Das wäre gut.«
Schon tigerte der Riese los und kam nach wenigen Minuten mit der Instrumententasche zurück.
Holliday blickte ihm entgegen. »Und wenn Sie mir jetzt noch einen Gefallen tun wollen, Luke…«
»… dann gehen Sie zum Courthouse«, beendete der Texaner den Satz des Gamblers.
»Genau!«
»Dachte ich mir auch schon!«
Er stellte die Instrumententasche Doc Hollidays ab und lief hinaus.
Zu lange hatten sich die beiden Galgenmänner bei Phin Clanton aufgehalten.
Als sie über den Platz des Courthouses gingen, wartete das Verhängnis schon auf sie. Kurz vor dem Zaun federte der Texaner plötzlich hoch.
Der Revolverhahn klickte.
Somers riß sofort die Arme hoch.
Aber der Mestize wollte sich herumwerfen, um zu flüchten.
Er hatte sich aber gewaltig in den überlangen Armen des Texaners verrechnet. Ein schneller Hieb mit dem Coltlauf streckte ihn nieder.
Diese Bewegung des Gegners suchte Halman Somers rasch auszunutzen. Er sprang zur Seite und griff zum Colt.
Auch er hatte Pech!
Luke Short erwischte ihn mit der Linken – und wie leere Säcke schleppte er die beiden Männer zur Allenstreet hinunter.
Die Banditen kamen rasch wieder zu sich.
Der Tex hatte sie entwaffnet und schob sie vor sich her.
»Keine dummen Einfälle, Boys, sonst gibt’s Ausfälle!«
Sie dachten gar nicht mehr daran, zu flüchten. Zu hart war die Handschrift des Hünen.
Doc Holliday hatte die Wunde des Hilfssheriffs gereinigt und mit einem Verband versehen. Er blickte verblüfft auf, als der Texaner mit den beiden Gestalten ankam.
»Hier sind unsere beiden Freunde, Doc. Somers ist auch zurückgekommen. Er hat beschlossen, lieber mit seinem Freund Batko zusammen hier den Weg zum Galgen anzutreten. Offenbar empfehlen sich die Halunken stückweise bei ihrem Betreuer Behan.«
Jeder wurde in eine Zelle für sich gesperrt, und dann wünschte ihnen der Texaner freundlich eine angenehme Nachtruhe.
Doc Holliday war gerade damit beschäftigt, den Deputy unter den Armen zu packen, um ihn aufzurichten.
Short half ihm dabei. Sie trugen Koreinen in die Schlafkammer des Deputys hinter dem Office, wo sie ihn auf eine Pritsche niederließen.
»Wie sieht’s aus?« fragte Luke, hob die Lampe und warf einen forschenden Blick in das kreidige Gesicht des Deputys.
»Sehr schlecht. Ich habe alles getan. Kommt jetzt auf ihn selbst an, auf seine Natur…«
Am nächsten Morgen war der kleine Hilfssheriff Imre Koreinen tot.
Mit finsterer Miene stand Doc Holliday neben seinem Lager und blickte auf ihn nieder.
Der Texaner stand hinter ihm und preßte einen Fluch durch die Zähne.
Die beiden hatten abwechselnd im Office gewacht.
Einer hatte immer nebenan in Virgils ehemaliger winziger Schlafkammer geruht.
»Das ist eine schöne Überraschung für den Marshal«, meinte der Texaner.
Da wurde die Tür des Office geöffnet.
Luke Short verließ den Schlafraum und trat ins Büro.
Vorn in der Tür stand Wyatt Earp.
»Na, Sie Nachtschwärmer! Ist der Doc auch hier?«
»Ja.«
Wyatt zog die Brauen hoch. »Ist was mit dem Deputy?«
»Ja. Er ist tot.«
»Tot…?«
»Somers hat ihn niedergestochen, um Batko zu befreien. Ich habe die beiden Schufte vorm Courthouse abgefangen.«
Wyatt ging durch die offenstehende Tür in die Deputy-Schlafkammer, in der je zwei übereinanderstehende Betten standen.
Holliday blickte ihm düster entgegen.
»Ich habe ihn leider nicht retten können.«
Wyatt schüttelte den Kopf. »Sie geben keine Ruhe, diese Schurken! Aber wartet, wir kriegen sie schon. Einer nach dem andern wird jetzt eingelocht. Richter Gordon verhandelt jeden einzelnen Fall sofort, und dann bringt einer von uns sie ins Straflager. Das heißt, Somers kommt hier an den Strick, davor wird ihn niemand mehr retten. Und dann kaufe ich sie mir einzeln. Einen nach dem anderen. Mit Kirk McLowery fange ich an.«
Koreinens Bruder Ed stellte sich zur Verfügung, Batko nach Phoenix zu bringen. Daß er ihn sicher hinbrachte, konnte Wyatt glauben, denn Ed Koreinen würde den Freund des Mannes, der seinen Bruder Imre getötet hatte, nicht schonen.
Halman Somers wurde zum Tode verurteilt.
Die Vollstreckung des Urteils wurde in Tombstone durchgeführt.
Es hätte ein Schock für die Galgenmänner sein müssen – aber es war keiner.
Im Gegenteil, es zeigte sich sofort, wie schattenhaft, wie unangreifbar und wie gefährlich die Bande wirklich war.
Niemand war aufzufinden!
Auch in Kirk McLowerys Quartier war alles ausgeflogen.
»Ich hole ihn«, erklärte Wyatt, »und wenn ich deshalb ins San Pedro Valley reiten müßte!«
Luke Short rieb sich den Nacken.
»Auf die McLowery Ranch? Das wird ein schönes Banditennest sein. Am besten wird es sein, da nachts anzukommen.«
»Leider muß ich vorher noch ein Wort mit Oswald Shibell reden. Ein Glück übrigens, daß ich Jonny Miller in Behans kleines Jail gesteckt habe. Da hat ihn niemand gesucht. Richter Gordon wird ihn ebenfalls dem Henker überantworten. Wahrscheinlich hat er nicht nur Ernest Pilgram getötet!«
In der Stadt war aufgeräumt.
Die Mörder waren erledigt, der Richter verreist – und die Galgenmänner ausgeflogen.
Wyatt Earp, Luke Short und Doc Holliday ritten aus der Stadt.
Bei der kleinen Pferdewechselstation Hawkinsfield hielt der Marshal an.
Alle drei stiegen von den Pferden, und Wyatt sagte laut: »Luke, Sie reiten zuerst zurück. Die Leute in der Stadt haben uns wegreiten sehen. Sie werden die Banditen benachrichtigen. Und dann sind Sie bereits in der Stadt. Wir kommen ebenfalls auf einem Umweg zurück.«
Die beiden blickten ihn verblüfft an.
Wyatt trat auf den kahlköpfigen Stationshalter zu und bat ihn unter dem Vorwand um eine Nagelzange, daß sich bei seinem Falben hinten rechts ein Hufnagel gelöst habe.
»Natürlich, sofort!« rief der Alte und eilte ins Haus.
Während Wyatt den Huf des Falben betrachtete, erklärte er leise: »Sie reiten jetzt einen Bogen nach Osten, Luke, bis diese alte Schleiereule Sie hier nicht mehr sehen kann und folgen uns dann.«
Holliday lachte, er hatte sofort begriffen. Doch der Tex fragte: »Und…?«
Aber dann feixte auch er.
»Der Alte gehört dazu, he?«
»Früher jedenfalls war er ein Hehler der Clantons. Ich kann mir nicht denken, daß sich dieser alte Bursche geändert hat. Als ich ihn vorhin sah, dachte ich sofort: Den spanne ich ein. Die Stadt soll glauben, wir kämen zurück. Das wird den Übermut der Banditen etwas dämpfen.«
Da kam der Alte mit der Nagelzange heraus und reichte sie dem Marshal.
Wyatt hantierte damit am rechten Hinterhuf seines Tieres herum und gab sie dem Alten mit einem Dankeswort zurück.
Sie stiegen auf und ritten weiter.
Luke Short sprengte nach Osten davon.
Mit listigen Äuglein sah ihm der alte Stationshalter Morton nach, dann wandte er sich um und humpelte zum Corral hinüber, wo ein einäugiger Mann Holz spaltete.
»Ric, reite in die Stadt! Du muß bei Rozy Ginger nach Cass Claiborne fragen.«
»Und?«
»Sag ihm, daß Wyatt Earp, Doc Holliday und Luke Short wieder in die Stadt kommen.«
»Aber, Boß, ich habe die drei doch vorhin gesehen, die sind nach Süden geritten, das heißt, der Tex bog nach Osten ab, aber…«
»Schweig und tu, was ich dir sage! Cass muß unbedingt informiert werden. Und wenn du ihn nicht erreichst, reitest du zu den Flanagans; die werden vielleicht auch nicht zu Hause sein, aber du kannst es dann ihrem Alten sagen, der kraucht immer daheim herum.«
So »wußte« Tombstone, daß die drei Männer zurückkommen würden, um den Ratten aufzulauern.
Indessen sprengten die drei nach Süden, der fernen Shibell Ranch entgegen.
Als sie auf der Höhe von Ike Clantons Ranch angelangt waren, erinnerte sich Wyatt an den toten Cowboy Stones.
Der aber lag nicht mehr in den Kakteen.
Allein der Marshal war durch den Kaktushain geritten. Short hatte sich links gehalten und der Spieler rechts, so hatten sie die eventuell hier wieder lauernden Tramps in der Zange.
Aber die Luft war rein.
Ike Clantons »Cowboys« waren nirgends zu sehen.
»Ist mit diesen Kerlen Ikes Schuld und seine Eigenschaft als Boß der Galgenmänner nicht eigentlich erwiesen?« wollte Luke wissen.
Wyatt schüttelte den Kopf.
»Durchaus nicht. Die Tatsache, daß einige seiner Cowboys sich als Wegelagerer beschäftigen und graue Gesichtstücher benutzen, markiert sie selbst zwar als Galgenmänner, nicht aber den Rancher, ihren Boß, auch als Chef der Gang. Absolut nicht.«
Der Riese schüttelte den Kopf.
»Wissen Sie, am meisten fuchst mich, daß man diesen Ike Clanton nicht einfach packen kann. Packen und ausmerzen. Er ist doch wie ein Eitergeschwür in diesem Land. Ike Clanton! Was verbirgt sich nicht alles hinter diesem Namen.«
»Eben, weil sich so vieles dahinter verbirgt, können wir ihn uns nicht einfach greifen. Ihn schon gar nicht, weil wir dann sofort die Öffentlichkeit gegen uns haben, die Angst vor ihm und seinen zahllosen Freunden hat. Nein, auf einen Verdacht hin kann ich Ike nicht festsetzen. Und ich will es auch nicht, weil es unklug wäre, dann erfahre ich nämlich gar nichts mehr. Im Gegenteil: ich habe nur noch mehr Feinde. Wenn er der große Chief der Galgenmänner ist, werden seine Leute kopflos und somit unberechenbar und gefährlicher, was dem Land noch mehr Unheil bringt. Wenn ich ihn stellen will, muß ich einen hundertprozentigen Beweis dafür in der Hand haben, daß er wirklich der Bandenführer ist.«
»Und gestern der Jubel in der Allenstreet, als er vorm Crystal Palace vom Pferd stieg?«
»Besagt gar nichts. Er ist für die Leute nach wie vor der große Ike Clanton und wird es auch bleiben. Die Hauptschreier waren seine Anhänger und die, die vor ihnen Angst haben.«
»Und Phin? Wie hat der Hund geredet! Er tat doch unverblümt so, als hätten Sie Clum niedergeschossen!«
»Und? Was hat sein Bruder Ike ihm darauf erwidert?«
»Well, das war raffiniert, täuscht mich aber nicht. Er ist für mich der Chief der Graugesichter, Marshal! Und Phin, dieser schleimige Phin…«
»Was mit Phin geschieht, steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber auch er kann erst ergriffen werden, wenn ein echter, sichtbarer Beweis für seine Schuld in unseren Händen ist.«
Der Marshal dachte und handelte völlig instinktsicher. Wenn er den gerissenen Ike Clanton stellen wollte, dann mußte es wie ein Blitzschlag aus heiterem Himmel sein, der die Schuld des Ranchers klar vor aller Augen offenbarte.
Aber der Kampf gegen die Galgenmänner war ein Kampf gegen Phantome. Hin und wieder stieß man auf Widerstand, hoffte endlich die goldene Spur gefunden zu haben, mußte dann jedoch jedesmal wieder feststellen, daß es nur eine winzige, bedeutungslose Nebenspur war.
Wo lief die Hauptfährte – und wohin führte sie?
War der Mann, der einige Meilen weiter westlich dieser Kaktusfelder seine Ranch hatte, war dieser Isaac Joseph Clanton der so heißgesuchte Boß der strafforganisierten Verbrecherbande?
Liefen bei ihm die Fäden dieses Geheimbundes zusammen? Konnte alles mit einem Schlag zertrümmert, das ganze Spinnennetz dieser mörderischen Gang zerschlagen werden, wenn er festgesetzt wurde?
Der Marshal hatte absolut recht, wenn er bei einer Festnahme des Ranchers einen Aufstand in Tombstone und im ganzen Cochise Country befürchtete. Zu tief noch saß der Name Clanton in den Gehirnen der verängstigten Menschen dieses Landes, zu groß war noch die Furcht vor ihm, und zu viele Freunde und Anhänger besaß er noch, als daß man ihn ohne schlagenden Beweis hätte festsetzen können.
Und so leicht ließ er sich nicht stellen. Schattenhaft geisterte er im Hintergrund des Geschehens umher, tauchte hier und dort auf, hinterließ aber bei seinem stärksten Widersacher, dem Marshal Earp, nicht den Eindruck, daß er wirklich der Gesuchte sei.
Im Gegenteil, er gab dem Gesetzesmann nicht einmal Veranlassung, ihm ernsthaft zu mißtrauen.
Das war das Schlimmste! Denn alles, was die Galgenmänner taten, wie sie vorgingen, ihre ganze Nebelhaftigkeit, die Organisation und die Vorschriften der Gang; alles deutete auf den Führer der größten Gang hin, die der Westen je vor den Galgenmännern gekannt hatte: auf die Clanton Gang!
Und vor allem auf deren Chief, Isaac Joseph Clanton.
Die drei Reiter blickten gedankenvoll nach Westen über die Savanne zu den Sandhügeln hinauf, hinter denen der kleine Blaue See und die Weidegründe der Clanton Rinder lagen.
»Den Mann kann ich nur mit eiserner Geduld und Zähigkeit zur Strecke bringen«, preßte der Marshal rauh durch die Zähne.
»Leider kann er inzwischen noch eine Menge Schaden anrichten«, gab der Texaner zu bedenken.
»Vorausgesetzt, er ist der, für den wir ihn halten. Außerdem bemühten wir uns ja, den Schaden so niedrig wie möglich zu halten. Er wird riesengroß, wenn wir einen schwerwiegenden Fehler machen. Und wir können keinen größeren Fehler begehen, als einen Ike Clanton einzusperren, der unschuldig ist.«
»Genau das ist es«, bestätigte der Spieler. »Das ist überhaupt der Kernpunkt des Problems. Schlagen wir bei ihm zu, überschwemmen die Galgenmänner, die nach Hunderten zählen können, das Land und richten mehr Unheil an, als wenn Ike noch da wäre. Draußen auf seiner Ranch ist er erreichbar für alle und frei. Sie kennen ja ihren Boß anscheinend selbst nicht, wissen nicht, wer oben führt, wer die Befehle gibt. Und todsicher halten die meisten von ihnen den gleichen Mann wie wir für den Boß: nämlich Ike Clanton. Und greift der Marshal den – schlagen sie in wilder, zügelloser Wut zurück.«
Wyatt nickte.
»Das ist es, was ich zu befürchten habe. Ganz abgesehen davon, daß wir nur zu dritt sind, so gut wie gar keine Helfer haben und dann von den Banditen überrollt würden. So aber nutze ich Ikes Macht für uns aus. Er hilft mir gewissermaßen, natürlich unbewußt. Denn er, der gefürchtete und gleichermaßen mit allen Wassern Gewaschene vergeht sich nicht öffentlich gegen das Gesetz. Da wagen es auch die kleinen Hunde nicht so bedenkenlos. Und ihr jetziges Zuschlagen in der Nacht ist gegen das, was dann käme, ein Nichts!«
»Ein Spiel mit Bande also«, meinte der Texaner.
»Leider. Ich muß die Billardkugel so stoßen, daß mir der grüne Rand – die Bande – hilft, ohne daß er es will.«
»Leider ist der unfreiwillige Helfer ausgerechnet das härteste Stück Lebewesen, das es in diesem Land gibt«, beendete der Georgier die Unterhaltung.
Sie ritten in scharfem Galopp nach Süden.
Näher und näher rückten die Kulissen der Blauen Berge. Da die Männer spät aus der Stadt weggekommen waren, senkte sich die Sonne im Westen schon dem Horizont zu, als sie das Steingewirr erreichten, in dem der Marshal mit dem Banditen Darridge gekämpft hatte.
Sie suchten ein sicheres Versteck für die Pferde, und bei einbrechender Dunkelheit führte der Marshal die Freunde zum Ausgang des Stollens, durch den Darridge von der Ranch entkommen war.
»Wir können nicht alle durch den Schacht gehen…«
»Lassen Sie mich das machen«, meldete sich der Mann aus Texas.
»Ausgerechnet Sie sind der längste von uns, und ich schätze, daß Sie sich da unten nirgends aufrichten können. Würde ein reichlich unbequemer Marsch für Sie werden.«
»Schadet nichts. Sie kennen oben den Weg zur Ranch. Und das ist wichtig.«
Wyatt hatte auch vorgehabt, selbst weiterzureiten, da er den Weg durch dieses Steingewirr kannte. Aber er hatte den findigen Spieler in den Gang schicken wollen.
Da kroch der Texaner schon in den höhlenartigen Schacht.
»Erwarten Sie mich drüben am Backhaus.«
»Ich muß Sie warnen, Luke. Der Stollen kann voller Hindernisse für einen Nichteingeweihten sein.«
»Ja«, lachte der Goliath, »ich dachte mir schon, daß der liebe Shibell da kein Loch von solcher Länge durch die Erde hat buddeln lassen, daß der lange Short darin spazierengehen kann.«
Damit verschwand er.
Der Missourier und Doc Holliday setzten ihren Ritt fort.
Als die Steine immer enger wurden, stieg Wyatt vom Pferd. Holliday folgte seinem Beispiel sofort. Sie kamen jetzt sehr viel langsamer vorwärts, da hier in dieser Steinwüste trotz des Mondscheines kaum etwas zu sehen war. Plötzlich wurde es heller. Das Steingewirr lag hinter ihnen, und es war nicht mehr weit von den letzten Felsbrocken bis zum Ranchtor. Dreihundertfünfzig Yard höchstens maß die Entfernung.
Da hielt der Marshal an.
Doc Holliday trat neben ihn und flüsterte: »Die haben sich ja prächtig verschanzt! Wer nicht zufällig hier vorbeikommt, findet diese Ranch nie.«
Erst jetzt fiel das auch dem Missourier auf. Die Ranch lag tatsächlich so geschützt an den Bergen, hinter einem regelrechten Verhau von hohem Steingeröll, daß sie so leicht nicht zu entdecken war.
Der Gambler blickte unverwandt zu den flachen Bauten hinüber, die nur von der Scheune überragt wurden.
»Wenn Sie nicht schon hiergewesen wären, Wyatt, hätte ich Shibell in einem ganz besonderen Verdacht. Dieses Nest liegt nämlich derart raffiniert, daß ein Mann wie Ike Clanton es garantiert zu seinem Hauptcamp machen würde.«
Wyatt Earp sah den Spieler von der Seite an.
»Es ist durchaus noch nicht gesagt, Doc, daß das nicht der Fall ist. Was besagt es denn, daß ich hier war? Sie nehmen an, daß hier nichts mehr sein könnte, was ich nicht entdeckt hätte. Aber ich war ein Gefangener, als ich hierher kam; ein Invalide und ein Flüchtling, als ich die Ranch verließ. Zu richtigen Nachforschungen bin ich ja gar nicht gekommen.«
Angestrengt blickten die beiden Männer auf die Ranch, die vor den hellen Felsbastionen lag.
Ein neuer Gedanke hatte von ihnen Besitz ergriffen: standen sie vor der Lösung des großen Rätsels?
Lag dort das Camp des Anführers der Galgenmänner?
War Oswald Shibell der Mann, nach dem sie seit Wochen suchten?
Auch das war nicht ausgeschlossen. Wyatt hatte ja nicht mit ihm sprechen können. Und wie hatte Sam Miller, der Bruder des Mörders Jonny Miller, mit Shibell gesprochen? Er redete ihn immer als Boß an. Aber vielleicht hatte das auch nichts zu bedeuten, denn Miller konnte ein Cowboy des Ranchers sein, und jeder Cowboy redete seinen Herrn mit Boß an.
Aber wie diese Ranch da lag, das war es, was den Marshal plötzlich stutzen ließ!
Doc Hollidays Gedanke war nicht von der Hand zu weisen: die Shibell Ranch konnte das geheime Hauptlager der Galgenmänner sein und der Schlupfwinkel ihres Anführers.
Das Anwesen Oswald Shibells hatte plötzlich etwas Unheimliches an sich.
Die beiden Männer standen eine Weile reglos nebeneinander.
Hollidays Rappe schlug unwillig mit dem Huf auf das Gestein, und dieses Geräusch brachte die beiden wieder in die Wirklichkeit zurück.
Noch war dies nur die Ranch Oswald Shibells, und nichts weiter! Allerdings, man hatte den Marshal aus Tombstone auf diese Ranch verschleppt, und das war ja auch der Grund, der ihn wieder hierher zurückgeführt hatte. Dieser Oswald Shibell hatte ihm übel mitgespielt, und Wyatt, der sich jetzt wieder erholt hatte, gedachte hier aufzuräumen.
Die von der Shibell Ranch hatten eine Verbindung zu den Banditen in Tombstone, daran konnte es keinen Zweifel geben. Oswald Shibell hatte dem Marshal den Stern gestohlen, und sein Helfershelfer und Shibell hatten ihn für tot gehalten und drüben in die große Scheune geschoben. Was sie weiter mit ihm im Schilde führten, hatte Wyatt nicht abgewartet. Unter schwierigsten Umständen hatte er sich aus diesem Gefängnis hier befreit und war rasch nach Tombstone geritten.
Jetzt war er zurückgekommen, um mit Shibell abzurechnen!
Die beiden Männer gingen langsam weiter.
Das Ranchtor stand offen, und schwaches Mondlicht warf einen fahlen Schein auf den weiten Hof. Links war das Mannschaftshaus, rechts der Geräteschuppen, anschließend daran das Wohnhaus, hinter dem die Scheune stand. Drüben hinterm Mannschaftshaus kam nach einer kleinen Lücke das Backhaus.
Die beiden Dodger waren weitergegangen und befanden sich jetzt nur noch etwa fünfzig Yard vom Tor entfernt.
Dort blieben sie wieder stehen und wechselten einen kurzen Blick miteinander. Diese stumme Absprache genügte für die beiden Männer vollkommen.
Doc Holliday würde um die Ranch herumgehen und von irgendeiner Seite in den Hof gelangen. Der Marshal selbst ging weiter, er nahm das Pferd mit hinüber zum Geräteschuppen, wo er es stehen ließ. Der Falbe war daran gewöhnt, auch unangebunden stehenzubleiben und auf seinen Herrn zu warten, der es dann meist mit einem bestimmten Pfiff heranrief, wenn er es brauchte. So hatte sich der Marshal schon oft aus heiklen Situationen gerettet, weil dann der Hengst auf Anruf zur Stelle war, ohne daß der Missourier ihn eigens hätte holen müssen.
Wyatt fixierte das im Mondschein seltsam groß wirkende Ranchhaus, unter dessen Vorbau schwarzes undurchdringliches Dunkel lag. Aber von der linken Seite des Hauses kam ein Lichtschimmer, der an der Seitenwand der großen Scheune zu sehen war. Also befand sich jemand im Ranchhaus.
Wyatt beschloß, um den Bau herumzuschleichen, weil er unbedingt feststellen mußte, wer sich drüben in der Stube befand.
Es mutete ihn eigenartig an, daß er weder einen Menschen noch ein Tier hier auf dem Hof vorfand; denn mit einem Blick auf den Corral hatte er festgestellt, daß nicht ein einziges Pferd dort stand.
Geduckt schlich sich der Marshal an dem Geräteschuppen entlang und hatte die Ecke des Ranchhauses erreicht. Von hier aus konnte er jetzt über den Vorbau spähen.
Auch dort war niemand zu sehen. Der Vorbau war leer, bis auf einen alten Schaukelstuhl, der neben dem Eingang stand.
Wyatt konnte auch sehen, daß vorn das erste Fenster halb offen stand. Er schlich sich auf den Vorbau bis unter das hölzerne Sims, wo er lauschend verharrte.
Drinnen war es still.
Da richtete er sich blitzschnell auf und wagte den Sprung ins Innere des Raumes. Er landete auf einem Fellteppich und duckte sich sofort nieder, um nicht gegen das helle Fenster eine Silhouette abzugeben.
Lauschend verharrte er am Boden. Er befand sich offenbar in einem Schlafraum, denn rechts von ihm stand ein mit Leinen bezogenes Bett.
Aber nicht der leiseste Laut war zu vernehmen.
Wyatt bewegte sich lautlos zur Tür und versuchte sie zu öffnen.
Sie war verschlossen, und der Schlüssel steckte außen. Wyatt hatte diesen Weg also vergeblich gemacht.
Als er am Fenster war, um wieder hinauszusteigen, vernahm er von der Haustür her ein leises Geräusch.
Er blieb lauschend in der Fensternische stehen und hörte, wie die Haustür geöffnet wurde.
Dann blieb es wieder eine Weile still.
Plötzlich aber hörte der Marshal den Schritt eines Mannes, der auf den Vorbau hinaustrat und sich bemühte, kein Geräusch zu verursachen.
Näher und näher kam er an das Fenster heran, wohl in der Absicht, die Ecke des Hauses zu erreichen.
Jetzt tauchte seine Silhouette am Fenster auf. Näher schob er sich, dachte aber nicht daran, einen Blick in den Raum zu werfen, da seine ganze Aufmerksamkeit dem Hof zugewandt war.
Er hatte also etwas gehört! Vielleicht das Pferd?
Und dann stand er im Profil mitten vor dem Fenster.
Wyatt hätte fast einen Ruf der Überraschung ausgestoßen, denn er kannte den Mann genau. Und sein Auftauchen hier erfüllte ihn mit größter Verwunderung.
Es war weder Miller noch Darridge noch Oswald Shibell.
Aber dieser Mann, der jetzt da draußen stand, trug den Namen Shibell. Und er trug noch etwas: nämlich einen großen Stern auf der linken Brustseite.
Sheriff Curle Shibell! County Sheriff des Pima Counties!
Was tat der Mann hier?
Aber vielleicht war sein Auftauchen gar nicht so verwunderlich, wie es dem Eindringling jetzt erscheinen mochte. Schließlich war Oswald Shibell sein Bruder.
Reglos verharrte der Mann vor dem Fenster und starrte in den Hof. Es konnte nur noch Sekunden dauern, bis er den Hengst drüben vor dem Geräteschuppen entdeckt hatte.
Darauf wollte der Marshal es nicht ankommen lassen, da er den Mann so leicht nicht wieder in eine so günstige Position bekommen würde.
Blitzschnell verließ er die Fensternische und tippte dem Sheriff auf die Schulter.
Curle Shibell stand wie versteinert da. Er war für Sekunden gar nicht in der Lage, sich umzudrehen. Dann endlich wandte er sich langsam um und starrte aus weit aufgerissenen Augen auf den Mann im Fensterrahmen.
Jäh fuhr er zurück. »Wyatt Earp?« krächzte er.
»Ja, Shibell, ich bin’s. Verzeihen Sie, daß ich in das Haus Ihres Bruders eingedrungen bin.«
Wyatt jumpte über die Fensterbank und stand vor dem Sheriff.
Die beiden maßen einander forschend.
Curle Shibell war offensichtlich aus dem Gleichgewicht gebracht. Das plötzliche Auftauchen eines Fremden hätte ihn höchstwahrscheinlich ohnehin erschreckt, daß dieser Mann aber ausgerechnet der Marshal Earp war, schien ihn ungeheuer verstört oder sogar schockiert zu haben.
Endlich hatte sich Shibell gefaßt.
Er nahm seinen Hut ab und drehte ihn nervös zwischen den Händen, wobei er den Missiourier nicht aus den Augen ließ.
»Darf ich fragen, was Sie hier suchen, Marshal?«
»Doch, das dürfen Sie, Shibell. Ich suche Ihren Bruder.«
»So…«
Wyatt nahm eine seiner großen schwarzen Zigarren, deren Vorrat er in Tombstone wieder aufgefüllt hatte, aus seinem Lederetui und steckte sie zwischen seine großen weißen ebenmäßig gewachsenen Zähne. Als er das Zündholz anriß, fiel der schwache Lichtschein für den Bruchteil eines Augenblickes auch auf das harte Gesicht Curle Shibells.
Durch die Rauchwolke hindurch fragte der Missourier: »Sie können mir wohl nicht sagen, wo ich Ihren Bruder finde?«
Der Sheriff schüttelte den Kopf.
»Nein, das kann ich nicht.«
Wyatt lehnte sich gegen einen Vorbaupfeiler.
»Schade, ich hätte mich gern mit ihm unterhalten.«
»Worüber?«
Wyatt spürte den forschenden, fast feindseligen Ton, der aus Shibells Worten klang. Er war mehrmals mit dem etwas spröden Mann zusammengekommen, und beim letztenmal sogar auf eine recht unliebsame Weise. Denn Curle Shibell hatte versucht, zwei Verbrecher, die eine Frau auf übelste Weise belästigt hatten, ungeschoren davonkommen zu lassen, obgleich er wußte, daß er dies nach dem Gesetz der Union bestrafen mußte, um anderen Lumpen ein abschreckendes Beispiel vor Augen zu führen.
Wyatt hatte die Banditen wieder aufgegriffen und sie ins Jail zurückgebracht.
Shibell war damals sehr ungehalten gewesen, hatte aber gegen den US-Marshal nichts ausrichten können. Geblieben war in ihm der Haß auf einen Mann, der über ihm stand und ihn zurechtgewiesen hatte. Daß diese Zurechtweisung auf sein eigenes Verschulden zurückzuführen war, wurde ihm nie klar.
Was wußte Sheriff Shibell von dem Treiben seines Bruders? Was wußte er von dem, was gestern hier vorgegangen war? Und weshalb hielt er sich jetzt hier auf? Vielleicht gab es bei all diesen Dingen einen Zusammenhang. Ebensogut aber konnte das Auftauchen Curles rein zufällig sein, wenn er auch früher nur sehr selten mit seinem Bruder Oswald verkehrt hatte.
Der Marshal erklärte: »Ich bin in Tombstone von Banditen überfallen worden, und man schleppte mich mit einem Wagen hierher.«
»Wann?« erkundigte sich Shibell. Er hatte nicht gefragt: warum, und mit wem sind Sie zusammengeraten, und wer hat Sie hergeschleppt. Er fragte seltsamerweise: wann!
Der Missourier hatte es registriert und richtete sich danach. Für ihn stand in dieser Sekunde fest, daß Curle Shibell über diese Dinge, die auf der Ranch seines Bruders vor sich gingen, durchaus informiert war.
»Gestern«, antwortete Wyatt. Im schwachen Mondschein sah er die Anspannung auf dem Gesicht des anderen.
»So, gestern?« wiederholte Shibell. »Merkwürdig ist das.«
»Weshalb?«
»Weil ich gestern hier angekommen bin.«
»Gestern abend?« wollte Wyatt wissen.
»Ja, gestern abend. Das heißt, noch am späten Nachmittag. Aber da waren Sie ja wohl nicht mehr hier.« Es klang spöttisch und argwöhnisch zugleich.
Der Missourier schob die Zigarre von einem Mundwinkel in den anderen, ohne sie aus den Zähnen zu nehmen.
»Sie glauben mir wohl nicht, Shibell?«
»O doch, doch.«
»Es ist mir auch einerlei, ob Sie mir glauben. Wichtig ist, daß ich hierher geschleppt und von Ihrem prächtigen Bruder nicht eben aufmerksam bewirtet wurde.«
Shibell zog die Brauen zusammen.
»Ich verstehe das nicht. Erklären Sie mir das doch bitte genauer.«
»Gewiß. Ich lag gefesselt auf einem Wagen, und sowohl Ihr Bruder als auch sein Helfer Sam Miller hielten mich für tot. Sie schleppten mich drüben in die Scheune, und nach einer Weile kam Ihr sauberer Bruder herein, schob seine Hand unter die Plane und zerrte mir den Stern von der Brust.«
»Lüge!« schrie Curle Shibell plötzlich unbeherrscht los.
Da stieß der Marshal die Hand vor und riß ihn zu sich heran.
»Seien Sie vorsichtig mit dem, was Sie sagen, Shibell.«
»Lassen Sie mich los!«
»Wo ist Ihr Bruder?«
»Ich weiß es nicht.«
»Was tun Sie hier?«
»Das geht Sie nichts an«, fauchte der Sheriff.
»Ich glaube doch.«
Wyatt schob ihn vom Vorbau hinunter. Dann stieß er einen leisen Pfiff aus.
Dieser Pfiff galt nicht dem Hengst. Und das Tier blieb auch dort, wo Wyatt es zurückgelassen hatte.
Dafür tauchte an der Hausecke ein Mann auf.
Doc Holliday!
Er blieb mit gezogenem Revolver neben Shibell stehen.
Der Sheriff zog die Brauen finster zusammen.
»Wer ist denn das?« preßte er heiser durch die Kehle.
»Mein Name ist Holliday, Mister«, entgegnete der Spieler leise. »Ich hoffe, daß wir uns gut verstehen werden.«
Unüberhörbar war die Ironie, die wie Gift von den Lippen des Gamblers troff.
Der Sheriff ergab sich zunächst in sein Schicksal und schwieg.
Wyatt betrat wieder den Vorbau, ging auf den Eingang zu, stieß ihn auf und stand gleich darauf im dunklen Flur.
Links unter einer Türritze brach Licht in das Dunkel des Korridors.
Wyatt stieß plötzlich die Tür auf, blieb aber im Dunkeln neben dem Rahmen stehen.
Der Küchenraum war leer. Auf dem Tisch stand eine große Kerosinlampe, und davor lag eine aufgeschlagene Gazette.
Wyatt trat an den Tisch heran und blickte auf die Zeitung. Sie war nicht mehr sehr neu und schon leicht vergilbt. Schon wollte er sich abwenden, da sah er – aus dem veränderten Winkel heraus – zwischen der Kopfleiste und den großen Lettern die Eindrücke von Buchstaben. Irgend jemand hatte einen Brief geschrieben und dabei das Zeitungsblatt als Unterlage benutzt.
Wyatt hob das Blatt, konnte aber nur wenige Worte lesen.
… nach Norden geritten… Sehr wichtig ist… Auch erwarten…
Die anderen Schriftzeichen waren trotz größter Mühe nicht zu lesen.
Es konnte sich um einen völlig unwichtigen Zettel handeln, der da geschrieben worden war, aber der Marshal hatte das Gefühl, daß das, was er da jetzt entdeckt hatte, von großer Bedeutung für ihn sein könnte.
Er durchsuchte das Haus, um sicher zu sein, daß sich auch tatsächlich niemand hier befand; dann ging er hinaus.
Curle Shibell stand immer noch an der Ostwand des Wohnhauses dem Spieler gegenüber.
Die beiden Männer hatten nicht ein einziges Wort miteinander gewechselt.
Wyatt blickte den Sheriff nachdenklich an.
»Tut mir leid, Shibell, ich muß Sie mitnehmen.«
»Mitnehmen?« begehrte der Sheriff auf. »Was fällt Ihnen ein. Wie können Sie mich mitnehmen, was habe ich Ihnen getan? Sie kommen hier auf die Ranch meines Bruders, durchsuchen das Haus, lassen mich von diesem Mann da mit dem Revolver bewachen, und jetzt wollen Sie mich auch noch mitnehmen?«
Der Spieler lächelte leise in sich hinein.
»Sie machen mir Spaß, Shibell. Ihr Bruder hat sich gestern dem Marshal gegenüber wie ein Wegelagerer aufgeführt. Sie haben absolut keinen Grund, hier so große Töne zu spucken. Und falls Sie doch glauben, Grund dazu zu haben, möchte ich Sie an Shepe Gallinger erinnern…« Er hatte den Satz noch nicht ganz zu Ende gesprochen, als Shibell aufbegehrte: »Was geht mich Gallinger an! Was habe ich mit ihm zu tun? Wärmen Sie doch nicht alte Geschichten auf.«
»Kann ich mir denken, daß Ihnen das nicht mehr angenehm ist, Shibell«, entgegnete der Spieler grinsend. »Vorwärts, wo ist Ihr Pferd?«
»Im Stall drüben.«
Wyatt blickte über den Hof, dann erkundigte er sich: »Wo ist der Schwarze?«
»Er ist wohl mit meinem Bruder…«
»… geritten, wollten Sie sagen. Wohin?«
»Ich sagte Ihnen doch schon, daß ich das nicht weiß.«
»Dann werden wir zusammen nach Nogales reiten.«
Jähes Erschrecken stand in den Augen Shibells. Und selbst wenn das nicht gewesen wäre – das erschrockene Zurückweichen bis an die Hauswand verriet ihn.
Sein Bluff hatte also Erfolg gehabt.
Oswald Shibell und seine Männer waren nach Nogales geritten. Und er, Curle Shibell, wußte es.
Wie war er hier auf die Ranch gekommen? Und was hatte er hier wirklich gewollt? Der Sheriff hütete sich, seinen Bruder irgendwie zu belasten. Er holte sein Pferd aus dem Stall und blickte den Missourier an.
»Sie wollen mich also tatsächlich nach Nogales schleppen?«
»Schleppen? Davon kann doch gar keine Rede sein, Curle Shibell. Geschleppt wurde ich, und zwar auf die seltsame Ranch Ihres Bruders.«
»Und was hat das mit mir zu tun?« wollte Shibell wissen. »Was haben Sie für einen Grund, mich nach Nogales zu schleppen? Ich weiß nicht, was mein Bruder da tut – wenn er wirklich dort ist.«
»Er ist dort, und Sie wissen es«, entgegnete Wyatt schroff und wandte sich danach ab.
Um nicht von neuem hier auf dieser Geisterranch überrascht zu werden, überzeugte sich der Marshal zunächst davon, daß sich wirklich niemand hier befand. Er durchsuchte das Bunkhaus, die Stallungen, die Scheune und die Schuppen. Zum Schluß stieß er die Tür des Backhauses auf.
Nachdem er einen kurzen Blick hineingeworfen hatte, wollte er sich abwenden.
Aber ein winziges Geräusch ließ ihn innehalten. Es war ein Atemgeräusch aus einer menschlichen Kehle!
Kein Zweifel: im Backhaus befand sich ein Mensch.
Wyatt wandte sich ab und zog die Tür zu; aber nicht fest ins Schloß. Draußen blieb er stehen, versetzte ihr plötzlich einen Tritt, daß sie weit aufsprang, nahm den Colt in die Hand, spannte ihn und rief: »Rauskommen!«
Ein ächzendes Geräusch war zu hören, dann tapsende Schritte.
Im Eingang erschien ein Neger.
Wyatt blickte ihn an.
»Horace? Nanu! Sonst noch jemand drin?«
Der Schwarze schüttelte den Kopf.
»Nein, Mister…«
»Well, ich werde nachsehen. Wehe dir, wenn du gelogen hast.«
»Ich habe die Wahrheit gesagt!«
Wyatt überzeugte sich davon. Horace hatte nicht gelogen. Jetzt war das Backhaus leer.
»Wo ist Oswald Shibell?«
»Ich weiß es nicht!«
»Das solltest du aber wissen.«
»Nein. Er ritt weg und sagte mir, ich solle jeden niederschießen, der sich der Ranch nähert.«
»Dann hättest du gleich bei seinem Bruder anfangen können.«
»Ist der Mann, der gestern nachmittag gekommen ist, sein Bruder?«
»Das wußtest du nicht?«
»Nein. Er gleicht dem Boß überhaupt nicht.«
»Und wo ist Darridge?«
»Er und Huston sind mit dem Boß geritten.«
»Wann sind sie weggeritten?«
»Im Morgengrauen.«
»Hast du sonst noch etwas beobachtet? Ich meine, in der Nacht?«
Der Schwarze schüttelte den Kopf.
»Nicht? Also willst du mir weismachen, daß du den Reiter nicht gesehen hast, der nach meiner Flucht hier auf der Ranch ankam?«
Es war ein Bluff – und wieder hatte der Marshal Erfolg damit.
Horace nickte hastig.
»Doch, den habe ich bemerkt. Er brachte eine Botschaft, glaube ich.«
»Danach hatte ich noch gar nicht gefragt, schwarzer Mann.« Wyatt blickte ihn mit harten Augen an. »Wer war es?«
Horace zog die Schultern hoch. »Das weiß ich nicht.«
Doc Holliday, der Shibell ans Backhaus geführt hatte, nahm seinen Colt aus dem Halfter und spannte den Hahn.
»Schade, daß der nette schwarze Bursche schon sterben muß.«
»Sterben? Aber, Mister…«
»Mein Name ist Holliday, Black Boy!«
»Aber, Mister Holliday. Ich denke noch gar nicht ans Ster…« Er brach jäh ab und starrte dem Spieler in die Augen. »Wie war Ihr Name, Mister?«
»Holliday.«
»Doc Holliday?«
»Richtig, Freund.«
»Wyatt Earp und Doc Holliday!« Der Neger schlug sich mit der flachen Hand gegen den Schädel. »Ich muß geschlafen haben! Natürlich Sie sind Doc Holliday! Aber weshalb sagen Sie, daß ich sterben müsse?«
»Weil du uns nicht sagen willst, wer der Reiter war.«
»Oh – also…, hm, er…, ich könnte dem Marshal vielleicht sagen, mit wem er eine gewisse Ähnlichkeit hatte. Aber ob es Hinc Travalgar gewesen ist, weiß ich natürlich nicht, denn ich kenne den Mann ja nicht und…«
»Hinc Travalgar?« wiederholte Wyatt Earp. »Also, dieser Verbrecher treibt sich auch hier herum?«
»Ich kann es nicht behaupten, Marshal. Der Reiter hatte lediglich eine gewisse Ähnlichkeit mit ihm.«
Wyatt hatte während dieses Gespräches unauffällig Curle Shibells Gesicht beobachtet, in dem sich jedoch kein Muskel regte.
In diesem Augenblick gab es einen Donnerschlag, daß der Boden unter den Füßen der Männer erzitterte.
Wyatt Earp und Doc Holliday wechselten einen erschrockenen Blick miteinander.
Dachten sie doch in diesem Moment beide das gleiche!
Eine Explosion im Stollen!
Luke Short!
Shibell hatte den Schrecken der beiden Dodger bemerkt. Es war Wyatt, als hätte er für einen Moment ein höhnisches Grinsen um die Lippen des County Sheriffs gesehen.
»Das kam vom… vom…« Der Neger bebte am ganzen Leib. »Es muß jemand… im…«
Wyatt stand da wie angewachsen.
Holliday stieß Shibell einen der Revolver auf die Brust.
»Was war das, Shibell?«
»Keine Ahnung!« entgegnete der County Sheriff heiser.
»Wer ist im Stollen?«
»Keine Ahnung!«
»Die Explosion kam drüben aus den Bergen! Wer ist im Stollen?«
»Ich… weiß es wirklich nicht!«
»Jetzt sagen Sie mir nur noch, daß Sie den Stollen nicht kennen?« Wyatt ballte die Hand zur Faust.
Shibell räusperte sich. Schweiß glänzte auf seiner Stirn.
»Den Stollen? Ich weiß nicht, was Sie meinen, Marshal. Aber falls Sie die Höhle meinen, die da drüben hinterm Backhaus in der Felswand ist, dann kann es sein, daß da etwas hochgegangen ist, wenn jemand dort herumhantiert, der da nichts zu suchen hat. Es kann durchaus sein, daß mein Bruder da Pulverfässer gelagert hat.«
»Ganze Fässer gleich?« zischte der Gambler. »Wollte er einen Krieg führen?«
»Man muß hier auf alles gefaßt sein!« wich Shibell aus.
Wyatt gab dem Freund einen Wink, die beiden scharf zu bewachen und lief bangen Herzens auf das Backhaus zu.
Er hätte in dieser Minute keinen roten Cent mehr für das Leben des Texaners gegeben. Ganz zweifellos war der Hüne an eine verborgene Sicherungsleitung geraten, die die furchtbare Explosion ausgelöst hatte.
Der Marshal hatte die Seitenwand des Backhauses hinter sich, als der drüben hinter dem Mesquitegestrüpp das Geräusch von Schritten hörte.
»Luke…!« entfuhr es ihm.
»Yeah«, kam die dröhnende Stimme des Texaners aus dem dunklen Steingewirr, und dann tauchte auch schon seine herkulische Gestalt auf.
»Da bin ich, Marshal!«
Wyatt lief ihm entgegen.
»Na, war das nun ein anständiger Bums oder nicht?« empfing ihn der Hüne feixend, während er sich nach der Felsenhöhle umsah, aus der noch immer eine dünne Staubwolke hervorquoll.
»Ich hätte keinen Hufnagel mehr für Ihr Leben gewettet«, stieß der Marshal erregt hervor.
»Aber, aber, wie kann man denn nur so pessimistisch sein!« lachte der Riese. »So schnell dampft Onkel Luke doch nicht ab. Vorher muß ich unbedingt noch ein paar passende Worte mit diesen Shibells reden!«
»Wieso Shibells?«
»Ich meine, mit dieser Bande, die den Stollen mit den drei Fanglunten gesichert hat. Die Brüder sind Stümper.«
»Drei Fanglunten?« wiederholte Wyatt atemlos.
»Yeah, aber mit solchen Großmutterscherzen können sie doch Luke Short nicht meinen! Wozu bin ich schließlich drei Jahre als Sprengmaster bei der Railway in den Felsenbergen gewesen. Da haben wir noch mit ganz anderen Tricks gearbeitet. Vorn im Stollen, am Ausgang also, fand ich gleich die Schnurrolle. Sie dient für Wanderungen in der Dunkelheit, wenn man den Stollen verlassen will. Man wickelt sie beim Hinausgehen ab und dann ganz einfach wieder auf, wenn man zurück will. So kommt man ganz sicher wieder in den Fuchsbau. Und meistens hat diese Schnurrolle genau die Länge des Stollens selbst. Uralter Song. Ich habe die Schnur mitgenommen und sie an das erste Luntenkabel gebunden, später an das zweite – und zwanzig Yard vor dem Eingang hier fand ich das dritte. Am Schluß brauchte ich nur einen kurzen Ruck mit der Hand zu tun – und den Rest haben Sie ja gehört.«
»Heißt das, daß Sie den ganzen Stollen in die Luft gesprengt haben?«
»So ungefähr.«
Jetzt mußte der Marshal über den sonderbaren Mann aus Texas fast lachen.
»Gott sei Dank, daß Sie wieder auf der Erdoberfläche sind.«
»Ja, die Hunde hatten zwar etwas dagegen, aber dafür sind sie auch zur Hölle gefahren.«
Die beiden waren inzwischen vor dem Backhaus bei den anderen angekommen.
Wyatt blieb plötzlich stehen und lauschte den letzten Worten des Texaners nach.
»Wer… hatte etwas dagegen?«
»Die Hunde.«
»Was denn… Sie sind auf Menschen im Stollen gestoßen?«
»Menschen? Nein, es waren Hunde! Ganz einfach Hunde! Und da sie mich jagten, ich hinfiel, einen Colt verlor und den anderen schon leergeschossen hatte, sie mir aber dicht auf den Fersen waren, zog ich die Schnur.«
Der Marshal griff sich an den Kopf.
»Wenn Sie glauben, daß ich das verstanden habe, Luke…«
»Nicht? Well, dann kann ich es ja noch mal runterbeten. Also: ich hatte die erste Lunte gefesselt und dann die zweite. Plötzlich schossen die Köter aus einem Seitengang hinter mir her. Ich rannte los, stolperte und…«
»Im Dunkeln?« unterbrach ihn der Georgier.
»Wer spricht denn davon! Ich habe selbstverständlich eine der Pechfackeln genommen, die grundsätzlich immer fünf Schritt hinter den Stolleneingängen an den Wänden hängen. Dann ging es rasch vorwärts.«
»Aber das muß doch ein beträchtliches Stück gewesen sein!«
»War es auch. Und dann stolperte ich, verlor den Colt – und die verdammte Fackel verlosch. Irgendwo in einem Quergang kamen diese jaulenden Tölen, rasend vor Wut hinter mir her. Ich schoß zurück, meine Trommel leer. Jetzt rechnete ich: Sicherungsanlagen so primitiver Art haben fast immer die gleichen Abstände, das liegt an der gleichmäßig verteilten Dummheit der Leute, die so was anlegen. Vorn eine Sicherung, etwa zweihundertfünfzig Yard weiter wieder eine Sicherung. Also mußte nach der gleichen Distanz etwa wieder eine kommen. Vor allem, da die Schnurrolle, die ich in der linken Armbeuge hielt, höllisch dünn wurde…«
»Was, die haben Sie auch noch festgehalten?«
»Ich hätte eher alles andere fallen gelassen, Marshal! Denn die Schnurrolle ist immer das wichtigste. Sie allein konnte mich zum Eingang zurückbringen. Ihretwegen ist auch die Fackel beim Sturz so unglücklich an der Wand entlanggerutscht, daß sie verlosch. Ja, und dann hatte ich also die dritte Lunte zu suchen.«
»Und immer noch waren die Hunde hinter Ihnen?«
»Das war ja das Dumme. Sonst hätte ich doch mehr Zeit gehabt und vor allem meinen schönen Colt nicht im Stich lassen müssen, der jetzt unter Steintrümmern begraben liegt und nach hundert Jahren einem Ölsucher in die Finger gerät, der dann auf dem Lauf meinen Namen liest und sich fragt: Luke Short, was muß das für ein Idiot gewesen sein, daß er hier unter der Erde herumkroch wie ein Maulwurf und seine Kanone verloren hat!«
»Und weiter, wie fanden Sie dann in der Eile die Lunte?«
»Es blieb mir ja keine Wahl. Ich mußte die Fackel, die ich nicht losgelassen hatte, wieder anzünden. Da stellte ich fest, daß sie am Boden bei meinem Sturz feucht geworden sein mußte. Daher also das schnelle Verlöschen. Sie ging nicht mehr an. Aber genau in dem Moment, als das Zündholz verlosch und auf den Boden sank – sah ich die Lunte. Ich wickelte den Rest meiner Schnurrolle darum und tigerte weiter. Die Tölen kamen jetzt verdammt schnell näher, hatten das Bellen eingestellt, und ich hatte auf einmal das Gefühl, daß ihrer noch mehr geworden waren. Ist ja nicht ausgeschlossen, denn ein paarmal muß ich an Seitengängen vorbeigekommen sein. Well, und als der vorderste Köter dann schon auf zwölf Yard herangekommen war, zog ich hart an der Schnur. Ich konnte es riskieren, da ich den Ausgang schon spürte. Es klappte beim erstenmal nicht, und ich sah mich schon im Kampf mit einer Meute stinkender Höhlenhunde eingehen, als ich beim dritten Ruck endlich Erfolg hatte. Der erste Hund hatte mich schon erreicht. Da ging der Bums los. Ich hatte mit dem Ruck zugleich einen Fall ins Freie getan. Der Köter, der hinter mir war, wurde vom zusammenbrechenden Gestein noch erwischt.«
Die beiden Dodger blickten einander wortlos an. Dieser Luke Short war ja ein wahres Unikum!
Da hatten sie befürchtet, daß er mit dieser Höhle vielleicht Schwierigkeiten haben könnte, und er bewies ihnen, daß er besser damit zurechtgekommen war, als sie selbst es höchstwahrscheinlich geschafft hätten.
Denn Sprengmaster war noch keiner von ihnen gewesen!
Holliday zündete sich eine Zigarette an und stieß den Rauch prustend von sich.
Kopfschüttelnd meinte er: »Wenn Sie mich hätten gehen lassen, Marshal, fehlte uns jetzt ein Mann.«
Der Texaner lachte dröhnend auf.
»Nur nicht so bescheiden, Doc. Sonst werde ich Ihnen jetzt sagen, daß ich schon ein halbes hundert Mal in Ihrer Nähe gedacht habe: Wenn du jetzt dagestanden hättest, Luke, wäre der Marshal tot! Weil du den Banditen da drüben nicht mehr erwischt hättest! Weil du nicht auf den Gedanken gekommen wärest, das zu tun, was der Doc getan hat! Und vor allem: Weil du nie und nimmer so schnell und sicher zurückgeschossen hättest!«
Holliday winkte ab.
»Hören Sie auf, Sie Hundsmörder.«
Der Schwarze senkte den Kopf. Niemand hatte auf ihn geachtet.
Jetzt aber streifte ihn Wyatt zufällig mit einem Blick und gewahrte blinkende Tränenspuren auf seinen Wangen.
Er ergriff ihn am Arm.
»Sie wußten von den Hunden?«
Der Schwarze schüttelte den Kopf.
Als er aber den Revolver des Gamblers wieder auf sich gerichtet sah, gestand er: »Es waren unsere Hunde. Ich habe sie immer gefüttert.«
Der Texaner zog die Brauen zusammen. »Du willst diese Höllenbiester gefüttert haben? Das glaubst du doch selbst nicht, Mann! Das sind doch über kalbsgroße scharfe Bestien gewesen!«
»Ich habe sie hinter den Seitengittern gefüttert.«
Luke stieß einen Pfiff aus.
»Ah, die Seitenstollen waren also durch Gitter gesichert, so daß ein Eingeweihter von den Hunden niemals überrascht werden konnte. Ich aber habe die Gitterklappe wahrscheinlich zufällig mit dem Fuß geöffnet. – Sie sehen, Doc, ich bin dem Tod wirklich nur durch Zufall entronnen.«
Der Neger wußte offenbar doch mehr, als er zugeben wollte.
Schweigend und scheinbar uninteressiert hatte auch Curle Shibell dabeigestanden.
Was ging in ihm vor?
Wyatt blickte ihn von der Seite an.
»Haben Sie irgend etwas dazu zu sagen, Shibell?«
Der Sheriff sog die Luft geräuschvoll ein.
»Ja, Marshal Earp, eine ganze Menge habe ich dazu zu sagen. Wie kommt Luke Short dazu, das Eigentum meines Bruders zu zerstören?«
»Eigentum?« Wyatt hatte zufällig in Tombstone auf dem Büro des Mayors nachgesehen, wie groß Shibells Gebiet war. Dabei hatte er auch festgestellt, daß die Ranch merkwürdigerweise nur bis zum Backhaus ging. Das Backhaus selbst stand nur noch zur Hälfte auf Shibells Grund.
Die andere Hälfte stand auf Indianerland.
»Tut mir leid, Shibell. Nicht einmal das Backhaus steht noch ganz auf dem Land Ihres Bruders. Der Stollen liegt auf Apachenland.«
»Well, ich will es nicht abstreiten, denn ich weiß nicht genau, wo die Grenze liegt.« Höhnisch setzte Curle Shibell hinzu: »Aber über Ihre Bemerkung ›Apachenland‹ kann ich nur lachen. Was gehört diesen roten Strolchen überhaupt?«
Der County Sheriff war als verschworener Indianerfeind berüchtigt.
Wyatt blickte den Texaner an, der, zwar mit sehr viel Geschick, aber auch mit unerhörtem Glück, dem Tod im Stollen entronnen war.
»Da drinnen ist jetzt natürlich alles verschüttet?«
»Darauf können Sie sich verlassen. Da lebt keine Maus mehr, ganz sicher nicht diese Köter, die diese Tierquäler da eingesperrt haben.«
Wyatt sprang den Sheriff plötzlich mit der Frage an: »Welchem Zweck diente dieser sonderbare Stollen?«
»Ich weiß es nicht, Marshal. Sie fragen mich unentwegt Dinge, auf die ich Ihnen keine Antwort geben kann.«
Mit einem Ruck zerrte Wyatt jetzt den Schwarzen zu sich herum. »Und du weißt natürlich auch nichts?«
»Gar nichts, Mister Earp!«
»Du hast nichts von dem gehört, was Hinc Travalgar hier bestellt hat?«
»Nein, Mister Earp. Ich hatte eine Menge Arbeit nachzuholen.«
»Komm! Wir holen deinen Gaul, und dann geht’s los.«
»Wohin?«
»Nach Nogales.«
Schon seit einer Weile beobachtete der Marshal, daß Curle Shibells Augen unauffällig das Ranchtor suchten. Wartete er auf jemanden? Er mußte den Zettel mit der Nachricht bekommen haben, und wahrscheinlich wartete er hier noch auf irgendeinen Reiter.
Der Marshal hatte sich längst seine Gedanken über den Sheriff gemacht. Wenn er auch ein etwas seltsamer Bursche war, dieser Curle Shibell, der damals drüben in Bisbee gesessen und auf Ike Clantons Wunsch den schwächlichen Jonny Behan in Tombstone als Übergangssheriff eingesetzt hatte, wenn er auch zweifellos hin und wieder Leute hatte laufen lassen, die sich einer strafbaren Gesetzesübertretung schuldig gemacht hatten; der Gedanke, ihn auf einmal für einen Banditen halten zu müssen, war doch befremdend.
Curle Shibell war früher Soldat gewesen, Chief Sergeant, und gleich nach dem Krieg hatte er sich bei der Polizei beworben. Wenn er ein Bandit gewesen wäre oder auch nur ein Mensch, der ein Leben wie sein Bruder Oswald führte, so wäre das längst offenbar geworden.
Er wußte höchstwahrscheinlich seit einiger Zeit von den dunklen Machenschaften seines Bruders, war möglicherweise jetzt zufällig hier aufgetaucht und hatte den von Oswald zurückgelassenen Zettel gefunden – der für einen anderen Mann bestimmt war.
Sie standen mit den Pferden schon im Hof, als Wyatt plötzlich gebot: »Los, die Gäule in den Stall! Und dann hinüber ins Haus!«
Während Doc Holliday und Luke Short Shibell und Horace in dem kleinen Schlafraum bewachten, versteckte sich der Marshal in der Küche hinter der Spindportiere.
Im gleichen Moment, als ihm unten im Hof der Gedanke gekommen war, daß die von Oswald geschriebene Nachricht gar nicht für Curle bestimmt war, sondern für einen Mann, den Oswald erwartet haben mochte, hatte Wyatt Earp fern vom Steingeröll her das Geräusch von Hufschlag vernommen.
Ein Reiter näherte sich der Ranch.
Tatsächlich war auch jetzt das Geräusch von Hufschlag draußen im Hof zu hören.
Harte, sporenklingende Schritte dröhnten auf dem Vorbau. Die Haustür wurde aufgestoßen, und dann waren die Schritte im Korridor. Da die Kerosinlampe noch brannte, setzte der Mann gleich seinen Weg fort.
Wyatt hatte die Küchentür scharf im Auge.
Ohne anzuklopfen öffnete der Fremde. Zu seiner namenlosen Verblüffung sah der Marshal einen Mann im Türrahmen stehen, den er fünfhundert Meilen von hier entfernt wähnte.
Es war ein großer, schlanker, scharfäugiger Mensch in elegantem braunem Tuchanzug mit weißem Hemd und weinroter Samtschleife. Über der Jacke trug er den hellen Waffengurt, in dessen Halfter zwei große Revolver steckten.
Dieser Mann war Nash Chandler, das Käsegesicht, wie der blasse Bursche auch genannt wurde. Der Schießer von Rapid City! Der etwa vierundzwanzigjährige Mann war der gefürchtetste Revolverschwinger, den Dakota seit den Tagen des Coltman Heeth je gekannt hatte. Vor zwei Jahren war er von Sheriff Windham festgenommen und vom Gericht in Raid City wegen Totschlags zu elf Jahren Straflager verurteilt worden.
Der Outlaw war also ausgebrochen und hatte sich hier in den Süden abgesetzt, und ausgerechnet Anschluß bei den Galgenmännern gefunden!
Wyatt hatte den üblen Schießer mehrere Male in Rapid City gesehen und war auch einmal mit ihm zusammengeraten.
Der Mann sicherte nach allen Seiten, kam dann in den Küchenraum und trat an den Tisch, wo er die Zeitung aufhob und mit enttäuschtem Blick auf den leeren Tisch zurückwarf. Dann nahm er sie wieder auf, drehte sie hin und her, schüttelte sie und knüllte sie wütend zusammen.
Er stieß einen unterdrückten Fluch aus und wollte die Küche verlassen.
Da sah er einen Mann vor sich stehen.
»Earp!« kreischte er entgeistert, wich zurück und prallte gegen den Tisch. »Das ist doch ein Spuk!«
»Das will ich nicht hoffen, Nash.«
»Wie kommen Sie hierher?« keuchte der Bandit.
»Das ist merkwürdig, die gleiche Frage wollte ich Ihnen gerade stellen!«
Dem geflüchteten Sträfling wurde seine scheußliche Lage erst jetzt voll bewußt. Der hochgewachsene Mann da vor ihm, mit den harten hellen Augen und dem kantigen Gesicht, war der Marshal Wyatt Earp! Der härteste Banditenjäger zwischen den Bergen Montanas und dem Golf von Mexiko.
Der Marshal hatte die rasche Bewegung des Revolvermannes bemerkt. »Laß die Hand vom Colt, Nash! Es täte mir leid, wenn ich deinen schönen Anzug verderben müßte.«
Der fahlgesichtige Bandit musterte ihn aus verkniffenen Augen.
»Was wollen Sie hier, Earp? Wie kommen Sie hierher?«
»Du wirst es mir zwar nicht glauben, Nash Chandler, aber ich habe hier auf dich gewartet. Weißt du, ich bin ein ziemlich anhänglicher Bursche und vor allem ein Freund von Sheriff Windham.«
Wie gelähmt stand der Verbrecher da. Wenn nicht schon die Stimme des Missouriers ihn gebannt hätte, so gewiß dessen Augen.
»Tut mir leid, Nash, du hast einen weiten Weg hinter dir. Ich hoffe, daß du keine Toten darauf zurückgelassen hast.«
»Sie wollen mir allen Ernstes erzählen, daß Sie hier auf mich gewartet haben, Earp?«
»Ja, Nash, das will ich dir erzählen. Oswald Shibell konnte leider nicht mehr auf dich warten. Er mußte weg. Hinc Travalgar hat ihm eine Botschaft gebracht.«
Die Augen des Banditen waren schmal wie Schießscharten geworden. »Und – was wissen Sie von dieser Botschaft?«
Da brach ein sprödes Lachen von den Lippen des Missouriers.
»Es scheint dein Pech zu sein, Chandler, daß du die Männer mit dem Stern für reichlich dumm hältst. – Los, nimm die Hände hoch.«
Die Arme des Banditen krochen bis in Schulterhöhe.
Wyatt ging auf ihn zu und nahm ihm die Revolver aus dem Halfter.
Der geflüchtete Sträfling hatte plötzlich allen Mut verloren. Die Tatsache, daß ausgerechnet der Marshal Earp ihn gestellt hatte, nahm ihm, der eine so lange Flucht hinter sich hatte, allen Wind aus den Segeln.
Er wurde an den Händen gebunden, hinausgeführt und auf sein Pferd gesetzt.
Luke Short brachte Curle Shibell und den Neger in den Hof.
Shibell und der Schwarze wurden nicht gefesselt. Aber keiner von ihnen hatte eine Waffe.
Der County Sheriff versuchte noch einen schwachen Protest.
»Sie können mir doch nicht einfach meinen Revolver abnehmen, Marshal. Ich habe Ihnen nichts getan. Und selbst wenn mein Bruder ungesetzlich an Ihnen gehandelt hätte, berechtigt Sie das nicht, mich wie einen Verbrecher zu behandeln.«
Wyatt, der neben ihm auf seinem Falbenhengst saß, entgegnete brüsk: »Ich behandele Sie nicht wie einen Verbrecher, Shibell. Aber da Sie der Bruder eines Banditen sind, ich Sie hier auf dessen Ranch angetroffen habe und Sie mich zweimal belogen, habe ich allen Grund, Ihnen ein gesundes Mißtrauen entgegenzubringen.«
»Was haben Sie mit mir vor?«
»Sie reiten mit nach Nogales.«
»Das ist doch Wahnsinn, Wyatt«, begehrte der Sheriff auf. »Ich bin hierhergekommen, um meinen Bruder zu besuchen, nicht aber, um jetzt auch noch sechzig Meilen hinüber nach Nogales zu machen.«
»Sie werden Ihren Bruder in Nogales finden.«
»Ich habe keine Zeit für einen so weiten Ritt.«
»Wer keine Zeit hat, Shibell, sollte in diesem Land nicht umherreiten. Die Leute Ihres Bruders haben mich auch nicht gefragt, ob ich Zeit hätte, als sie mich überfielen und hierher schleppten.«
»Lassen Sie mich frei, Wyatt«, schlug Shibell dann einen vertraulichen Ton an. »Ich kann mir einen Ritt nach Nogales tatsächlich nicht leisten. Ich muß zurück nach Tucson.«
Vielleicht hätte Wyatt Nachsicht walten lassen, aber einmal ganz davon abgesehen, daß Curle Shibell höchstwahrscheinlich auf irgendeine Weise versucht haben würde, seinen Bruder zu warnen, hatte der Name Tucson in dem Marshal eine sehr düstere Erinnerung wachgerufen.
Auch in Tucson hatten die Galgenmänner gehaust. Sie hatten sich nicht gescheut, den Bericht, den der Missourier dort auf dem Gericht hinterlegt hatte, zu stehlen!
Tucson war die Hauptstadt des Pima Counties, und Curle Shibell war dort County Sheriff. Diesen Mann freizulassen, das hätte ein zu großes Risiko bedeutet.
»Vorwärts«, gebot der Marshal. Und dann preschten die sechs Reiter aus dem Hof, zwängten sich durch das Steingewirr und bogen, als sie die Overlandstreet erreicht hatten, nach Südwesten ab.
Bleiches Mondlicht erhellte die Landschaft und ließ die steil ansteigenden Felsbastionen der Blauen Berge wie bleiche Nebelschwaden erscheinen.
*
Harry Benson warf die Trumpfkarte auf den grünen Filz des Spieltisches. Lachend zog er mit beiden Armen die gewonnenen Dollarnoten zu sich heran, nahm den Hut ab und schob das ganze Geld hinein; dann stülpte er sich die schwerer gewordene Kopfbedeckung wieder auf und erhob sich.
»So, Gents, das wär’s für heute!«
Die fünf Männer am Spieltisch blickten finster vor sich hin.
Der todkrank aussehende Perry Gomez stieß mit hohler Stimme hervor: »Ein Spiel noch, Benson!«
Aber der wohlhabende Pferdehändler winkte ab.
»Sie sollten sich das überlegen!« rief Gomez, und ein weniger selbstzufriedener Mann als Benson es war, hätte die Drohung in seiner Stimme kaum überhören können. Aber der Händler winkte ab und verließ den Nugget Saloon.
Auf seinem Heimweg lag der »Gold-Dollar«, die eleganteste Bar von Nogales.
Unschlüssig blieb der Pferdehändler vor der Schenke stehen, lauschte dem leisen Gitarrenklang, der über die bastgeflochtenen Pendeltüren hinaus in die Nacht drang, und vermochte der Versuchung nicht zu widerstehen. Nicht etwa des guten Whiskys wegen, der im »Gold-Dollar« ausgeschenkt wurde, sondern der Frau wegen, die ihn ausschenkte:
Conchita Alvarez. Die glutäugige, schon ein wenig verblühte Schöne übte seit langem einen unheilvollen Reiz auf den verheirateten Harry Benson aus, ohne daß sie sich dessen voll bewußt gewesen wäre.
Auch jetzt betrat er mit hastigem Atem die sehr elegant mit dunkelrotem Tuch ausgeschlagene Schenke, mußte sich bemühen, nicht auf die Theke zuzueilen, mäßigte seine Eile und suchte mit seinen Blicken die Frau.
Conchita stand oben am Ende der Theke und schenkte einem grauhaarigen Sombreromann eben einen Brandy ein.
Während des Einschenkens lächelte sie dem Gast verführerisch zu.
In solchen Augenblicken hätte der Pferdehändler sie töten können vor Eifersucht. Und dabei hatte er mit ihr bisher nur belanglose Worte über die Theke hin gewechselt. Er nahm immer nur ein paar Drinks, starrte sie an und ging dann wieder.
Es wäre auch alles nicht schlimm gewesen, wenn sie ihn nicht in diese heimliche Unruhe versetzt hätte, die nicht mehr von ihm weichen wollte, ja, die sogar ständig zuzunehmen schien.
Zwei Stunden blieb er im »Gold-Dollar«, dann zahlte er, warf noch einen verlangenden Blick auf die Frau und trat hinaus ins Freie.
Klarer Himmel lag über Nogales.
Die Luft roch nach der Weite der sie umgebenden Savanne.
Da trabte der Reiter durch eine Seitengasse in die Mainstreet, sprang vor dem Saloon vom Pferd, schlang seine Zügelleine um den Querholm und betrat den Vorbau.
Es war ein großer, wuchtiger Mensch, der einen braunen Melbahut trug, ein weißes Hemd, kurze braune Boleroweste und enganliegende Hosen. Tief über den Oberschenkeln baumelten zwei überschwere Hampton-Revolver.
Phin Clanton, zuckte es durch das Hirn des Pferdehändlers.
Und es war ihm, als ob der andere ihn mit einem spöttischen Blick gestreift hätte.
Benson blieb stehen und sah ihm nach.
Sporenklingend, mit großen Schritten, betrat Phin die Schenke, schnipste mit den Fingern, als er die Theke erreicht hatte, und schon eilte die hübsche Conchita mit großen, erstaunten Augen auf ihn zu.
»Evening, Mister Clanton! Was führt Sie denn hierher?«
Der Bandit grinste sie nur an.
Das Mädchen girrte, schob eine Flasche und ein Glas vor ihn hin, beugte sich viel zu weit vor und begann mit ihm zu flüstern.
Der heimliche Beobachter draußen auf dem Vorbau schluckte. Unwillkürlich spannte sich seine Rechte um den kühlen Griff des Revolvers.
Ohne sich dessen bewußt zu werden, war er an die Pendeltür getreten und starrte zu den beiden hinüber.
Plötzlich hatte die Frau ihn entdeckt und blickte ihn verblüfft und verärgert an.
Phin folgte ihrem Blick, stieß sich augenblicklich von der Theke ab, kam an die Tür, schob die Schwingarme auseinander und fegte den völlig verstörten Pferdehändler mit einem ziemlich schweren Faustschlag vom Vorbau hinunter.
Benson lag benommen am Boden und starrte in den blauschwarzen Himmel.
Als er sich endlich erheben konnte, war oben der Vorbau leer.
Phin Clanton war verschwunden.
Der Pferdehändler stahl sich auf den Vorbau und riskierte noch einen Blick in die Bar.
Da lehnte er an der Theke, der lange Phin, starrte die schöne Conchita an und griff sogar nach ihrer Hand.
Benson wandte sich um.
»Bin ich denn wahnsinnig geworden?« flüsterte er vor sich hin. »Was geht mich schließlich dieses Mädchen an. Ich bin verheiratet, ja, das bin ich! Und…«
Er überquerte torkelnd die Straße und schob sich in das Gedränge des Frontier Saloons.
Hier blieb er bis weit nach Mitternacht.
Zusammen mit Ben Habelar und dem kleinen Taylor Gundram verließ er die Schenke. Die beiden bogen in die Waterstreet nach Süden ein, während Benson allein weiterschlenderte.
Er war stark angetrunken. Sein Schädel brummte und dröhnte, und er hatte das Gefühl, daß der ganze bestirnte Nachthimmel mit dem fahlen Mond mitten auf seinem Kopf sein müßte.
Hinter der City Hall machte die Mainstreet eine harte Biegung nach Nordwesten.
Benson ging mitten auf die Straße.
Es waren nur noch etwa fünfhundert Yard bis zu seinem großen Haus, das an der Ecke der Lincolnstreet stand.
Da sah er Licht in mehreren Fenstern des Obergeschosses.
Er ging schneller. Plötzlich stolperte er und stürzte hin. Als er sich erheben wollte, hielt er auf einmal mitten in der Bewegung inne.
Oben über dem Dachfirst seines Hauses ragte ein Galgengerüst in den Nachthimmel hinein, gespenstisch vom Mondlicht beleuchtet. Sekundenlang lag der Mann im Staub der Straße und starrte auf das Gerüst.
Es dauerte lange, bis seine Gedanken klar wurden. Der Schock, den ihm der Anblick bereitet hatte, ließ ihn nicht los.
Harry Benson kannte die Bedeutung des nächtlicherweise aufgestellten Galgens sehr wohl. Er kannte auch die Menschen, die dieses Gerüst errichteten.
Die Galgenmänner!
Auch in Nogales hatte man von ihnen schon gehört.
Erst in der vergangenen Woche hatte Richard Griffith von den Banditen erzählt, die oben in Tombstone und in Tucson zu Hause sein sollten. Man hatte auch in der Nugget Bar von den Kämpfen Wyatt Earps in Kom Vo und drüben in Costa Rica in der Zeitung lesen können.
Aber all dies war ja noch weltenfern für die Menschen in Nogales gewesen; es hatte nicht sie betroffen, also fühlte man sich auch nicht allzusehr davon beeindruckt. Man hatte es mehr gelesen wie etwas aus einer anderen Welt, aus einem Land jedenfalls, mit dem man nichts zu tun hatte.
Und nun stand da plötzlich der Galgen vor seinem eigenen Haus. Groß, gespenstisch und dräuend.
Die Stirn des Pferdehändlers war mit großen Schweißperlen bedeckt. Erst das Bellen eines Hundes in einem der benachbarten Höfe rüttelte ihn aus seiner Starre auf. Er richtete sich auf, wischte sich mit dem linken Unterarm über die Stirn, vermochte aber nicht den Blick von dem Galgengerüst zu wenden.
Dann sah er sich nach allen Seiten um und rannte auf den nächsten Vorbau zu, in dessen Dunkelheit er schwer atmend stehenblieb, um von hier aus die Straße zu beobachten. Vielleicht waren sie ja noch in der Nähe, die Männer, die ihm den Galgen gebracht hatten. Ausgeschlossen war es nicht. Vielleicht hatten sie ihn gesucht.
Ganz sicher sogar! Denn er wußte doch aus Griffiths Berichten, daß die Galgenmänner zuerst das Gerüst aufstellten und dann den Mann griffen, dem dieses Gerüst galt. Der Galgen da drüben galt zweifellos ihm, denn er stand ja vor seinem Haus. Aber ihn hatten sie noch nicht gefunden. Sie konnten ihn ja auch nicht finden, da er nicht daheim gewesen war. Welch irre Gedanken!
Wieder wischte er sich den Schweiß von der Stirn.
Da sie ihn also noch nicht gefunden hatten, würden sie auf ihn warten. Sie mußten entweder direkt vorm Haus, hinterm Haus oder im Haus stecken, jetzt noch.
Natürlich! So war es. Schlotternd stand der Pferdehändler an der Wand von Prighards Hardware Shop und starrte vor sich hin.
Da blitzte ein Gedanke in seinem Schädel auf.
Ich muß zum Sheriff laufen!
Aber dann überlegte er, was er dem Sheriff erzählen wollte. Natürlich, daß vor seinem Haus ein Galgen stünde. Richtig, aber was wollte er vom Sheriff? Hilfe?
Harry Benson wußte schon, weshalb er sich nicht an den Sheriff wenden würde. Ganz aus der Tiefe seines Unterbewußtseins war plötzlich ein Gedanke in ihm aufgestiegen.
Groß, dunkel und bedrückend: der Gedanke an Phin Clanton!
Gab es doch für den Pferdehändler Harry Benson keinen Zweifel daran, daß der Tombstoner Bandit Phineas Clanton zu den Galgenmännern gehörte. Ja, daß er der Bruder des Chiefs dieser Bande war. Denn in der Stadt Nogales, wie anderwärts, hielt man Ike Clanton für den Boß der Männer mit den grauen Gesichtern.
Niemals zuvor war er mit einem der Clantons zusammengeraten. Damals, als die Bande noch groß war und ihre Fühler auch bis zur Grenze erstreckt hatte, gab es hier in Nogales eine Reihe von Leuten, von denen es hieß, daß sie zu Ikes Bande gehörten. Aber niemand hatte es je beweisen können. Als dann die Bande zusammengebrochen war, hörte man nichts mehr von diesen Leuten. Well, er kannte einige der Tombstoner von Angesicht. Vor allem Phin, da der sich früher schon häufig in Nogales herumgetrieben hatte. Was er hier gesucht hatte und mit wem er hier zu tun hatte, wußte Benson nicht. Das heißt, es hatte den Pferdehändler auch niemals interessiert.
Aber heute, da war er mit Phin Clanton zusammengestoßen. Er war ihm an die Tür der Schenke gefolgt und hatte die Unterhaltung des Banditen mit der Barkeeperin mit glühenden, eifersüchtigen Augen beobachtet. Conchita hatte ihn entdeckt, und dann war Phin gekommen und hatte ihn vom Vorbau geworfen.
Er hatte sich einen Feind geschaffen, wie er ihn sich schlimmer nicht denken konnte. Einen echten Clanton! Und jetzt stand der Galgen vor seinem Haus!
Es war zwecklos, den Sheriff zur Hilfe zu holen. Was sollte der kleine Jeff Cornelly gegen Leute wie Phin Clanton ausrichten? Und ganz davon abgesehen würde sich der Sheriff hüten, gegen ihn vorzugehen, wußte er doch, genauso wie Benson und leider jeder andere in der Stadt, daß Phin zu den Galgenmännern gehörte. Und wer wollte sich mit denen anlegen?
In tiefster Verzweiflung lehnte der Mann an der Wand des Shops und stierte zu seinem Haus hinüber.
Erst nach Minuten setzte er sich in Bewegung und ging vorwärts. Schritt für Schritt. Einen Fuß vor den anderen setzend, so hielt er auf das düstere Anwesen zu.
Als er dann den Vorbau erreicht hatte, blieb er stehen und sah sich um. Kein Mensch war zu sehen. Er öffnete die Tür, trat ein, riß ein Zündholz an, und bald darauf warf eine kleine Kerosinlampe ihr Licht in den Korridor.
Benson nahm die Lampe und betrat seinen Wohnraum. Es war ein großes Zimmer, in dem ein riesiger Tisch umgeben von neun Stühlen stand. Rechts an der Wand der große Schrank, links ein eichener Schreibtisch. Auf der anderen Seite ein kleiner orientalischer Tisch mit drei Hockern.
All diese Dinge hatte er damals gekauft, als er die kleine hübsche Ireen Gunnarson geheiratet hatte. Er ließ die Tür offenstehen, wandte sich um, durchquerte den Flur und warf einen Blick in die Küche.
Hier war alles in Ordnung. Hastig ging er die Treppe hinauf und stieß die Tür zu seinem Schlafgemach auf. Ruhig atmend lag seine Frau da und schlief. Das lange blonde Haar fiel ihr bis über die Schultern; sie glich einem Kind, wie sie da lag.
Benson verließ das Zimmer, überquerte den Korridor und öffnete die Tür des Kinderzimmers.
Als der Lichtschein in den kleinen Raum fiel, stockte der Herzschlag des Mannes.
Das kleine Bett war leer!
Wie vom Blitzschlag getroffen, stand der Pferdehändler in der Tür, hielt die Lampe hoch und vermochte den Blick nicht von dem Bettchen zu wenden.
Joan! Wo war sie? Seine kleine Joan.
Und dann schrie er, daß es durch das ganze Haus gellte: »Joan!«
Aus dem Schlafgemach kam seine Frau im fußlangen weißen Nachtgewand und blickte ihn entsetzt an. Sie vermochte nicht zu sprechen.
»Wo ist das Kind?« herrschte Benson sie an.
»Ich weiß es nicht.«
»Es ist weg.«
»Aber, Harry…«
Er nahm die Lampe und zerschmetterte sie an der Korridorwand. Das Öl rann über den Boden und mit ihm die kleinen blauen, züngelnden Flammen, die sich rasch vorwärtsfraßen.
Entsetzt stürzte sich die Frau mit einer Decke auf die Flammen und löschte sie.
Schwer atmend stand der Mann am Treppengeländer und starrte durch das Fenster hinaus auf die Straße. Genau vor diesem Fenster endete das Galgengerüst mit einem Querbalken, an dem die Seilschlinge hing.
Als sich die Augen der Frau an die Dunkelheit gewöhnt hatten, entdeckte auch sie plötzlich das Seil und den Balken.
»Harry!« flüsterte sie bebend. »Was hat das zu bedeuten?«
»Was das zu bedeuten hat?« kam es heiser aus der Kehle des gequälten Mannes. »Was soll es schon zu bedeuten haben. Es ist das Zeichen der Galgenmänner!«
»Ja, vor unserem Haus?«
»Ja, vor unserem Haus!«
»Bedeutet dieses Zeichen nicht…«
»Doch, den Tod!«
Die Frau schlug die Hände vors Gesicht und wich fassungslos zurück, prallte gegen die Flurwand und riß ein Bild herunter, das klirrend am Boden zersprang.
»Nein!« schrie sie, und ihr Angstschrei brach sich an den kahlen Wänden des Treppenhauses.
Bewegungslos, silhouettenhaft verharrte ihr Mann vor dem Fenster.
»Harry«, kam es endlich tonlos über die Lippen der Frau. »Harry, so sag doch etwas.«
»Was soll ich sagen. Sie haben Joan geholt. Da gibt es nichts zu sagen.«
»Aber… das Kind… Sie können doch nicht das Kind nehmen!«
»Sie haben nicht danach gefragt. Die Galgenmänner pflegen nicht zu fragen, sie handeln.«
Apathisch ließ der Mann seinen Kopf sinken und, wie er jetzt am Treppengeländer lehnte, bot er ein Bild tiefster Niedergeschlagenheit.
Plötzlich wandte er sich um, stürzte in sein Schlafzimmer und riß die schwere Winchester von der Wand. Er lud die Waffe durch und rannte die Treppe hinunter, hinaus in den Hof, eilte in den Stall hinüber, stieß den Kolben gegen das kleine Fenster neben dem Stallhaus, und alsbald tauchte das Gesicht eines Negers auf.
»Joe! Meine Tochter ist entführt worden!«
Verstört rieb der alte Neger sich die Augen.
»Joan? Mister Benson, das ist doch nicht möglich!«
»Es ist möglich. Weck die anderen!«
Er stieß das Tor auf, rannte hinaus auf die Mainstreet, dicht an der Vorbauseite entlang bis zum Sheriffs Office hinunter.
Der kleine Jeff Cornelly hing noch über seinem Schreibtisch mit einem der zahllosen, unwichtigen Berichten über irgendeinen Rinderdiebstahl beschäftigt.
Er sah auf, zwinkerte den Eintretenden unwillig an und knurrte: »Benson, Sie? Was wollen Sie denn so spät noch hier?« Dann hatte er plötzlich das Gewehr in der Hand des Pferdehändlers entdeckt.
»Mister Benson!« Der Sheriff stand auf und blickte den Mann unsicher an. »Was wollen Sie mit dem Gewehr?«
»Meine Tochter ist entführt worden, Sheriff!«
Der Gesetzesmann kniff das linke Auge ein, legte den Kopf etwas auf die Seite und tat, als habe er nicht richtig gehört.
»Was ist passiert?«
»Meine Tochter ist entführt worden.«
Der Sheriff führte den kleinen Finger ins Ohr und ließ ihn hin und her zittern.
»Ich habe wohl nicht richtig verstanden, Ihre Tochter ist…«
»Ja, sie ist entführt worden!« schrie Benson plötzlos los. »Und ich kann Ihnen auch sagen, von wem. Von den Galgenmännern!«
Der Sheriff prallte zurück.
Aus weit aufgerissenen Augen stierte er den Pferdehändler an. Dann lief ein konvulsivisches Zucken durch seinen mageren Körper; schließlich sprangen seine Lippen auseinander und er krächzte: »Von den Galgenmännern?«
»Ja, von den Galgenmännern!«
»Aber das ist doch ausgeschlossen. In Nogales gibt es keine Galgenmänner! Die sitzen doch oben in Tombstone und vielleicht auch in Tucson.«
»Glauben Sie. Aber ich habe vorhin einen von ihnen gesehen. Den schlimmsten sogar, den Sie sich denken können: Phin Clanton!«
Der Name traf den Sheriff wie ein Faustschlag. Er sackte auf seinen Stuhl zurück, schob sich den Hut aus der Stirn und griff sich an die Kehle.
»Phin… Clanton«, stammelte er heiser, und seine Linke trommelte nervös auf der Tischplatte herum.
Ungeduldig lehnte sich Benson auf die Tischplatte.
»Was wird jetzt unternommen, Sheriff?«
»Was soll unternommen werden? Ich weiß es nicht.«
»Sie wissen es nicht! Weshalb sind Sie Sheriff? Weshalb bezahlen wir Sie?«
Cornelly kratzte sich hinterm rechten Ohr, stand langsam auf und ging auf den Gewehrständer zu. Ohne Hast nahm er eine große Schrotflinte heraus, lud sie und kam dann auf den Pferdehändler zu.
»All right, Mister Benson«, sagte er ruhig, »dann werden wir ihn suchen.«
»Wen – ihn?« Jetzt war es an dem Händler, erstaunt zu sein.
»Phin Clanton«, sagte der Sheriff gelassen.
Harry Benson sank auf einen dreibeinigen Hocker nieder und stemmte den Gewehrkolben nieder auf die Dielen.
»Wir beide wollen Phin Clanton stellen? Das haben Sie doch wohl nicht im Ernst gemeint?«
»Aber natürlich. Sie haben doch gesagt, daß er in der Stadt ist, und Sie haben ihn im Verdacht, daß er Ihre Tochter geraubt hat.«
Harry Benson lauschte dem Ton dieser Stimme nach. Irgend etwas schien ihm darin mitzuklingen, das einen Mißton gab. Die Angst, die der Sheriff bei Nennung des Namens Clanton gezeigt hatte, war auf jeden Fall echt gewesen. Aber dann hatte Cornelly sich sehr blitzschnell beruhigt und war nun sogar bereit, mit ihm zusammen diesen gefährlichen Mann zu suchen.
»Ich habe nicht gesagt, daß Phin Clanton meine Tochter entführt hat, aber ich habe gesagt, daß Phin Clanton in der Stadt ist. Und vor meinem Haus steht ein Galgen.«
»Ich weiß«, nickte der Sheriff.
Da schnellte Benson hoch, und seine Linke schnappte um das rechte Handgelenk des Gesetzesmannes.
»Sie wissen es?«
Verstört zuckte der Sheriff zusammen. Dann blickte er unsicher auf. »Ja… ja. Sie haben es mir doch selbst gesagt!« Verwirrt wischte sich der kleine Sheriff übers Gesicht, setzte die Schrotflinte, nachdem er sie entladen hatte, in ihre Klammer und ließ sich auf seinem Schreibtischstuhl nieder, um sich der unterbrochenen Arbeit wieder zuzuwenden.
Der Pferdehändler wandte sich um, ging hinaus und warf die Tür krachend hinter sich ins Schloß.
Wo war Joan Benson?
Diese Frage stellte sich am nächsten Morgen die ganze Stadt.
Die kleine siebenjährige Joan Benson war von den Galgenmännern entführt worden. Und vor dem Haus des Pferdehändlers stand immer noch das makabre Gerüst mit der Schlinge.
Es war elf Uhr, als von Südwesten her ein Mann in die Mainstreet ritt, der durch sein seltsames Aussehen die Blicke der Menschen auf der Straße anzog.
Es war ein etwa sechzigjähriger Mann von hagerer, hochaufgeschossener Gestalt, schmalem Gesicht, das sonderbar zusammengepreßt wirkte und in dem die Augen viel zu nahe der Nase standen. Die Nase selbst war lang, spitz und auf eine unangenehme Art nach unten gezogen, breit und schmal und ebenfalls an den Enden nach unten deutend, der Mund. Das Kinn war scharf und vorgeschoben. Stechend wirkten die dunklen Augen, die in tiefen Höhlen lagen. Das Haar war schwarz, aber an den Schläfen schon stark ergraut. Er trug einen schwarzen Anzug, ein weißes Hemd und eine schwarze Samtschleife. Die zitronengelbe Weste wollte nicht zu dem finsteren Aussehen dieses Mannes passen.
Vorm Grand Hotel stieg der Fremde aus dem Sattel, ließ die Zügelleinen fallen und hing ein kleines Bleigewicht daran, wie es Landärzte noch bis in unser Jahrhundert hinein taten, stieg die drei Stufen bis zum Eingang des Hotels hinauf und verschwand in dessen Eingang.
Der kleine Fred Barring hinterm Rezeptionspult blickte verwirrt drein, als er des Ankömmlings ansichtig wurde, nickte aber sofort diensteifrig, als der Mann ihn mit hohler Grabesstimme nach einem Zimmer fragte.
Er bekam den Schlüssel für Zimmer sieben, trug sich ein und ging gleich nach oben. Der Bursche drehte das Gästebuch um, in das sich der Fremde eingetragen hatte. Da stand, mit spitzigen, scharfen Buchstaben, kaum zu entziffern: Jake Archibald Croydon. Und dahinter stand gut leserlich das Wort: Richter.
Richter Croydon! Der Junge riß die Augen weit auf, nahm das Buch und lief hinaus in die Küche, um es der Herrin unter die Nase zu halten.
»Hier, Mrs. Logan! Lesen Sie, Richter Croydon ist in die Stadt gekommen und bei uns abgestiegen. Ich habe ihm Zimmer sieben gegeben. Soll ich ihm Zimmer neun geben, das große Zimmer?«
Die Frau blickte auf den Namen und sah dann zu ihrem Mann hinüber, der drüben am Herd stand, mit der Zubereitung des Mittagsmahls beschäftigt.
»Was meinst du, Greg?«
»Laß ihn in sieben. Das ist gut genug für den Kerl!«
Richter Croydon! Der Name hatte einen düsteren Schatten mit in die Stadt gebracht. Es gab wohl kaum einen Menschen in Nogales, der noch nicht von Richter Croydon gehört hätte. Er war ein sogenannter Wanderrichter, der irgendwann einmal aus irgendeinem Grund sein Amt oben in Flagstaff, wo er viele Jahre mit grausamer Härte gewirkt hatte, aufgegeben hatte und nur noch auf »Bestellung« arbeitete.
Wer hatte ihn jetzt hierher nach Nogales bestellt?
Daß Richter Croydon nicht ohne Bekannte in der Stadt war, sollte sich schon sehr bald herausstellen, denn als er kurz vor Mittag das Hotel verließ und drüben den »Gold-Dollar« betrat, erhob sich von einem der Tische ein kleiner schwarzhaariger Mexikaner, der auf ihn zutrat und fragte: »Croydon?«
Der Richter reckte seine hagere Gestalt und zog die Brauen zusammen, so daß sich eine erschreckend tiefe Falte in seine Stirn grub, die sich bis unter den Hutrand hinaufzog.
»Wie redest du mit mir? Bin ich ein Peon, Kerl?«
Der Bursche nahm den Hut ab und schüttelte entschuldigend den Kopf.
»Well, ich werde dem Boß Bescheid sagen.«
Dann verschwand er.
Croydon ließ sich an einem Ecktisch in Türnähe nieder und bestellte sich einen Fire Point (Feuerpunkt).
Der »Boß« ließ immerhin fast eine Viertelstunde auf sich warten. Dann trat er durch die Tür, gefolgt von dem kleinen Mexikaner.
Es war Phin Clanton.
Er schlenderte an die Theke, nahm eine Flasche und ein Glas mit und setzte sich dann unaufgefordert zu Croydon an den Tisch.
»Sie sind also da.«
Der Richter nickte. »Ja«, entgegnete er mit seiner Grabesstimme und versuchte sich Würde und Ansehen zu verleihen, indem er die Beine übereinanderschlug, sich weit im Stuhl zurücklehnte und die Zigarre lässig in der aufgestützten Hand hielt.
»Ja, ich bin Richter Jake Croydon aus Flagstaff.«
Phin wischte die Wolke, die der Richter um sich breiten wollte, mit einer Handbewegung weg und lachte rauh.
»Prusten Sie sich nicht auf, Mensch. Ich weiß, daß Sie in Flagstaff verjagt worden sind, weil Sie ständig betrunken ins Gericht kamen.«
Der Richter tat empört, stieß die Zigarre im Aschenbecher aus und krächzte: »Ich muß mir eine solche Anschuldigung verbitten, Mister Clanton. Jawohl, auch von Ihnen! Ich bin freiwillig gegangen, weil ich mich mit dem Stadtrat und mit einigen Bürgern nicht vertragen konnte. Weil diese Leute armselige kleine Spießer waren und von dem Recht nicht das mindeste verstanden. Aus diesem Grunde…«
Phin stellte die Flasche so hart auf den Tisch, daß die Gläser tanzten und Croydon augenblicklich verstummte.
»Mensch, halten Sie mir keine Vorträge. Deshalb sind Sie nicht hier!«
Der Richter zuckte zusammen.
»Was also wollen Sie?«
»Hier wird heute eine Verhandlung stattfinden.«
»Sicher. Schließlich bin ich ja deshalb herbestellt.«
»Well, es geht gegen den Mayor von Nogales.«
»Gegen den Mayor?« fragte Croydon mit einem Anflug von Erschrecken. »Ich dachte gegen einen Burschen namens King?«
»Nein, gegen den Mayor Thomas Angerer.«
Croydon rieb sich über das vorstehende Kinn, und sein spitzer Adamsapfel rutschte auf und ab. Nervös zupfte er an seinen fadenscheinig gewordenen schmutzigen Manschetten und meinte schließlich, während er sich eine neue Zigarette anzündete: »Also gegen Angerer: Well, was liegt gegen ihn vor?«
»Das werden Sie schon noch erfahren. Um drei Uhr ist die Verhandlung in der City Hall.«
Der Richter beugte sich etwas vor und fragte in vertraulichem Ton: »Erlauben Sie, Mister Clanton, ich muß doch wissen, um was es geht.«
»Ich habe Ihnen gesagt: Das werden Sie erfahren!« schleuderte ihm Phin entgegen, goß sich den Inhalt seines Glases in die Kehle, stand auf und stieß seinen Stuhl hart an den Tisch zurück.
Dann nahm sich Croydon ein Herz, stand ebenfalls auf, und da er fast noch länger war als der Bandit, konnte er ihm in die Augen sehen.
»Mister Clanton, ich muß Sie sehr bitten, mich mit der mir zustehenden Höflichkeit zu behandeln, da ich andernfalls jeden Auftrag ablehnend behandeln werde.«
»Ablehnend behandeln? Sie erbärmlicher Kerl! Sie sind doch froh, wenn Sie ein paar Bucks bekommen, damit Sie sich den Hals vollschlauchen können!« fuhr ihn der Tombstoner Cowboy an.
Der Richter wich einen Schritt zurück.
»Was war das?« fauchte er. Dann im tiefsten Ton seiner Grabesstimme fortfahrend: »Phineas Clanton, vergessen Sie bitte nicht, mit wem Sie reden.«
»Geschwafel!« unterbrach ihn der Bandit. »Also, um drei Uhr in der City Hall!«
»Mister Clanton!« rief ihm der Richter nach.
Phin, der sich schon abgewandt hatte, blickte über die Schulter zurück.
»Was wollen Sie noch, Mensch?«
Der Richter schien diese Behandlung offenbar doch gewohnt zu sein, denn er kam heran und fragte jetzt in fast unterwürfigem Ton: »Eine Kleinigkeit noch, Sir. Das Honorar.«
»Was wollen Sie?« fragte der Bandit, ohne zu begreifen.
Da deutete er Richter mit Daumen und Zeigefinger der linken Hand die unverkennbare Geste des Geldzählens an.
Phin spie einen Tabakfaden vor die blankgeputzten Stiefeletten des Richters und meinte, während er mit einem angespitzten Zündholz in seinen Zähnen herumstocherte: »Zweihundert!«
»Nein«, entgegnete der Richter, »das kann nicht Ihr Ernst sein, Mister Clanton. Sie werden doch nicht glauben, daß ich für zweihundert Dollar eine Gerichtsverhandlung führe. Dafür bin ich nicht den weiten Weg hierher geritten.«
»Sie wollen also nicht?« Phin hatte den Kopf hochgeworfen und blickte aus kalten Augen in das Gesicht des Richters.
Croydon drehte und wandte sich wie ein Wurm.
»Was heißt, ich will nicht? Ich kann nicht! Zweihundert Dollar, das ist kein Honorar für einen Mann meines Standes. Ich habe dazu einen viel zu langen Weg zurücklegen müssen, um jetzt eine Verhandlung zu führen, von der ich nicht einmal weiß, um was es da geht.«
Phin hatte das Zündholz ausgespien.
»Well, dann lassen Sie es, Croydon. Verschwinden Sie!«
Er ging zum Eingang, und die Pendeltür schlug hart hinter ihm auseinander, daß sie gegen den Türrahmen krachte.
Croydon zuckte zusammen und ließ sich auf seinem Platz nieder.
Hinweggefegt war all sein aufgebauschter Berufsstolz. Zusammengesunken wie ein Häufchen Elend hockte er da und kippte einen Schnaps nach dem anderen aus Phins Flasche in sich hinein. Seine Augenränder röteten sich, und die Iris bekam einen starren, glasigen Ausdruck.
Als er sich erhob, hätte er normalerweise schwer betrunken sein müssen, genug hatte er ja konsumiert. Aber Jake Archibald Croydon war nicht betrunken. Er warf dem Keeper einen hochmütigen Blick zu und ging hinaus.
*
Der feiste Rinderagent Jonathan Cyril Cox lehnte an einem Pfeiler seines Hoftores und blickte wohlgefällig zu den großen Corrals hinüber, in denen die Rinder standen, die er aufgekauft hatte.
Rinder aus Mexiko! Billiges Vieh.
Er wußte so gut wie der Mann, der ihn beliefert hatte, daß diese Tiere drüben gestohlen worden waren.
Und der Mann, der ihm dieses Geschäft vermittelt hatte, war niemand anderes als Phin Clanton. Aber der raffinierte Phin hatte es verstanden, sich selbst aus der Sache herauszuhalten und im Hintergrund zu bleiben. Der Händler, wild auf das Geschäft, hatte den Preis, der sehr niedrig war, sofort gezahlt und fühlte sich jetzt schon als steinreicher Mann.
Er wandte sich um, überquerte den großen Hof und verschwand hinten im Futterhaus.
Plötzlich sprang hinter einer Kiste ein Mann auf ihn zu und versperrte ihm den Weg.
Es war ein großer, hagerer Mensch, der ein graues Tuch vorm Gesicht trug. In seiner behandschuhten rechten Faust hielt er einen großen Revolver.
Der Viehagent stand wie vom Blitz getroffen da und starrte den Eindringling an. »Was wollen Sie von mir?« stammelte er.
»Das weißt du, Cox«, entgegnete der Bandit.
»Ich verstehe nicht…«
»Geld!« kam es schroff zurück.
»Geld?«
»Ja.«
»Ich habe kein Geld!«
»Aber du kannst dir Geld beschaffen. Schließlich hast du doch Rinder genug draußen stehen.«
»Rinder? Die gehören nicht mir.«
»Rede keinen Unsinn, darüber wissen wir besser Bescheid.«
Blitzschnell überlegte der sonst so geriebene Agent: Das wäre ungeheuerlich. Schließlich hatte er das Geld für die Rinder bereits einmal kassiert! Und wenn er ihn nun schon einmal um die gleiche Summe prellen sollte? Unfaßbar, denn dann hätte er, Cox, die Rinder viel zu hoch bezahlt.
Der Bandit zischte: »Damit wir uns verstehen, heute mittag um zwei Uhr komme ich wieder. Mach keine Dummheiten. Solltest du auf den Gedanken kommen, irgend jemand mitzubringen, beispielsweise den Sheriff, dann ist es aus mit dir, Cox. Also, um zwei Uhr. Mit dem Geld!«
»Mit wieviel Geld?« rief der Agent bebend.
»Mit dem ganzen Geld. Du wirst einen Prozentsatz davon bekommen.«
»Aber das ist doch unmöglich. Erstens kann ich die Rinder nicht so schnell verkaufen und zweitens…«
»Du kannst sie verkaufen«, unterbrach ihn der Bandit.
Wie ein Phantom verschwand der Graue.
Cox stand benommen da. Was war geschehen? Einer der Galgenmänner war bei ihm gewesen und wollte ihn erpressen. Daß sie in der Stadt sein sollten, hatte er bereits am frühen Morgen gehört. Vor dem Haus des Pferdehändlers Benson hatte ein Galgen gestanden. Das wußte ganz Nogales. Und auch, daß Phin Clanton in der Stadt war, wußte man.
Cox hatte es sogar schon in der Nacht gewußt, als ihm die Rinder gebracht wurden. Die fünf Cowboys, die die Tiere bei ihm ablieferten, hatten zwar nichts von Phin erwähnt, aber als er einen von ihnen fragte, wer denn der Boß sei, entgegnete der Mann: »Darüber darf nicht gesprochen werden.«
Und das hatte dem Agenten genügt. Wenn nicht darüber gesprochen werden durfte, dann konnte der Boß nur Clanton heißen, und zwar Phin Clanton. Nicht zum erstenmal hatte er hier ein solches Geschäft gemacht.
Auch hier zeigte sich wieder das Schattenhafte der Clantons. Cox wußte nicht mit Sicherheit, ob Phin dahintersteckte. Und jetzt wurde er also erpreßt. Das allerdings deutete ganz entschieden auf Phin!
Der Agent stürmte die Mainstreet hinauf und stieß die Tür zum Sheriffs Office auf.
Der kleine Gesetzesmann blickte ihm finster entgegen.
»Was wollen Sie denn, Cox? Sehen Sie denn nicht, daß ich beschäftigt bin?«
»Doch, das sehe ich!« schrie der vitale Mann wütend. »Aber ich habe Ihnen etwas zu sagen. Ich bin soeben bei mir im Futterhaus von einem Galgenmann überfallen worden.«
Der Sheriff federte hoch. »Jetzt reicht es mir aber«, zischte er. »Mitten in der Nacht stürmt Harry Benson hier herein und faselt etwas von Galgenmännern. Am Vormittag ist es der Mayor, und jetzt kommen Sie! Lassen Sie mich endlich zufrieden mit diesem Unsinn!«
»Das ist kein Unsinn!« belferte der Viehagent. »Und ich erwarte von Ihnen, Sheriff, daß Sie sich der Sache sofort annehmen. Dieser Bandit verlangt von mir, daß ich die Rinder, die ich in meinem Corral stehen habe, bis zwei Uhr verkaufen soll. Er will das ganze Geld.«
»Aber das ist doch nur Bluff«, entgegnete der Sheriff und ließ sich müde hinter seinem Schreibtisch nieder, um seine Arbeit fortzusetzen.
Der Viehagent riß ihn von seinem Platz hoch.
»Hören Sie genau zu, Cornelly, was ich Ihnen jetzt sage: Um zwei Uhr stehen Sie neben mir in meinem Futterhaus. Und nicht nur Sie, sondern auch Charly Holderman und James Lippit.«
Der Sheriff stützte den Kopf in beide Hände und blickte auf; ganz leise sagte er: »Was bilden Sie sich überhaupt ein, Cox? Glauben Sie, wir hätten nichts anderes zu tun, als Sie und Ihre verrückten Kühe zu bewachen? Hier in der Stadt gehen ganz andere Dinge vor.«
»Ich weiß, die Galgenmänner sind da – und Phin Clanton.«
Da sprang der Sheriff auf und schrie: »Hinaus!«
Der Agent schob sein massiges Kinn vor, ballte die Fäuste und holte zum Schlag aus.
Da öffnete sich drüben hinterm Gewehrschrank die Hoftür, und ein Mann tauchte in ihrem Rahmen auf, bei dessen Anblick der Viehhändler zurückwich.
»Phin!« entfuhr es ihm.
Der Tombstoner Cowboy kaute auf einem Zündholz herum und feixte: »Hallo, Cox, wie steht’s?«
Der Sheriff stand wie versteinert da. Er war offenbar so überrascht wie Cox.
Der Agent schluckte. »Hallo, Mister Clanton. Wie soll’s gehen. Gut, gut. Und ich hoffe, Ihnen geht’s auch gut.«
Phin ließ sich auf den dreibeinigen Hocker nieder und streckte seine langen Beine ungeniert von sich. Während er das Zündholz dicht am Schädel des Agenten vorbeispie, meinte er: »Ziemlich laut hier in Nogales.«
Der Agent bewegte sich langsam zur Tür zurück.
»Ja, ja, seit einiger Zeit. Aber ich denke, das gibt sich wieder. Guten Tag.«
Die Tür fiel hinter ihm zu.
Kurz vor zwei Uhr stand Cox in seinem Futterhaus und starrte auf die Mauer, die am Ende seines Gartenstückes sein Anwesen umgab. Von dort her mußte der Galgenmann kommen, da er kaum den Straßeneingang benutzen würde.
Von der kleinen presbyterianischen Kirche schlug es blechern zwei.
Cox zuckte zusammen. Hinter ihm raschelte es in den Strohballen.
Er wirbelte herum. Und sah sich dem Galgenmann gegenüber, der sich dort versteckt gehalten hatte.
»Das Geld!«
»Ich habe es nicht.«
»Warum nicht?«
»Ich konnte es nicht bekommen. Ich sagte Ihnen doch, daß ich die Rinder nicht so schnell verkaufen kann!«
»Das kann ich meinem Boß nicht erzählen.«
»Sie müssen es ihm sagen. Ich kann die Tiere nicht so schnell verkaufen.«
»Tut mir leid«, entgegnete der Bandit eiskalt, riß einen Revolver aus dem Halfter, und ehe der Agent an eine Gegenwehr denken konnte, fauchte ihm der Schuß entgegen und riß ihn von den Beinen. Mit einem dumpfen Aufprall schlug der schwere Körper des Getroffenen auf den lehmgestampften Boden des Futterhauses auf.
Wie ein Schemen huschte der Mörder hinaus.
Knapp eine Viertelstunde später kam eine der Mägde durch die offenstehende Tür ins Futterhaus und sah den Händler mit verzerrtem Gesicht blutüberströmt am Boden liegen.
Jonathan Cox war tot. Er hatte sein Hehlergeschäft mit dem Leben bezahlt.
Und hinten in seinem Hof stand ein Galgen.
Wann er aufgerichtet war und wer es getan hatte, vermochte niemand mehr festzustellen.
Der Sheriff wurde gerufen, er besichtigte den Toten und den Galgen und verließ stumm das Anwesen des Viehhändlers. Es wußte ja niemand, daß Cox ihn um Hilfe gebeten hatte, also klagte ihn auch niemand an.
Es war drei Uhr. In der City Hall versammelten sich die Menschen. Die Verhandlung gegen den Pferdedieb Jimmy King konnte beginnen.
Man wußte in der Stadt bereits, daß Mister Croydon als Richter gerufen worden war. Der Mayor selbst hatte ihn auf Anraten einiger Leute des Stadtrates kommen lassen. Er wußte nicht, daß hinter dem Anraten und hinter den Stadtvätern Phin Clanton stand. Eigentlich war es nur ein Mann gewesen, der dem Mayor den Rat gegeben hatte, den Richter zu rufen, nämlich der Butcher Lincoln. Ihm hatten sich dann zwei andere angeschlossen, die fanden, daß man Croydon in diesem Fall rufen sollte, denn der gefürchtete Richter würde ein Exempel statuieren. Und die in letzter Zeit zunehmenden Pferdediebstähle würden dann ein für allemal in Nogales und Umgebung aus der Welt geschafft werden.
Die City Hall war angefüllt mit Menschen, und der hagere Richter saß vorn hinter seinem Tisch, flankiert vom Sheriff und dem Mayor.
Als der Gefangene von einem der Deputies vorgeführt wurde, warf er einen raschen Blick in den Zuschauerraum, wo er offenbar den Mann gefunden hatte, den er suchte.
»Wie heißen Sie?« fragte der Richter schnarrend, nachdem er die Verhandlung eröffnet hatte.
»King, Jimmy.«
»Woher kommen Sie?«
»Aus Tucson.«
»Seit wann sind Sie hier?«
»Seit vierzehn Tagen.«
»Was treiben Sie hier?«
»Ich arbeite in Forgess’ Mühle.«
»Aha, und dann stehlen Sie nachts Pferde, um sich den Ausgleich für den schmalen Verdienst zu beschaffen?«
»Das stimmt nicht. Euer Ehren, ich habe keine Pferde gestohlen«, rief der verschlagen wirkende Bursche.
»Sie sind doch aber beim Diebstahl überrascht worden.«
»Ich bin nicht überrascht worden, denn der Mann, der die Anzeige gegen mich erhoben hat, ist wahrscheinlich von irgend jemandem bestochen worden.«
»Weshalb wohl? Ich kann mir nicht denken, daß Sie hier jemand des Pferdediebstahls bezichtigt, ohne Grund dazu zu haben.«
»Kennen Sie den Mann?«
»Ja.«
»Wer ist es?«
Da entgegnete der Gefangene zur Verblüffung des ganzen Saales, während er den Arm ausstreckte und auf den Mayor deutete: »Thomas Angerer!« Für einige Sekunden herrschte tiefstes Schweigen in der City Hall. Und dann brandete die Entrüstung los.
Richter Croydon verschaffte sich Ruhe.
»Thomas Angerer?« fragte er verwundert. »Aber ich muß doch sehr bitten. Mister Angerer ist ein angesehener Mann und seit Jahren der Mayor dieser Stadt! Er selbst hat Sie ja beim Diebstahl beobachtet.«
Angerer war plötzlich bleich geworden. Er erhob sich, kam um den Richtertisch herum und blieb vor dem Gefangenen stehen.
»Sind Sie wahnsinnig, Mensch?« fragte er entrüstet. »Was haben Sie da eben behauptet?«
Der Gefangene wandte unsicher den Kopf und blickte wieder in die Zuschauermenge. Als er das Augenpaar gefunden hatte, das er suchte, hatte er neue Kraft geschöpft und wandte sich um.
»Sie haben die Anzeige gegen mich erstattet, Mister Angerer, obgleich Sie wissen, daß ich schuldlos bin. Denn Sie selbst haben das Pferd gestohlen! Es steht ja noch in Ihrem Stall! Ich verlange, daß Ihr Stall durchsucht wird. Und ehe das geschieht, werde ich dem Hohen Gericht erklären, warum Sie dieses Spiel mit mir getrieben haben. Sie wollten mich vernichten, weil Sie befürchteten, ich könnte Ihr Geheimnis verraten. Und das werde ich jetzt tun, weil Sie mich so tief ins Unglück stürzen wollten, Thomas Angerer. Sie sind ein Galgenmann! Jawohl, ein Galgenmann! Ich kann es beweisen. Daheim in Ihrem Schrank bewahren Sie mehrere graue Gesichtstücher auf. In Ihrem Flur hängen zwei Gewehre, auf deren Kolben das Dreieckzeichen der Galgenmänner eingraviert ist. Und Sie haben auch Harry Bensons Tochter entführen lassen.«
Der Mayor prallte zurück. Entgeistert starrte er dem Mann, der ihn so schwer beschuldigt hatte, in die Augen.
In diesem Moment brüllte jemand aus dem Zuschauerraum: »Das Haus des Mayors soll durchsucht werden!«
Jetzt hatte der Richter verstanden. Das also hatte Phin von ihm gewollt! Er tastete mit den Augen die Menschen im Saal ab, und plötzlich hatte er das Gesicht des Tombstoners entdeckt.
Croydon schlug mit dem silbernen Hammer dreimal auf den Tisch und erhob sich. »Ich ordne hiermit eine Untersuchung des Hauses und des Stalles von Mister Angerer an.«
»Aber, Euer Ehren, ich bitte Sie, Sie werden doch nicht den haltlosen Anschuldigungen dieses Tramps glauben.«
»Wir wollen völlig gerecht sein, Mayor«, wich der Richter gewandt aus. »Um all dem den Wind aus den Segeln zu nehmen, werde ich zusammen mit dem Sheriff und einigen anderen Männern sofort eine Lokaluntersuchung folgen lassen. Was kann Ihnen das schon ausmachen. Sie haben ja ein sauberes Gewissen!«
Leichenblaß stand der Mayor da und hatte das Gefühl, daß jetzt der Himmel über ihm einstürzen müsse. Er begriff das alles nicht. Wie hätte er es auch begreifen können, das heimtückische Spinnennetz, das ein haßerfüllter Mensch um ihn gesponnen hatte.
Die Haussuchung wurde durchgeführt, das Ergebnis war schockierend: das gestohlene Pferd befand sich in einem Verschlag hinter dem Stall des Mayors. In Angerers Hausflur wurden tatsächlich die beiden Waffen mit den Dreieckszeichen der Galgenmänner gefunden. Und in einem der Schlafzimmerschränke des Bürgermeisters entdeckte der Sheriff auch die grauen Tücher, die als äußeres Zeichen der Bande nur schon allzu bekannt waren…
Im weiteren Verlauf des Verfahrens wurde Mayor Thomas Angerer von Richter Croydon wegen Pferdediebstahls und nachgewiesener Mitgliedschaft bei einer gefährlichen Bande seines Amtes enthoben und zu lebenslänglicher Zwangsarbeit verurteilt.
Die Menschen in der Stadt waren wie vor den Kopf geschlagen. Niemand begriff, was da so urplötzlich geschehen war.
Der Mayor, der weder eine Frau noch sonst irgendeinen Verwandten in der Stadt hatte, stand völlig allein da. Und seine einstigen Freunde wagten es nicht, ihm irgendwie zu helfen.
Selbst der Lawyer Johnson traute sich nicht, ein einziges Wort für ihn einzulegen, obgleich er nicht von der Schuld des Bürgermeisters überzeugt war. Im Gegenteil, er war sogar von seiner Unschuld überzeugt. Aber er begriff das Ganze nicht. Und da er wenig Interesse daran hatte, im Dunkeln herumtappend durch eine finstere und hinterhältige Macht ins Verderben gestürzt zu werden wie Angerer, ließ er lieber die Finger davon.
Als die Menschen den Saal der City Hall verließen, wurden sie von der Nachricht über den Tod des Viehagenten überrascht.
Eine regelrechte Panik ergriff die Stadt.
In der Nacht war die Tochter des Pferdehändlers Benson entführt worden. Richter Croydon hatte den Mayor des Pferdediebstahls und der Zugehörigkeit zu den Galgenmännern überführt und zu lebenslänglicher Straflagerschaft verurteilt. Und jetzt war der vitale Viehhändler Cox am hellichten Tag in seinem Futterhaus ermordet worden!
Nogales hielt den Atem an.
Aber noch gaben sich die Drahtzieher im Hintergrund nicht zufrieden.
Aus den Fenstern und der offenstehenden Tür des Waschhauses der Witwe Morrison drangen weiße Schwaden in den Hof.
Ein etwa siebzehnjähriges Mädchen schleppte einen großen Wäschekorb ins Freie, stellte ihn ab, wischte sich das erhitzte Gesicht, und als sie aufsah, blickte es in die Mündung eines Revolvers.
Vor Judy Morrison stand ein großer Mann, der ein graues Tuch vor dem Gesicht hatte.
Der Angstschrei erstickte in der Kehle des Mädchens.
Der Mann sprang auf sie zu, preßte ihr die Hand auf den Mund, aber da sank das Mädchen schon ohnmächtig in sich zusammen.
Der Fremde nahm sie auf die Arme und rannte mit ihr hinter das Haus, wo sie von zwei anderen Männern übernommen und auf einen bereitstehenden Wagen geschafft wurde.
Erst eine halbe Stunde später vermißte die Mutter ihre Tochter, die doch nur einen Korb in den Hof hatte bringen wollen.
Judy war bisher immer sehr fleißig gewesen und hatte die Mutter nie bei der schweren Arbeit im Stich gelassen.
Als die alte Frau ins Haus ging, um sich einen Kaffee zu machen, fand sie auf dem Tisch einen Zettel, auf dem mit großen Buchstaben die Worte standen: Wo ist Gil?
Alma Morrison begriff nichts.
Es dauerte Minuten, bis sie klar denken konnte und endlich aufnahm, was da stand.
Jemand suchte ihren Sohn Gil! Judys Bruder. Der neunundzwanzigjährige Gilbert Morrison war seit drei Wochen verschwunden. Seit vielen Jahren schon war der wilde, ungebärdige Gilbert das Sorgenkind seiner Mutter. Sehr früh schon hatte er mit dem Trinken und dem Pokerspiel in den Bars von Nogales begonnen. Und vor einigen Jahren verschwand er plötzlich, wurde dann drüben in Tombstone gesehen, wo er, wie es hieß, mit den Clantons zu tun hatte.
Aber das war zu Ende, als vor zwei Jahren der Kampf im O.K. Corral stattgefunden hatte. Gil kam wieder nach Hause, um hier in der Schmiede zu arbeiten, was er früher auch getan hatte. Aber seit einigen Wochen war er jetzt wieder verschwunden.
Die alte Frau stand vor dem Tisch und starrte auf den Zettel. Hatte er etwas mit Judy zu tun? Mit ihrem Verschwinden?
Wer hatte das Papierstück hier auf den Stubentisch gelegt?
Die Frau hatte nicht die Zeit, sich länger mit den Gedanken zu befassen. Die Arbeit rief nach ihr. Bis in den späten Abend hinein schaffte sie unter unsäglichen Anstrengungen in ihrer von Dampfschwaden erfüllten Waschküche. Als sie dann ins Haus hinüberwankte und auf einen Stuhl in der Küche niedersank, ergriff plötzlich würgende Angst Besitz von ihr.
Wo war Judy?
Alma Morrison riß sich wieder hoch und lief zu ihrer Nachbarin Mrs. Lands hinüber, um der ihr Leid zu klagen. Mrs. Lands hatte einen Bruder, der einen Stern trug, es war James Lippit, einer der Deputies des Sheriffs.
Mrs. Lands rannte sofort zum Office, wo sie ihrem Bruder erzählte, was sich bei der Nachbarin ereignet hatte.
Der Hilfssheriff runzelte die Stirn.
»Wenn sich Judy nicht einfindet, müssen wir sie suchen. Ich werde sofort mitkommen.«
Er ging mit der Schwester zurück. Mrs. Morrison war bereits wieder in ihrem Haus. Sie berichtete dem jungen James Lippit alles noch einmal.
Plötzlich fiel der Blick des Deputys auf den Zettel, der immer noch auf dem Tisch lag.
Die alte Frau bemerkte den Blick des Burschen und sagte hastig: »Das Papier lag da, als ich heute nachmittag nach Judy suchte.«
Der Deputy blickte auf die Worte und forschte: »Kann Judy das nicht geschrieben haben?«
»Nein, das ist nicht ihre Schrift!«
»Trotzdem, machen Sie sich keine Sorgen, Mrs. Morrison, wir werden Ihre Tochter schon finden.«
Die Frau begann leise zu weinen. Die Tränen rannen wie kleine silberne Kugeln durch die tiefen Runen ihres pergamentfarbenen Gesichtes.
»Ich habe das dunkle Gefühl, James, daß etwas Schweres, Dunkles auf mich zukommt«, stammelte Alma Morrison.
Und dieses Gefühl täuschte sie nicht.
Es kam wirklich etwas Schweres, Dunkles auf sie zu. Ihre Tochter Judy war entführt worden; und zwar von den gleichen Männern, die Gil suchten.
Mitten in der Nacht – Mrs. Morrison lag schlaflos auf ihrem Lager – zertrümmerte ein Stein eines ihrer Stubenfenster. Die tödlich erschrockene Frau sprang auf, eilte auf zitternden Beinen und mit fliegendem Atem in den Nebenraum, zündete den Docht der alten Kerosinlampe an und sah mitten in der Stube ein weißes Knäuel liegen, das mit einer Schnur umwickelt war.
Es war ein Stein, um den ein Stück Papier gebunden war.
Die Frau schüttelte den Kopf, starrte auf die zertrümmerte Scheibe und wollte sich seufzend wieder in ihr Schlafgemach legen, als sie sich plötzlich an eine Geschichte erinnerte, die Judy ihr einmal erzählt hatte. Die Mutter wußte nicht, daß das Mädchen diese Story von ihrem Bruder Gilbert hatte.
Da war auch irgendwo ein Stein in ein Fenster geworfen worden, irgendwo in dem gefährlichen Verbrechernest Tombstone wahrscheinlich. Und um diesen Stein war ein Blatt Papier mit einer Nachricht gewickelt worden…
Hastig wandte sich die alte Frau um, nahm den Stein wieder auf und stellte die Lampe auf den Tisch. Mit zitternden Händen entfernte sie die Schnur und versuchte, den zerknüllten Zettel zu glätten.
Tatsächlich, er war beschrieben.
Aber die Buchstaben verschwammen ihr vor den Augen. Es war eine kleine, undeutliche Schrift.
Hilflos ließ Alma Morrison den Zettel auf den Tisch sinken und überlegte verzweifelt, wie sie die Worte entziffern konnte. Sie hatte früher einmal eine Brille gehabt, aber die war drüben im Waschhaus hingefallen und seitdem nicht mehr repariert worden. Es gab hier in Nogales keinen Brillenmacher. Dazu mußte man entweder nach Phoenix oder aber nach Flagstaff hinauffahren.
Wie ein gefangenes Tier lief die alte Frau durch die Stube, abgerissene Worte vor sich hin murmelnd.
Plötzlich blieb sie vor dem Vertiko stehen, von dem es ihr grünlich entgegenfunkelte.
Lag da nicht das zerbrochene Lupenglas, mit dem ihr Mann, der niemals eine Brille gehabt, aber in den letzten Jahren doch eine gebraucht hätte, die Gazette gelesen hatte?
Jetzt reflektierten die Linsenstücke das Licht, das durch den grünen Schirm der Kerosinlampe auf sie fiel.
Mrs. Morrison griff nach dem größten Scherbenstück. Judy hatte die Lupe damals im Hof fallen lassen, doch die Mutter hatte sich nicht entschließen können, das Glasstück wegzuwerfen, weil ihr verstorbener Mann noch auf dem Sterbelager damit die Gazette gelesen hatte…
»Wirf doch die Scherben weg!« Wie oft hatte Judy das gesagt. Und Gil hatte die beiden Stücke sogar schon einmal in den Abfalleimer geworfen. Aber die Mutter hatte sie gefunden und wieder herausgenommen.
Sie wischte den Staub von dem größten Glasstück und nahm dann den Zettel wieder auf.
Wie Spukbilder sprangen die winzigen mit Tinte geschriebenen Buchstaben unter dem Glas verzerrt auseinander und schienen sie verspotten zu wollen, hatten plötzlich Gesichter, grinsten sie an und verschwammen wieder, in sich zusammenkriechend wie Schneckentiere.
»Wo… ist… Gil«, las sie mühsam mit keuchendem Atem. »Wenn Gill nicht zurück… kommt, kommt… das Mädchen… auch… nicht mehr…«
Der Zettel entglitt der Hand der Wäscherin.
So einfach die Frau auch war, plötzlich hatte sie doch begriffen: Man hatte Judy entführt!
»Nein!« keuchte sie. Und sie wußte doch, daß es so war. Vielleicht wäre sie nicht einmal so schnell darauf gekommen, wenn sie nicht noch vor Stunden von Judy selbst die Sache mit Bensons Kind gehört hätte. Und vom Tod des Viehhändlers.
Was ging in Nogales vor?
Harry Bensons Tochter war in der Nacht aus dem Haus geholt worden!
Am hellichten Tag hatte man den Viehhändler Cox meuchlings ermordet!
Und nun war Judy weg!
Sie haben sie entführt! hämmerte es im Hirn der alten Frau. Sie muß von den gleichen Menschen entführt worden sein, die wissen wollen, wo Gilbert ist!
Aber das wußte sie doch selbst nicht! Sie hätte ihnen diese Frage also gar nicht beantworten können!
Kopflos lief sie in ihrer Stube auf und ab, dann kleidete sie sich plötzlich in rasender Eile an und wollte auf die Straße hinauslaufen.
An der Tür hielt sie schreckgelähmt inne. Vor ihr stand ein Mann. Groß, breitschultrig und reglos verharrte er da, wie ein Schemen aus dem Dunkel.
»Gil!« entfuhr es den bebenden Lippen der Frau.
Der Mann bewegte sich nicht.
Da wich sie zurück, klammerte sich an den Türpfeiler.
Nein, es war nicht Gil! Er konnte es nicht sein, denn der Mann da war größer!
Die Wäscherin glaubte, das Herz müsse ihr stehenbleiben.
Würgende Angst bannte sie auf die Türschwelle. Tief in sich zusammengekauert hockte sie da und starrte auf den Mann, der wie eine Wand vor ihr aufragte.
Endlich, nach Ewigkeiten, kam Leben in die Gestalt des Mannes. Er bewegte sich, drehte sich um und ging mit harten, sporenklingenden Schritten über die Straße davon.
Immer noch wie gelähmt vor Angst starrte die Frau hinter ihm her, sah ihn längst nicht mehr, lauschte aber seinem Schritt, dessen Geräusch nicht schwächer werden wollte.
Wie von Furien gejagt richtete sie sich auf und eilte ins Haus zurück.
Keuchend und nach Atem ringend lehnte sie an der Flurwand.
»Lieber Gott, was ist geschehen! Lieber Gott…«, flüsterte sie. Taumelnd tastete sie sich in ihre Stube zurück, stand am Tisch und starrte auf den Zettel. Ihr faltenzerschnittenes Gesicht wurde von einem fahlen grünen Schimmer bedeckt, den der Lampenschirm darauf malte.
Da wurde an das Hoffenster geklopft.
Die Frau griff sich entsetzt an die Kehle, glaubte sie doch, den Mann draußen stehen zu sehen.
Sie schloß die Augen und war einer Ohnmacht nahe.
Da wurde wieder gegen die Scheibe geklopft. Und plötzlich drang ganz deutlich und klar durch das zertrümmerte Nebenfenster die Stimme von Mrs. Brisbane, der Frau des Bäckers, dessen Hof an den ihren schloß: »Mrs. Morrison, ich habe Lärm gehört, ist etwas geschehen? O Gott, Mrs. Morrison! Wie sehen Sie aus! Ist Ihnen nicht gut? Warten Sie, ich komme sofort hinein!«
»Nein!« keuchte die Wäscherin, »lieber nicht. Er… läßt keinen aus dem Haus und bestimmt auch keinen herein!«
Aber die resolute Bäckersfrau schüttelte nur den Kopf und kam durch die Küchentür ins Haus. Gleich darauf erschien sie in der Stube.
»Mrs. Morrison! Um Himmels willen. Sie sind krank! Sie müssen sich sofort hinlegen.«
Da sah sie das Loch in der Scheibe, das sie von draußen nicht hatte sehen können, weil sie am Nebenfenster gestanden hatte. Die Scherben auf dem Boden hatten sie aufmerksam gemacht.
»Was ist denn geschehen?« stammelte sie, nun selbst erblassend.
Die Wäscherin taumelte zurück und sank in einen alten verschlissenen Sessel.
Da erspähte die Bäckerfrau den Stein, die Schnur und daneben den Zettel und das Lupenglas.
Sie konnte ohne Brille lesen, nahm den Zettel auf und las ihn, die Worte leise mitsprechend, mehrmals.
»Phin Clanton!« entfuhr es ihr.
Die Wäscherin zuckte zusammen.
»Phin…?« kam es gepreßt aus ihrer Kehle. »Ja, er muß es gewesen sein! Er war es. Als ich eben aus der Haustür wollte…, weil ich zum Sheriff… Zum Sheriff…«
»So beruhigen Sie sich doch, Mrs. Morrison. Warten Sie, ich werde Ihnen sofort einen heißen Tee von Kamille aufbrühen, das beruhigt.«
»Ein Mann stand vor der Haustür und ließ mich nicht auf die Straße!« keuchte die Wäscherin. »Es ist bestimmt Phin Clanton gewesen!«
*
Ein furchtbarer Tag lag hinter Harry und Ireen Benson. Nicht die geringste Spur ihres Kindes hatte sich finden lassen. So sehr der Pferdehändler sich auch bemüht hatte. Er kam spät am Abend ermattet heim und sank in seiner Wohnstube in einen der großen Sessel, schloß die Augen und zuckte zusammen, als ihn eine Stimme ansprach…
»Nichts?«
Es war die Stimme seiner Frau.
Benson sank wieder zurück.
»Nein, nichts…, gar nichts! Keine Spur!«
»Ich war viermal im Sheriffs Office, aber da konnte mir auch niemand helfen. Du warst ja auch schon dort«, stöhnte die Frau, und man konnte ihrer Stimme anhören, daß sie dem Weinen nahe war und sich große Mühe gab, es zurückkzuhalten, um den Mann nicht noch mehr zu beschweren. Ireen Benson hatte ja den ganzen Tag über heimlich geweint.
Es war still in dem großen Zimmer.
Plötzlich hörte die Frau ihren Mann in die Stille hinein sagen: »Aber ich weiß, wer sie uns genommen hat! Phin! Phin Clanton!«
Die junge Frau zuckte zusammen.
»Nein!« kam es erstickt aus ihrer Kehle. Sie hatte tagsüber von Bekannten gehört, daß der Mann aus Tombstone in der Stadt sein sollte, und daß man vermutete, er sei es gewesen, daß der Mayor vor fünf Jahren einmal – in der inzwischen niedergebrannten Mexiko Bar – eine heiße Auseinandersetzung mit Phin gehabt hätte, in der Phin nachgeben mußte, weil der Mayor plötzlich Verstärkung durch mehrere Fremde bekam, die zu einer Eisenbahngesellschaft gehörten oder auch zur Wells Fargo – man wußte das heute nicht mehr so genau.
Aber daß es Phin war, der den Mayor damals in wüstester Weise beschimpft und ihm die schlimmsten Drohungen entgegengeschleudert hatte, das wußte man noch sehr genau!
»Phin…«, stieß die Frau durch ihre von stundenlangem Weinen schmerzende Kehle. »Nein, Harry, das kann doch nicht sein… oder…« Sie stand auf und kam auf ihren Mann zu. »Oder hast du irgendwann einmal etwas mit ihm gehabt?«
Der Händler senkte den Kopf.
Zu ihrem namenlosen Entsetzen glaubte die Frau plötzlich wahrzunehmen, daß der Kopf sich bewegte, daß er nickte.
»Harry!«
Der Schrei gellte bis auf die Straße hinaus.
»Ich, ich habe etwas mit ihm gehabt, eigentlich er mit mir.«
Ganz leise hatte der Mann es durch die Zähne gestoßen.
»Wann?«
»Gestern nacht!«
»Gestern?« forschte die Frau verblüfft. »Wo…?«
»Im ›Gold-Dollar‹.«
»Du warst wieder in dieser Bar?«
»Ja, ich war wieder in dieser Bar!« Harry Benson seufzte tief, und dann beichtete er. Er berichtete alles, beschönigte nichts und beendete seine Beichte mit den Worten: »Ich erwarte nicht, daß du mich nun noch verstehst, daß du bei mir bleibst…«
Da spürte er die Hand seiner Frau auf seinem Kopf.
»Harry«, sagte sie leise. »Du wirst wohl nie vernünftig.«
Er blickte auf, suchte ihre Augen.
Unter Tränen brach es da aus ihr hervor: »Das kann es ja nicht sein, Harry! Der Mann war angetrunken und hat auf dich eingeschlagen, weil du ihn gestört hast. Aber er rennt doch dann nicht hierher, überholt dich, um unser Kind aus dem Bett zu nehmen!«
»Doch, Ireen, er war es.«
»Er kann es doch gar nicht gewesen sein!«
»Doch. Ich bin nämlich nicht gleich nach Hause gegangen. Ich war noch im Frontier-Saloon. Ziemlich lange sogar. Inzwischen hat er den Galgen aufstellen lassen, dieser Satan…«
In tiefster Verzweiflung sank der Mann in sich zusammen. Und jetzt, in der Not, zeigte die Frau ihre wahre Größe. Die Niedergeschlagenheit, der völlige Zusammenbruch ihres Mannes gab ihr eine neue, ungeheure Kraft.
»Es ist noch nichts verloren, Harry!«
»Doch, alles ist verloren. Und es ist eine Strafe für mich, eine gerechte Strafe. Weil ich die Nähe dieses Frauenzimmers gesucht habe, dieser billigen Person…«
»Mach dich doch nicht selbst krank mit diesem Gedanken, Harry. Ich denke, es ist vorbei… und…?es ist doch vorbei?« fragte sie leise.
Der Mann blickte auf.
»Ja, Ireen, das schwöre ich dir! Es war ja ohnehin nichts. Eine Verwirrung, hervorgerufen durch den Alkohol. Von heute an werde ich keinen Tropfen Alkohol mehr anrühren! Ich schwöre es dir hier beim Leben unseres Kindes…«
Da preßte die Frau die Hände vors Gesicht. »Beim Leben unseres Kindes«, wiederholte sie schluchzend.
Harry Benson erhob sich und trat ans Fenster. Mit leeren Augen starrte er in die Nacht hinaus, die ihr schwarzes Tuch über die Straße gebreitet hatte.
Unter den Dächern der Häuser nistete die Angst. Die Angst vor einem einzigen Mann, vor Phin Clanton!
*
Sie waren auf dem Weg nach Nogales.
Fahler Mondschein lag über der Savanne. Von Westen her war ein Wind aufgekommen, der den Reitern feinen Flugsand entgegentrieb, ihre Poren verstopfte und ihre Augen brennen ließ.
Curle Shibell hatte sich, wie die anderen, ein Tuch vors Gesicht gebunden. die Augen zusammengekniffen, so starrte er vor sich hin. Jetzt wandte er den Kopf und sah den Missourier an.
»He, Marshal!« rief er krächzend dem neben ihm reitenden Mann zu. »Wie haben Sie sich das gedacht? Bilden Sie sich etwa ein, daß ich noch weiter mit Ihnen reite? Das ist doch Wahnsinn!«
Wyatt Earp wandte den Blick nicht vom Weg, der ohnehin nur schlecht zu sehen war.
Shibell röhrte ihm zu: »Marshal! Merken Sie nicht, daß der Wind immer stärker wird!«
»Doch«, entgegnete der Missourier jetzt, »ich merke es.«
»Und? Bestehen Sie immer noch darauf, diesen Irrsinnsritt fortzuführen?«
»Wenn es ein Irrsinnsritt wäre, Shibell, hätte ich ihn erst gar nicht angetreten.«
»Sie wollen also wirklich immer noch nach Nogales?«
Jetzt blickte der Marshal ihn an. »Was haben Sie denn gedacht? Glauben Sie, ich ritte zum Spaß hier durch die Nacht?«
»Nein, das habe ich wirklich nicht angenommen, aber ich hielt Sie bisher für einen vernünftigen Mann. Das, was uns da entgegenkommt, verstärkt sich doch von Minute zu Minute. In einer Viertelstunde ist es der reinste Orkan.«
»Nicht ausgeschlossen – trotzdem – wir müssen nach Nogales!«
»Aber wir haben doch höchstens ein Viertel unseres Weges hinter uns.«
»Ich weiß.«
Der Marshal blickte wieder nach vorn, und Shibell gab es auf, ihn weiter anzusprechen, da es offensichtlich zwecklos war.
Der Ritt ging weiter nach Südwesten dem fernen Ziel an der mexikanischen Grenze entgegen.
Der Wind wurde stärker, wuchs sich zum Sturm aus und trieb den Männern den scharfen Sand in die Gesichter.
Wyatt hatte schon eine ganze Weile die links aus dem Tiefland ansteigenden Steinplateaus beobachtet, schwenkte jetzt etwas vom Kurs ab und hielt auf die Felsen zu.
Holliday, der links neben ihm ritt, blickte ihn an.
Wyatt rief ihm zu: »Vielleicht kommen wir da auch vorwärts!«
Der Spieler zog die Schultern hoch und ließ sie wieder fallen.
Luke Short, der den anderen folgte, die hinter Wyatt Earp und Doc Holliday ritten, schwieg. Auch er ahnte, was der Marshal vorhatte, als die Richtung geändert wurde.
Das Land vor den Felsen war sandig und wurde von Meile zu Meile steiniger und unwegsamer; dennoch hielt der Marshal auf die Felsen zu.
Kurz bevor sie sie erreichten, wurde der Boden so unwegsam; daß sie von den Pferden steigen mußten.
Wieder schrie Shibell durch den Sturm: »Earp! Das ist doch Unsinn! Was haben Sie denn vor? Hier kommen wir doch niemals vorwärts!«
»Lassen Sie das meine Sorge sein«, entgegnete er Marshal und war in seinem Innern doch nicht davon überzeugt, daß er hier in diesem Steingewirr noch vorwärts kommen würde.
Aber sie hatten ja keine Wahl. Draußen auf der freien Savanne konnten sie nicht bleiben, da sich der Wind tatsächlich zum Sturm entwickelt hatte und nicht abzusehen war, was noch daraus werden konnte. Die Luft war so staubgeladen, daß sie selbst durch die Halstücher nur noch mit Mühe atmen konnten.
Zufällig sah der Marshal, als er einen Blick zurück in die Savanne warf, etwa dort, wo sie jetzt sein müßten, wenn sie auf dem alten Kurs geblieben wären, einen schwarzen, steilen Strich von der Erde aufsteigen.
Eine Windrose!
Also ein Orkan, ein trockener Blizzard!
Wyatt ging jetzt rascher vorwärts, um den anderen das drohende Bild zu ersparen.
Aber Shibell hatte den Blick des Marshals verfolgt und wohl den Schrecken in seinen Augen gesehen.
»Da! Ein Blizzard!« brüllte er mit sich überschlagener Stimme »Sehen Sie sich das an, Earp!«
Der Marshal gab ihm keine Antwort. Das wäre auch gar nicht notwendig gewesen, denn in diesem Augenblick erfüllte ein ohrenbetäubendes Donnergetöse die Luft und ließ den Boden erzittern.
Die Männer waren unwillkürlich stehengeblieben. Mit weit aufgerissenen Augen starrten sie auf die Windrose hinüber, die sich jetzt nach oben zusehends verbreiterte.
Im fahlen Mondlicht wirkte das Bild besonders unheimlich und gespenstisch.
Der Marshal wandte sich ab und setzte seinen Weg fort.
Shibell blieb noch stehen. Da bekam er von Doc Holliday einen derben Stoß in die Seite.
»Gehen Sie weiter!«
Der Kopf des Sheriffs flog herum. Er blitzte den Spieler an: »Was fällt Ihnen ein! Lassen Sie mich in Ruhe. Ich bleibe hier!«
Es machte nur Klick hinter ihm – und Curle Shibell sah in der rechten Faust des Spielers einen Revolver blinken.
»Ihr seid ja alle wahnsinnig«, fauchte er. Dann wandte er sich, zerrte seinen Gaul hinter sich her und folgte dem Marshal.
Jetzt gingen die Männer im Gänsemarsch auf die von ihnen aufsteigenden kahlen Felsen zu, die hier schon eine Höhe von mehr als hundert Fuß erreichten.
Der Marshal hielt beharrlich auf eine Kluft zu, die sich wie ein schwarzer Strich durch das kreidig wirkende Gestein zog.
Als er sie erreicht hatte, gähnte ihm aus der kaum fünf Yard breiten Schlucht fast völlige Finsternis entgegen.
Shibell, der ihm dichtauf gefolgt war, blieb wieder stehen.
»Mann, Sie haben doch nicht etwa die Absicht, uns da hineinzuführen?« brüllte er.
Der Missourier stampfte vorwärts.
Shibell hatte keine andere Wahl, da er den Spieler dicht hinter sich wußte, und ging auch weiter.
So zogen sie denn in die schmale Schlucht, deren Wände, je tiefer sie eindrangen, himmelanstiegen. Unheimlich wurde das Hufgeräusch der Pferde von ihnen zurückgeworfen, brach sich in vielfachem Echo und schleuderte donnerndes Getöse in die Enge der Kluft.
Die Männer sahen nichts mehr. Sie folgten nur noch einer dem anderen, immer dicht dem vorantrottenden Pferd folgend.
Der Boden der Schlucht, der anfangs noch verhältnismäßig glatt gewesen war, wurde plötzlich steinig, und zwar so sehr, daß ein Hinübersteigen immer schwieriger wurde und schließlich fast ausgeschlossen zu sein schien.
Der Marshal blieb stehen.
Nach und nach kamen auch die anderen zum Stehen.
Da meldete Shibell sich wieder: »Was jetzt? Jetzt stecken wir hier mitten in einer Schlucht! Was weiter, Marshal? Ich will es Ihnen sagen, Ihr großartiger Weg ist hier zu Ende!«
»Ende… Ende… Ende!« hallte es donnernd von den Felswänden zurück.
Doc Holliday zündete sich eine Zigarette an.
»Halten Sie endlich den Mund, Shibell, sonst läuft mir die Galle über. Seien Sie froh, daß wir aus dem Sturm heraus sind.«
»Wenn wir diesen Ritt nicht angetreten hätten, wären wir gar nicht in diesen Sturm gekommen.«
»Ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen den Mund halten«, fuhr ihn der Spieler an.
Wyatt hatte indessen unentwegt die sich scharf in den Himmel abhebenden Konturen der Felskanten beobachtet. Plötzlich machte er eine seltsame Entdeckung: Links über ihm bogen die Felskanten scharf ab.
Was hatte das zu bedeuten?
Er ließ die Zügelleinen seines Pferdes fallen, ging vorwärts, bis er die Wand erreicht hatte, und tastete sich an ihr entlang weiter. Zu seiner Verwunderung stellte er fest, daß die Schlucht hier einen Seitengang hatte, einen Felsspalt, der scharf nach Westen führte und der von der Hauptschlucht aus nicht so leicht in der Dunkelheit entdeckt werden konnte, da die Felsen oben so dicht zusammenkamen, daß man unten von der Sohle der Schlucht aus den schmalen Himmelsstreif, den man vorn in der großen Kluft noch hatte wahrnehmen können, nicht mehr sah.
Auch hier eine enge Schlucht, aber mit besserem Boden, und, seltsamerweise, auch frischerer Luft.
Wyatt ging zurück, nahm seine Zügelleinen auf und rief den anderen zu: »Wir müssen hier rechts abbiegen!«
Er ging voran.
Das ist meine Chance! zuckte es durch den Schädel Shibells. Er ließ seine Zügelleinen fallen, huschte vorwärts und ließ sein Pferd dem Hengst des Marshals folgen. Er selbst aber blieb in der Schlucht, und an ihm vorbei trottete der übrige Treck. Nicht einmal der sonst so überwache Georgier bemerkte seine Flucht, da er weder etwas sehen noch bei dem Echogetöse etwas hören konnte.
Wyatt blieb nach etwa hundert Schritt stehen und rief zurück: »Doc?«
»Hier!« antwortete der Spieler.
»Wo ist Shibell?«
Holliday schob sich ohne zu antworten sofort an dem Pferd des Sheriffs vorbei und stellte zu seinem Schrecken fest, daß das Tier dem Falben des Marshals direkt folgte.
Shibell war also nicht mehr in der Reihe.
»Fort?« fragte der Marshal von vorn.
»Yeah, scheint so«, entgegnete der Spieler und zwängte sich an den anderen Tieren und Männern vorbei, zurück, bis er den Texaner erreicht hatte.
»Shibell ist weg!«
»Shibell? Ich hätte ihn doch bemerken müssen.«
»Nein, wahrscheinlich ist er schon verschwunden, als wir hier in die Kluft abbogen.«
»Ich werde nach ihm suchen.«
»Ich bin schon unterwegs«, entgegnete der Gambler. »Passen Sie nur auf, daß Chandler nicht auch entwischt.«
Er ging zurück, bis er die Einmündung in die größere Schlucht erreicht hatte, blieb stehen und lauschte in die Dunkelheit. Aber jetzt erfüllte der Blizzard die Gesteinskluft mit einem Höllenlärm und hinderte den Georgier dran, den Schritt des Flüchtenden wahrzunehmen.
Holliday ging sofort weiter, stieß mehrmals gegen scharfes vorspringendes Gestein und erreichte schließlich das Ende der Schlucht, trat ins Freie, blickte in die Savanne hinaus – und erhielt in diesem Augenblick einen fürchterlichen Schlag auf den Schädel, der ihn sofort niederstreckte.
Er fiel vornüber in den Sand und blieb reglos liegen.
Curle Shibell hatte ihm einen Hinterhalt gelegt. Er war in rasender Eile durch die Schlucht gestürmt, ihrem Ausgang entgegen, und als er im Freien war, hielt er inne.
Was konnte er tun?
Ganz sicher würde der Marshal oder Doc Holliday seine Flucht sehr bald entdecken. Sie würden ihm folgen und ihn mit ihren Waffen an der weiteren Flucht zu hindern wissen.
Da sah er vor sich am Boden einen faustgroßen Stein liegen, nahm ihn auf, wandte sich um und starrte auf das zackige Gestein neben dem Schluchtausgang. Sein Plan war gefaßt. Er schob sich an die Felsen und zerrte sich daran hoch. Etwa fünf Yard hatte er sich schon vom Boden entfernt, als er plötzlich zu seinem Schrecken die Schritte seines ersten Verfolgers hörte.
Dann trat der Mann hinaus ins Freie, und in dem Augenblick, als er sich umwenden wollte, traf ihn der Stein aus dem Hinterhalt.
Shibell starrte zunächst erschrocken auf den Niedergestreckten, sprang dann aber herunter, zerrte dem Spieler die Revolver aus den Halftern und hastete an den Felsen entlang davon. Aber er hatte noch nicht hundertfünfzig Yard hinter sich gebracht, als er vom Sturm gepackt und gegen den Fels gedrängt wurde. Mit unheimlicher Kraft stob ihm der Sand entgegen, verstopfte alle seine Poren, drang in die Nasenlöcher, in die Augen und in die Ohren ein. Prustend und keuchend wandte er sich um und preßte den Schädel gegen den kühlen Stein.
Er wußte, daß es nur in der Schlucht Rettung für ihn gab. Aber vor deren Ausgang lag der Mann, den er mit dem Stein niedergestreckt hatte.
Er konnte nicht zurück, weil es ihn vor diesem Anblick grauste.
Hier draußen aber gab es keine Rettung für ihn. Er würde im pulverfeinen Flugsand, den ihm der Sturm tosend entgegenwirbelte, ersticken.
Verzweifelt tastete er sich weiter, suchte eine Nische in dem Fels. Aber der war hier so glatt, daß nicht einmal eine Maus hätte Unterschlupf finden können.
Der Mann preßte sich ein Halstuch vors Gesicht und blinzelte in die Nacht, schob sich mit dem Körper den Fels ertastend, wieder zurück. Und plötzlich gewahrte er eine Rinne, einen Riß im Gestein, in den er seinen Körper hineinschieben konnte. Aber der Riß war geknickt, so daß er vornübergebeugt darin hing und schwer nach Atem rang. Zwar erreichte ihn der Sturm nicht mehr, aber der Sand folgte ihm auch in diese Nische. Es half nichts. Er mußte wieder hinaus, denn nur in der Schlucht, aus der er geflohen war, gab es Zuflucht.
Als er bis auf zwanzig Yard an den Schluchtausgang gekommen war, sah er, vom Sand schon halb zugeweht, den dunklen Körper liegen. Panische Furcht packte ihn.
Er rannte vorwärts, wußte kaum, was er tat, als er sich plötzlich über den Niedergestreckten bückte, ihn hochriß und zurück in die Schlucht schleppte. Wenige Yards hinter dem Ausgang ließ er ihn nieder, wandte sich um und hastete in die Schlucht zurück. Immer wieder stehenbleibend, lauschte er nach vorn. Und als er außer dem Heulton des Sturmes draußen, das jetzt auch die Schlucht donnernd erfüllte, nichts vernehmen konnte, eilte er weiter, sich mit beiden schon wundgestoßenen Händen an der Wand entlang tastend, in die Tiefe der Schlucht hinein. Schweißtriefend blieb er stehen. Nein, hier in dieser Finsternis konnte er nicht bleiben. Langsam tastete er sich zurück, dem Eingang entgegen.
Wilde Angst stieg in ihm auf. Wäre er nicht doch besser bei den anderen geblieben? Dann läge jetzt nicht der Tote da vor ihm.
Was hatte diese Flucht überhaupt für einen Sinn? Er hatte weder ein Pferd noch konnte er hoffen, dem Marshal wirklich zu entkommen.
Er klammerte sich an das Gestein und durchstieß einen heiseren Fluch durch die Zähne. Dann stürzte er plötzlich in panischer Angst über den leblosen Körper, richtete ihn halb auf und schüttelte ihn.
»Doc!« schrie er. »Doc! So wachen Sie doch auf!«
Aber seine Schreie wurden ihm vom Sturm von den Lippen gerissen, und der Körper des Georgiers glitt zurück auf den Boden.
Wyatt stand neben seinem Falben und lauschte mit angespannten Sinnen in die Dunkelheit. Das Geräusch, das die Pferde in der Schlucht verursachten, wurde jetzt übertönt von dem Dröhnen und Brausen des Blizzards, der draußen auf der Savanne tobte.
Gern wäre der Marshal dem Georgier gefolgt, um mit ihm zusammen den Geflüchteten zu suchen, aber es war ein Risiko für Earp, seinen Platz hier zu verlassen; denn dann hätte Luke Short den Schießer und den Neger allein bewachen müssen. Es wäre ein starkes Ansinnen gewesen, denn selbst wenn der Neger es nicht gewagt hätte, sich von der Seite des Texaners zu entfernen, so mußte doch damit gerechnet werden, daß der Schießer die Situation ausnutzen würde. In der Dunkelheit bedeuteten die beiden Männer eine zu große Gefahr für einen einzelnen Wächter, der obendrein noch die Pferde zu bewachen hatte.
»Luke!« rief der Missourier.
Der Texaner antwortete sofort: »Marshal?«
»Können Sie den Doc hören?«
»Nein.«
Wyatt preßte die Zähne aufeinander. Er wußte genau, was es bedeutete, in der Dunkelheit einem Mann zu folgen, der sich hinter jedem Felsvorsprung, in jedem Riß verstecken konnte, um einen Verfolger vorüberzulassen und dann anzufallen. Zwar war der Georgier ein vorsichtiger und unerhört reaktionsschneller Mann, aber in der Schlucht befand er sich dem Verfolgten gegenüber, da das Dröhnen und Brausen des Orkans jedes andere Geräusch übertönte, gewaltig im Nachteil.
Sie warteten. Stumm und verbissen standen sie neben ihren Pferden. Wyatt Earp vorn vor dem Trupp, Luke Short an seinem Ende.
Eine Viertelstunde war vergangen.
Da wandte sich der Marshal um, ließ die Zügelleinen seines Hengstes fallen und schob sich an Hollidays Pferd vorbei, bis er vor Chandler stand.
»Kommen Sie mit.«
Der Schießer zischte: »Ich denke nicht daran.«
Wyatt packte ihn am Arm und stieß ihn vor sich her. Dann war er bei dem Neger.
»Los, geh voran, Black Boy!«
Der Schwarze gehorchte sofort, schritt vor dem Schießer her, bis er den Texaner erreicht hatte.
Luke Short packte ihn sofort bei der Brust.
»He, was los?«
Da hörte er die Stimme des Marshals von hinten.
»Luke, ich muß den Doc suchen!«
»Ja, das Gefühl habe ich auch«, preßte der Riese durch die Zähne. »Sie können ruhig gehen, ich halte die beiden hier fest, darauf können Sie sich verlassen. Und ehe, daß mir einer entwischt, zerdrücke ich ihn da an der Felswand. Habt ihr es gehört, ihr Halunken?«
Die beiden schwiegen auf diese Drohung.
Wyatt schob sich an der Felswand entlang, bis er in die Hauptschlucht kam. Dort war das Dröhnen und Brausen noch bedeutend stärker als in der kleinen Kluft, in der sich Luke mit den anderen befand.
Der Marshal duckte sich tief an den Boden nieder und kroch langsam und vorsichtig vorwärts.
Er war jetzt davon überzeugt, daß dem Gambler etwas passiert sein müßte, denn unmöglich konnte der so lange bis zum Ausgang der Schlucht gebraucht haben; und selbst wenn er Shibell nicht gefunden haben sollte, wäre er längst zurück gewesen. Natürlich war es nicht ausgeschlossen, daß Shibell sich auch nach rechts in das Geröll gewandt hatte. Aber dort gab es für ihn kaum ein Weiterkommen.
In jedem Fall müßte sich Holliday längst gemeldet haben.
Vorsichtig bewegte sich der Missourier vorwärts. Es dauerte eine ganze Weile, bis er vorn den Lichtschein der hellen Savanne in den Eingang der Kluft dringen sah.
Etwa noch siebzig Yard, kaum mehr, befand er sich vom Ausgang der Schlucht entfernt.
Ganz tief legte er sich jetzt an den Boden nieder und kroch rechts an der Wand entlang wie ein Indianer vorwärts. Plötzlich hielt er inne. Vom Schwarz der Mauer hob sich – wohl sechs Fuß vom Boden entfernt – etwas ab, das kaum ein Gesteinsstück sein konnte. Es war die Silhouette eines Mannes, der sich an den Fels preßte.
Wyatt bewegte sich noch lautloser vorwärts, und als er bis auf etwa fünfundzwanzig Yard an den Mann herangekommen war, stellte Wyatt fest, daß es nicht Doc Holliday war.
Dieser Mann, der sich da an den Fels gepreßt hatte, war niemand anders als Sheriff Shibell!
Wo war Doc Holliday?
Wyatt kroch nur Zoll um Zoll vorwärts, um den Mann nicht auf sich aufmerksam zu machen.
Das Brausen und Röhren des Sturmes war jetzt so stark geworden, daß es sich in der Schlucht hier zu einem wahren Inferno auswuchs. Das bot dem Missourier die Möglichkeit, an den Mann heranzukommen, ohne von ihm gehört zu werden.
Als Wyatt sich etwa bis auf zehn Schritt an den Mann herangeschlichen hatte, hielt er wieder inne. Denn jetzt hatte er etwas entdeckt.
Unten auf der Schluchtsohle lag ein dunkler Körper. Der Körper eines Menschen.
Doc Holliday!
Augenblicklich schnellte der Marshal hoch und federte in weiten Sätzen auf Shibell zu.
Der hatte das Geräusch gehört, stieß sich von der Wand ab und suchte zu entkommen.
Aber der Missourier hatte Sehnen und Muskeln wie aus Stahl. Er schnellte wie eine Raubkatze vorwärts, und noch bevor Shibell das Freie erreicht hatte, riß ihn der Marshal in weitem Hochsprung nieder.
Wyatt war sofort wieder auf den Beinen, packte Shibell, riß ihn hoch und schleuderte ihn in die Schlucht zurück.
Der Sheriff stolperte, kam wieder hoch, wandte sich um und wollte in das Dunkel der Schlucht flüchten.
Da aber hatte ihn der Marshal erneut erreicht, packte ihn am Arm und stieß ihn gegen das Gestein.
Shibell spürte, daß der Marshal ihm einen Revolver auf die Brust preßte.
»Bleib stehen, Mensch!« schrie ihn Wyatt durch das Getöse des Orkans an.
Sie hatten beide ihre Hüte verloren. Die Haare wehten ihnen in die Gesichter.
Da sie noch im Eingang der Schlucht standen, konnte der Marshal das Gesicht des Sheriffs verhältnismäßig deutlich sehen. Es war verzerrt – vor Angst.
»Was hast du mit ihm gemacht?«
Shibell keuchte: »Was soll ich gemacht haben? Ich war auf der Flucht, und er verfolgte mich. Als ich den Ausgang erreicht hatte, stieg ich den Felsen hinauf.«
»Und? Weiter!« donnerte ihn der Marshal an und preßte ihn härter gegen die Wand.
»Ich… habe einen Steinbrocken in der Hand gehabt… und nach ihm geworfen.«
Da legte der Missourier den Kopf auf die Seite, stieß den Revolver ins Halfter zurück, riß Shibell mit der Rechten dicht an sich heran und fauchte ihm ins Gesicht: »Wenn er tot ist, Curle, dann Gnade dir Gott!«
In diesem Augenblick geschah es. Wyatt hörte ein Geräusch wie von dumpfem, trommelndem Hufschlag.
Der Marshal starrte in den Sturm hinaus auf die Savanne!
»Indianer!« entfuhr es ihm plötzlich.
Shibell ächzte: »Lassen Sie mich los! Was haben Sie denn?«
»Schweig!« herrschte ihn Wyatt an.
Shibell hatte noch nichts gehört. Er versuchte nur, sich mit klammen Händen von dem eisernen Griff des Marshals zu befreien.
Der trommelnde Hufschlag kam näher und wurde jetzt so stark, daß ihn auch der Sheriff hätte hören müssen.
Aber der war wie von Sinnen vor Angst.
»Lassen Sie mich doch los!«
Wyatt stieß ihn an die Wand zurück und preßte die Zähne aufeinander.
»Da, hören Sie es nicht, Shibell!« Er deutete in die Prärie hinaus.
Jetzt vernahm auch der Sheriff den dumpfen Hufschlag. »Allmächtiger!« entfuhr es ihm. »Indianer!«
»Los, zurück in die Schlucht! Wir müssen Holliday mitnehmen!«
Er ergriff den Spieler unter den Armen, und Shibell packte die Füße.
»Los, schneller!« gebot der Marshal, denn er hatte plötzlich das unheimliche Gefühl, daß die Indianer auf die Schlucht zuhalten würden. Wie viele mochten es sein? Aber das war jetzt völlig unwichtig. Holliday mußte hier weg!
»Los, schneller!« herrschte er Shibell an.
Gemeinsam schleppten sie den Georgier vom Eingang weg. Da aber preschte schon der erste Reiter in die Schlucht, stieg vom Pferd und beeilte sich vorwärtszukommen, um den Nachfolgern Platz zu machen.
Wyatt war sofort stehengeblieben, hatte den Spieler niedergelegt und sich neben Shibell an die Wand gepreßt.
Da war der Mann schon dicht vor ihnen.
Ein Indianer! Wyatt erkannte seine Silhouette nur schwach.
Der Mann stockte plötzlich, denn er hatte Shibells helles Hemd gesehen.
Wyatt schnellte ihm entgegen und warf ihn mit einem Faustschlag nieder. Der Indianer sank lautlos vornüber und blieb vor seinem Pferd liegen.
Die anderen drängten nach.
Wyatt zog das gescheckte Pferd vorwärts, packte den Besinnungslosen und zerrte ihn neben Holliday an die Wand.
Den nächsten Roten überraschte er auf die gleiche Weise, gewahrte aber nicht den dritten, der neben diesem gegangen war, und der ihm jetzt in den Rücken fiel.
Da war Shibell da, warf sich dem Indianer entgegen und riß ihn zu Boden.
»Wyatt, hier ist noch einer!«
Der Missourier wirbelte herum, packte den Gegner und schob ihn hinüber an die Wand.
»Damned, wie viele kommen da noch?« keuchte er.
Es war keiner mehr. Es waren nur drei Reiter gewesen.
Wyatt trieb die Pferde weiter in die Schlucht und stand neben Shibell und dem dritten Indianer, den er an den Boden gedrückt hatte.
»Seid ihr Apachen?« fragte er den Roten.
Der keuchte: »Der weiße Mann soll mich loslassen.«
»Ich werde dich loslassen, Roter Mann, wenn du mir gesagt hast, zu welchem Stamm du gehörst.«
»Wir sind Apachen.«
»Seid ihr allein?«
»Wir drei, ja.«
Das war eine sehr geschickte Antwort. Höchstwahrscheinlich befanden sich also noch mehr Rote in der Nähe. Doch Wyatt hatte es jetzt nur mit diesen dreien zu tun. Einer der beiden Niedergeschlagenen richtete sich auf.
Wyatt stieß Shibell an. »Los, passen Sie auf die Kerle auf.«
Shibell zerrte sie vom Boden hoch und schob sie vor sich her, daß er sie gegen das Licht des Eingangs gut bewachen konnte.
Wyatt ließ den Mann, den er an den Boden gedrückt hatte, aufstehen und fragte ihn rauh: »Was wollt ihr hier?«
Der Rote zischte: »Diese Frage müßte ich an den Weißen Mann richten. Die Berge hier gehören zum Apachenland. Zum Land der Mescaleros.«
»Was sucht ihr hier in der Schlucht?«
»Darauf habe ich dem weißen Mann keine Antwort zu geben.«
Wyatt zog seinen Buntline Special und richtete ihn dem Indianer auf die Brust. Knackend spannte er den Hahn.
»Doch, Roter Mann, du wirst mir sehr wohl eine Antwort darauf geben.«
Der Indianer preßte die Zähne aufeinander und stieß hervor: »Wir haben hier in der Felsschlucht Schutz vor dem Sturm gesucht. Genau wie ihr.«
»Well«, entgegnete der Marshal, ließ ihn los, zog ihm das Messer und auch einen Revolver aus dem Gurt, warf beides auf den Boden, und entwaffnete dann auch die beiden anderen Apachen.
»Ihr könnt hierbleiben, bis der Sturm vorüber ist.«
Der Indianer, der mit ihm gesprochen hatte, maß ihn mit einem langen, sinnenden Blick, trat dann nach vorn in den Schluchteingang und starrte in die Savanne hinaus.
Seine beiden Gefährten folgten ihm.
Wie aus Stein gehauen standen die drei Gestalten zwischen den himmelragenden Wänden der Schlucht.
*
Wyatt packte Shibell am Arm.
»Hier haben Sie einen Revolver. Und jetzt hören Sie genau zu! Sie passen auf die drei Kerle da vorn auf, während ich nach Doc Holliday sehe. Und wehe Ihnen, wenn Sie auf dumme Gedanken kommen sollten. Well, Sie können mich vielleicht über den Haufen schießen, aber ich schwöre Ihnen, daß Luke Short Sie suchen und finden wird!«
Er schob Shibell so vorwärts, daß er ihn wenigstens noch aus den Augenwinkeln sehen konnte und beugte sich dann über den Freund, der immer noch bewegungslos an der Erde lag. Er tastete seinen Kopf ab, und als er nirgends eine Wunde finden konnte, preßte er das Ohr an Hollidays Brust, um nach dem Atem zu horchen.
Das Herz schlug – und er atmete, wenngleich der Atem nur schwach wahrzunehmen war.
Wieder tastete er ihn ab und fand jetzt hinten seitlich am Schädel eine starke Anschwellung. Dort mußte ihn der Stein getroffen haben.
In diesem Moment schlug der Spieler die Augen auf.
Wyatt sah den dünnen phosphoreszierenden Schimmer seiner Augen und bückte sich tiefer über den Gefährten.
»Doc!«
Keine Antwort.
Der Marshal preßte seine großen starken Hände um das Gesicht des Freundes.
»Doc! Hören Sie mich?«
Auch jetzt erhielt er keine Antwort.
Wyatt zerrte sich die Weste vom Leib, rollte sie zusammen und legte sie dem Georgier vorsichtig unter den Kopf.
»Shibell!« flüsterte er dicht hinter dem Sheriff. »Ich muß zurück zu den anderen.«
»Sind Sie des Teufels!« gab der entsetzt zurück, ohne sich umzuwenden. »Sie wollen mich doch nicht mit den drei Wilden hier allein lassen?«
»Ich brauche Wasser!«
Da wandte sich der Indianer um, mit dem der Marshal vorhin gesprochen hatte, und sagte dann mit gutturaler Stimme: »Ich habe Wasser.«
Die beiden Weißen starrten ihn verblüfft an.
Er hatte also ihr leise geführtes Gespräch trotz des Sturmes über eine Distanz von wenigstens vier Schritt mit angehört.
Wyatt schob sich an Shibell vorbei und ging auf den Apachen zu.
»Mein Name ist Earp. Es tut mir leid, daß ich euch vorhin so rauh empfangen habe…«
Da wandte sich ihm der Indianer, der der Anführer der drei zu sein schien, zu und entgegnete: »Der weiße Mann hatte kaum eine andere Wahl.«
»Ich habe da einen Freund liegen, der von einem Steinschlag getroffen wurde.«
Der Rote wandte sich sofort um, flüsterte seinen Kameraden etwas zu, dann nahm einer von ihnen eine Fackel aus der Tasche seiner Satteldecke und zündete sie an.
»Ich bin Weiße Feder. Kann ich deinen Freund sehen?« fragte der Mann, mit dem Wyatt gesprochen hatte.
»Weiße Feder? Dann bist du der Häuptling der Mescaleros vom großen Stamme der Apachen?«
»Du kennst meinen Namen?«
»Ich habe viel von dir gehört. Verstehst du etwas von Verletzungen?«
»Ja«, entgegnete der Rote knapp und ging vorwärts, während sein Kamerad die Fackel hielt.
Da blieb Weiße Feder plötzlich stehen.
Wyatt, der schräg hinter ihm ging, blickte nach vorn und sah Curle Shibell mitten im Gang stehen, den Revolver in der vorgestreckten Faust.
»Nehmen Sie den Colt runter, Shibell«, rief ihm der Marshal zu.
»Ich denke nicht daran!«
»Wollen Sie mich etwa bedrohen?«
»Nein – aber dieses rote Pack da!«
Da schob sich der Missourier an dem Häuptling vorbei, ging auf Shibell zu und streckte ihm die Hand entgegen.
»Den Colt!«
»Nein!«
Das rote Licht der Fackel warf einen geisterhaften Schein in die Schlucht.
Da packte Wyatt zu, bekam den Arm des Sheriffs zu fassen, und entwand ihm die Waffe.
Shibell torkelte zurück.
»Das werden Sie bereuen, Wyatt! Diese roten Schufte blasen uns alle aus! Wenn Sie dem Kerl da glauben, sind Sie nicht mehr zu retten. Ich kenne die Indsmen genau und weiß, daß sie sich immer in kleinen Gruppen durch die Gegend treiben! Die drei Kerle sind nicht allein. Und sie verhalten sich nur so friedlich, weil sie genau wissen, daß die anderen kommen und über uns herfallen werden. Sehen Sie doch bloß diese Gesichter an!«
Der Marshal wandte sich um und blickte in das Gesicht des Mannes, der behauptet hatte, er sei der Häuptling Weiße Feder. Wie aus Bronze gegossen war dieses Antlitz, und in den schwarzen Augen blitzte es auf.
Hochaufgerichtet stand der Apache da. Aber er sagte kein Wort.
Der Missourier kannte die roten Männer selbst gut, viel besser als Shibell, der sie sein ganzes Leben nur gehaßt hatte. Und Wyatt war fest davon überzeugt, daß dieser Indianer ihm die Wahrheit gesagt hatte.
Er stand jetzt vor ihm, senkte den Blick in die Augen des Roten und sagte halblaut: »Da liegt mein Freund. Ich wäre froh, wenn du ihm helfen könntest.«
Der Indianer bückte sich, tastete Hollidays Schädel ab, wandte sich dann um und befahl dem Mann, der neben dem Fackelträger stand: »Hol meine Tasche!«
Er hatte es auf englisch gesagt, um die beiden Weißen nicht mißtrauisch zu machen.
Dennoch stieß sich Shibell von dem Fels ab, an den er sich gelehnt hatte und keuchte: »Wenn Sie das zulassen, Wyatt, sind Sie für mich ein Selbstmörder!«
»Schweigen Sie!«
Shibell stand vor dem Marshal und ballte die Fäuste. Mit schiefgelegtem Kopf brüllte er: »Sie sind irrsinnig, Earp! Der Kerl holt eine Kanone aus der Satteltasche und knallt uns beide ab.«
»Ich habe gesagt, daß Sie still sein sollen!«
»Er knallt uns ab!«
»Nein, das wird er nicht tun, wenn ihm nämlich etwas am Leben des Häuptlings liegt!«
»Häuptling? Pah! Dieser Bursche ist so wenig ein Häuptling wie die zwei anderen da!«
Wyatt gab dem Roten einen Wink, dem Wunsch des Häuptlings nachzukommen.
Weiße Feder erhielt eine Campflasche, die mit Leder umwickelt war, goß etwas von der Flüssigkeit über den Kopf des Georgiers und nahm dann mehrere Blätter aus der Tasche, die er auf die angeschwollene Stelle legte; schließlich nahm er das Tuch, das Holliday vorhin gegen den Staub vorm Gesicht getragen hatte und das jetzt um seinen Hals hing, knotete es auf und wickelte es als Notverband um den Kopf des Betäubten.
In diesem Moment entdeckte der Marshal, daß er einen großen Fehler gemacht hatte: In seiner Erregung hatte er bisher nicht daran gedacht, daß Shibell die Waffen Hollidays an sich genommen haben könnte. Jetzt erst sah er die beiden weißknäufigen Sixguns des Spielers im Gurt des Sheriffs stecken.
Er erhob sich, ging auf Shibell zu und nahm die Waffen weg.
»Und Sie lassen sich von mir noch einen Colt geben, Mensch!«
Verblüfft starrte der Mann auf die beiden Revolver. Er hatte sie ganz vergessen.
»Schade, was?« schoß ihm der Marshal zu. Aber er mußte sich eingestehen, daß sich Shibell, als vorhin die Roten kamen, nicht gerade feindselig verhalten, sondern ihm den Indianer aus dem Rücken gehalten hatte. Allerdings konnte das auch eine Reflexhandlung gewesen sein, dem Impuls entspringend, daß es immer noch besser war, ein Gefangener des Marshals zu sein, als von den Indianern getötet zu werden.
Weiße Feder erhob sich.
»Er ist schwer getroffen worden. Ich glaube nicht, daß er die Sonne noch einmal sehen wird.«
Wyatt schluckte. Seine Augen suchten Shibell.
Der wich vor diesem Blick zurück.
»Lassen Sie sich doch nicht von diesem Banditen hochnehmen, Wyatt. Merken Sie denn nicht, was der Strolch vorhat? Er will uns dazu bringen, daß wir uns selbst aufreiben. Alter Indianertrick!«
»Schweigen Sie!«
Shibell lehnte sich wieder gegen den Fels.
Wyatt legte die Hände um den Mund und rief mit lauter Stimme: »Luke!«
Die Antwort kam sofort.
»Ja!«
»Kommen Sie mit den beiden her und bringen Sie auch die Pferde mit!«
Verblüfft lauschten die drei Indianer in die Schlucht, hörten den Huftritt der Pferde und sahen nach einigen Minuten einen weißen Mann kommen, dem ein wahrer Goliath folgte. Dann kamen die Pferde. Den Schluß machte der Schwarze. Der Texaner wußte, daß der Neger niemals in die Dunkelheit der Schlucht fliehen würde. Außerdem war sein Gewissen offenbar nicht so schlecht, wie das des geflüchteten Sträflings.
Die Indianer hatten finstere Gesichter bekommen.
Da erklärte der Marshal: »Dieser große weiße Mann ist mein Freund Luke Short. Der andere ist ein Gefangener von mir.«
Da flog der Kopf des Häuptlings herum.
»Du bist ein Sheriff! Jetzt weiß ich, wo ich dein Gesicht gesehen habe. In der Stadt, die ihr Grabstein (Tombstone) nennt. Da ist auch dein Bruder Sheriff.«
Der Marshal schüttelte den Kopf.
»Du verwechselst mich mit meinem Bruder Morgan.«
»Morgen Earp! Ja, so ist der Name.«
»Mein Bruder Morgan ist tot. Vor zwei Jahren haben ihn die Freunde dieses Mannes hinterrücks erschossen.«
Chandler warf den Kopf hoch.
»Damals waren sie noch nicht meine Freunde!« stieß er gallig hervor.
»Aber jetzt sind sie es. Und das ist noch schlimmer!«
Der Texaner blickte mit weiten Augen auf den Georgier.
»Was ist mit dem Doc? Haben diese Ledergesichter ihn etwa verletzt?«
»Nein, aber Shibell. Er hat ihm oberhalb des Schluchteingangs aufgelauert und dann einen Stein nach ihm geschleudert, der ihn am Kopf traf.«
Der Riese schnaufte, während er Chantler zur Seite stieß und sich nach vorn schob.
Er kniete neben dem Gambler nieder.
»Das hat dieser schäbige Bruder eines Galgenmannes gewagt! Dieser armselige Bursche! Und dann steht er noch da und wagt sich mir unter die Augen! – He, Doc! Damned, machen Sie doch die Augen auf!«
Aber Holliday lag längst wieder in tiefer Ohnmacht.
Der Hüne fuhr hoch und baute sich drohend vor Shibell auf.
»Hör zu, Amigo! Wenn der Doc einen ernsthaften Schaden davonträgt, hast du ausgesorgt.«
»Marshal!« zischte der Sheriff. »Wie können Sie es zulassen, daß der Kerl mich in dieser Weise bedroht!«
Klatsch! Die Ohrfeige des Riesen ließ den Kopf des County Sheriffs regelrecht zur Seite fliegen.
»Tut mir leid, Wyatt«, entschuldigte sich der Texaner, »da ist mir wirklich die Hand ausgerutscht. Und wenn der Halunke jetzt noch ein einziges Wort sagt, stutze ich ihn so zusammen, daß er hinterher zu schwach ist, noch seinen eigenen Stern zu tragen! Sein Charakter scheint ja ohnehin zu schwach zu sein!«
Shibell zog es nach dieser bitteren Erfahrung vor, zu schweigen.
Wyatt Earps Blick ruhte auf dem vom Fackelschein beleuchteten Gesicht des Spielers.
Draußen ließ der Sturm jetzt endlich nach. Aber es dauerte noch anderthalb Stunden, ehe er völlig vorüber war.
Längst war auch die letzte Fackel der Indianer verlöscht.
Mit düsteren Gesichtern standen die roten und die weißen Männer beieinander und blickten auf die Savanne hinaus.
Die letzten Sterne waren verblichen, und das Silbergrau des neuen Tages stieg im Osten über den Horizont.
Der Häuptling blickte den Marshal an.
»Wir können jetzt weiterreiten?«
Wyatt nickte, nahm die Waffen der Mescaleros vom Boden und gab sie ihnen zurück.
Da reichte ihm Weiße Feder die Hand.
»Ich weiß jetzt deinen Namen. Du bist Wyatt Earp, nicht wahr?«
Der Marshal nickte.
In diesem Moment schlug der Georgier die Augen auf. Sein Blick verdunkelte sich, als er die abenteuerlichen Gestalten der drei Apachen sah.
Wyatt beugte sich über ihn. »Doc!«
Holliday bemühte sich, die Augen weiter zu öffnen.
»Alles in Ordnung, Doc?« fragte Wyatt.
Der Spieler nickte schwach.
»Was… ist… geschehen?« kam es kaum vernehmlich über seine Lippen.
»Sie folgten Shibell und…«
Da nickte der Georgier wieder. »Yeah…,?ich weiß. Und der… tapfere Sheriff… hat mich… von hinten… mit einem Stein…«
Da schoß Shibell vor und rief: »Was wollen Sie, Doc! Ich hatte doch keine andere Wahl…«
»Das Maul sollst du halten!« brüllte der Tex und riß Shibell rauh zurück. »Wenn du dich jetzt noch einmal von meiner Seite weggetraust, Amigo, siehst du nur noch gelbe Frösche mit Papierkragen, das verspreche ich dir!«
Der Indianerchief war neben den Marshal getreten und blickte verblüfft auf den Georgier.
»Dieser Mann muß die Natur eines Pumas haben, daß er aus dem Reich der Toten wieder aufgestiegen ist. Vor wenigen Stunden war sein Herzschlag so schwach, daß ich sicher war, der Große Geist würde ihn noch vor Aufgang der Sonne zu sich holen.«
Holliday schloß die Augen wieder.
Wyatt blickte besorgt auf ihn nieder.
Da erklärte der Häuptling: »Unser Lager befindet sich nicht sehr weit von hier. Wenn Wyatt Earp will, kann er seinen Freund dorthin bringen.«
Der Marshal schüttelte den Kopf.
»Nein, danke. Du meinst es gut. Aber wir bleiben lieber hier.«
»Wie du willst!« Der Häuptling reichte ihm die Hand, nickte dem Riesen zu und zog sich auf sein Pferd. Gefolgt von seinen Leuten, trabte er aus der Gesteinsenge in die Savanne hinaus.
Wyatt blickte ihm nach, bis er in der Ferne verschwunden war.
Curle Shibell sagte heiser, wobei er sich vorsichtshalber aus dem Bereich der Arme des Herkules begab: »Und jetzt müssen wir machen, daß wir auf dem schnellsten Weg hier wegkommen. Ich wette, daß die Bande in Kürze mit der zehnfachen Zahl von Kriegern zurückkommt.«
Niemand gab ihm eine Antwort.
Wyatt holte aus der Satteltasche des Spielers die kleine Whiskyflasche, die Holliday immer für Notfälle mit sich führte, entkorkte sie und flößte dem Freund einige Schlucke ein.
Wieder schlug er die Augen auf.
»Damned, der Stoff wird mich… eines Tages noch aus dem Sarg aufstehen… lassen.«
Wyatt atmete auf, als er diese Worte hörte. Der Gambler scherzte also schon wieder.
Holliday versuchte sogar, sich etwas aufzurichten, was ihm jedoch nicht gelang.
Wyatt eilte ihm zu Hilfe, richtete ihn auf und schob zwei Decken unter ihn und eine in seinen Rücken.
»Wie sieht’s aus?«
Holliday zog die Schultern hoch und ließ sie wieder fallen.
Wyatt nahm ihm das Zigarettenetui aus der Tasche und steckte ihm eine seiner geliebten langen russischen Zigaretten zwischen die Lippen und riß ein Zündholz an.
Aber der Spieler war einfach zu schwach, die Flamme in die Tabakfäden zu ziehen.
Wyatt wechselte einen betroffenen Blick mit dem Texaner.
Er rieb sich unbehaglich das Kinn und drohte Shibell mit der Faust.
»Bete!« stieß er flüsternd hervor. »Bete, Curle, daß er nicht in die Wolken reitet!«
Dicke Schweißperlen standen auf der Stirn des Sheriffs. Er stand jetzt neben dem Marshal und lispelte: »Ich habe es nicht gewollt! Das schwöre ich Ihnen! Ich war so fertig, so… mit den Nerven am Ende… Glauben Sie mir, Wyatt, ich habe das nicht gewollt!«
Der Marshal schwieg.
Luke Short postierte sich am Eingang. Chandler hatte er vor sich auf einen Stein bugsiert, wo er ihn im Auge hatte.
»Da bleibst du sitzen, Kurzer. Und wenn du Wau machst, machst du gleich hinterher Au! Kapiert?«
Die Hände des Schießers waren immer noch gefesselt. Er starrte brütend vor sich hin. Da war er nun mehr als siebenhundert Meilen durch den Westen geflüchtet – und rannte ausgerechnet dem schärfsten und gefürchtetsten Banditenjäger des Westens, dem Marshal Earp, in die Hände!
Wyatt hatte seinen Sattel abgenommen und blickte mit müden Augen vor sich hin.
Shibell allein stand an der Wand und vermochte den Blick nicht von Hollidays Gesicht zu wenden.
So vergingen zwei Stunden.
Plötzlich stieß sich Shibell von der Wand ab und kniete vor Holliday nieder.
»Wyatt! Da, er hat die Augen offen! Doc! Doc! Damned, sagen Sie doch was! Die halten mich hier schon für Ihren Mörder…«
Ein unsäglich verächtliches Lächeln flog um die Lippen des Spielers.
»Nehmen Sie sich nicht zuviel Ehre heraus, Shibell!« Seine Stimme hatte jetzt schon einen bedeutend festeren Klang.
Und zur grenzenlosen Verblüffung der anderen setzte er sich aufrecht hin, tastete über seinen Schädel, nahm den Verband ab, roch an den Blättern und nickte.
»Seravelo.«
»Was ist das?« kam es heiser über die spröden Lippen des Marshals.
»Ein wahres Zauberkraut. Selten wie Schnee in diesem Land und ein Heilmittel ohnegleichen.«
»Geht’s Ihnen wirklich schon besser?«
Der Gambler nickte und tastete wieder über die verletzte Stelle. Dann griff er nach seinem Hut, der neben ihm lag.
»Ein Glück, daß ich den harten Deckel aufhatte, der hat das Schlimmste abgehalten.«
Dann sah er die angesengte Zigarette neben sich auf seiner Instrumententasche liegen, die Wyatt verzweifelt nach einer Arznei durchsucht hatte.
»He, hab’ ich das gute Kraut etwa verschmäht?«
Wyatt lachte, als er sah, daß der Spieler sich das Mundstück zwischen die weißen Zähne schob, mit der Linken ein Zündholz aus der Westentasche nahm und es in unnachahmlicher Manier am Daumennagel der selben Hand anriß.
Er rauchte ein paar Züge und richtete sich dann auf. Aber er stand noch nicht sicher auf den Beinen und lachte leise in sich hinein.
»Wacklig – wie diese ganze verdammte Welt! He, Shibell, was ist mit Ihnen? Haben Sie Zahnschmerzen?«
»Sieht schon mehr nach Darmverschlingung aus!«, meinte der Texaner, während er auf den Spieler zukam, und ihm die Hand reichte. »Damned, Doc, ich hätte Steaks aus diesem Hammel gemacht, und er wußte es. Daher ist er noch etwas grün um die Nase.«
Holliday streichelte den Kopf seines Rappenhengstes. »Na, du, wann wollen wir denn in Nogales sein?«
Wyatt hatte sich erhoben und schüttelte den Kopf. »Das wird nichts mehr.«
Holliday wandte sich um. »Wollen Sie hier siedeln?«
»Das nicht, aber ich bleibe genauso lange hier, bis ich weiß, daß Sie wieder auf dem Damm sind.«
»Das werden Sie sofort erfahren.«
Der Georgier nahm einen der beiden Colts aus dem Halfter, die ihm Wyatt in die Lederschuhe gesteckt hatte, packte den Schießer am Arm und sagte rauh: »Haben Sie etwas dagegen, daß Sie jetzt sterben werden, Nash?«
Das grelle Licht der Morgensonne blendete den Schießer, dennoch war deutlich zu sehen, daß er ob dieser seltsamen Frage jäh erbleichte.
»Ich verstehe Sie nicht, Doc«, stieß der mit rostiger Stimme hervor.
»Sie verstehen mich sehr gut. Also?«
»Ich… hatte noch nicht die Absicht, zu sterben, wenn Sie das meinen.«
In Hollidays Gesicht regte sich kein Muskel.
»Schade, daß ich Sie enttäuschen muß.«
Er trat einen Schritt zurück und spannte den Hahn.
Das harte metallische Geräusch drang dem Banditen bis ins Mark.
»Doc!« schrie er mit sich überschlagender Stimme.
»Ja?« kam es sehr leise von den Lippen des Gamblers.
»Nicht…, ich…, was wollen Sie von mir?«
»Nur einen Namen!«
»Wessen Namen?«
»Den Namen des Mannes, der Sie zu Shibell schickte.«
Da sank der Kopf des Chandlers auf die Brust herunter.
»Sehen Sie«, drang die klirrende Stimme des Spielers an sein Ohr. »Sie haben also nichts dagegen. Fare well, Nash!«
»Halt!« schrie der Coltman, »ich werde Ihnen den Namen nennen.«
»Rasch, Chandler. Von ihm hängt es nämlich ab, wie wichtig unser Ritt nach Nogales ist.«
Der Verbrecher schluckte und suchte verzweifelt nach einem Ausweg. Sollte er einen falschen Namen nennen? Welchen? Es fiel ihm keiner ein.
»Die Zeit ist um«, mahnte ihn der Georgier, der gar nicht die Absicht hatte, ihn etwa wirklich niederzuschießen.
»Phin…«, kam es da zur Verblüffung aller aus der Kehle des Revolvermannes.
Der Georgier entspannte seinen Colt und ließ ihn mit einem brillanten Handsalto ins Halfter zurückfliegen. Während er sich nach dem Missourier umdrehte, fragte er, als handelte es sich um die gleichgültigste Sache der Welt: »Haben Sie noch irgendwelche Einwände gegen den Weiterritt, Mister Earp?«
Wyatt preßte die Lippen aufeinander, nahm dann seinen Sattel auf und legte ihn auf den Rücken des Falbenhengstes.
»All right«, sagte er nur.
Wenige Minuten später verließen sie das unbequeme Nachtquartier und trabten durch das Geröll auf die schmale Straße nach Südwesten zu.
*
Ganz Nogales bebte vor Angst.
Angst vor Phin. Vor dem Bruder des gefürchteten Bandenführers, von dem die Menschen in diesem Land je gehört hatten.
Es gab niemanden mehr in der Grenzstadt, der nichts von dieser Angst gewußt hätte.
Nur einer wußte nicht, was die Leute in bleiernen Schrecken gebannt hielt.
Phin selbst.
Er saß im Frontier Saloon und pokerte mit dem Richter.
Croydon trank und trank. Er hatte ja einen gönnerhaften Freund gefunden, der zahlte.
Phins Gesicht war verschlossen. Er redete kaum.
Am späten Nachmittag nahm er plötzlich seinen Gewinn, stopfte ihn in die Taschen und schnarrte: »Ich habe für siebzehn Dollar Drinks ausgegeben, vierzig Dollar haben Sie an mich verloren. Die Rechnung ist also glatt.«
Croydon prallte gegen die Stuhllehne zurück.
Er war mit einem Schlag nüchtern.
So hatte er nicht gerechnet. Er sah nur immer, wie Phin zahlte. Daß er indessen eine ganze Reihe Dollars an den Tombstoner verloren hatte, war ihm dabei gar nicht recht zum Bewußtsein gekommen.«
»Sie… verdammter Betr…!«
»Vorsicht!« mahnte ihn der Cowboy. »Keine Beleidigung, Richter. Ich mache ganz kurzen Prozeß. Noch kürzer als Sie.«
Croydon sprang auf. In einer Spielpause hatte er draußen auf dem Hof vom Wirt erfahren, was sich in den letzten vierundzwanzig Stunden in der Stadt ereignet hatte. Er wußte auch, wem die Stadt die Schuld an den Geschehnissen gab und vor wem sie gleichzeitig zitterte.
Croydon war zwar jetzt ernüchtert, aber dennoch entfuhr es ihm: »Ihnen wird das Handwerk noch gelegt werden!«
Phin trat nahe an ihn heran. In seinen Augen glimmte ein gefährliches Licht.
»Ich habe Sie gewarnt, Richter!«
»Well. Sie können mich niederknallen. Es würde niemanden in der Stadt wundern.«
Da packte ihn Phin und schleuderte ihn mit einem derben Stoß krachend gegen die Theke.
»Was faseln Sie da, Mensch? Sie, der Sie mir gesagt haben, daß Sie hergekommen sind, um diese Stadt auf den Kopf zu stellen!«
Der Richter stierte den Banditen aus weit aufgerissenen Augen an.
Was war das?
Dieser Gangster versuchte, den Spieß umzudrehen! Ihm alles in die Schuhe zu schieben.
»Das Kind… Phin! Wo ist das Kind?« keuchte er.
»Ich weiß nicht, was du da jaulst, Gesetzesverdreher! Aber ich gebe dir einen guten Rat: Sieh zu, daß du auf dem schnellsten Weg verschwindest. Ich werde nämlich dem Sheriff jetzt die Augen über dich öffnen!«
Croydon zerrte sich an der Wand der Theke hoch, torkelte zum Tisch, stützte sich mit beiden Händen auf die grüngestrichene Platte und vermochte den stieren Blick nicht von dem pockennarbigen Gesicht des Banditen zu reißen.
Plötzlich aber bückte er sich, nahm seinen Hut und rannte wie vom Teufel gejagt davon.
Phin stand in der Hoftür, blickte ihm nach, wie er aufs Pferd stieg, und lachte blechern hinter ihm her.
Es drang den Menschen hinter den Gardinen bis ins Mark.
Was wollte er hier in Nogales, dieser Phineas Clanton?
Weshalb versetzte er eine ganze Stadt in Angst?
Als er jetzt aus der Schenke trat und an der Vorbaukante stehen blieb, auf den Zehenspitzen wippend, die Hände tief in die Taschen geschoben, lief den Menschen, die ihn so stehen sahen, ein eisiger Schauer über den Rücken.
Phin stieg langsam vom Vorbau und schlenderte die Straße hinunter. Ständig bewegte sich sein überstark entwickeltes Kinn auf und ab; er kaute wie gewöhnlich auf einem Zündholz herum. Herausfordernd langsam ging er genau über die Mitte der Mainstreet, kam am Seiteneingang des Anwesens des Viehhändlers Cox vorbei und auch an der Front des schmalbrüstigen Häuschens, in dem die Wäscherin Morrison wohnte.
Phin ging vorüber, ohne auch nur einen einzigen Blick seitwärts zu schicken.
Es gab Hunderte geballter Fäuste und zahlreiche Hände, die sich um Waffenknäufe krampften.
Und dennoch ging keiner auf die Straße, um diesen Mann, der doch ganz allein war, anzugreifen.
Er hatte einen Partner, der stärker war als alles andere: die Angst!
*
Weiße Feder hatte recht gehabt: der Mann aus Georgien verfügte tatsächlich über eine eisenharte Natur. Er saß bereits wieder im Sattel wie eh und je.
Die Gefährten warfen hin und wieder einen verstohlenen Blick auf ihn. Aber dem Spieler war nichts mehr von dem anzumerken, was er durchgestanden hatte.
Wyatt sorgte indessen dafür, daß nicht zu schnell geritten wurde.
Da sie erst am Vormittag aufgebrochen waren, senkte sich jetzt, als sie in das Gebiet von Nogales kamen, die Sonne schon im Westen dem Horizont entgegen.
Trotz des späten Oktobertages herrschte noch große Hitze, die auch zu dieser Abendstunde noch flimmernd über dem gelbbraunen Sand der Savanne lag.
Hin und wieder wurde die Eintönigkeit der Landschaft durch hohe Turmkakteen unterbrochen, die zwei- oder höchstens dreiarmig im Gelände standen, zuweilen überschattet von den riesigen roten Sandsteinpyramiden, die vom Schmirgelsand der Jahrtausende zu skurrillen Figuren verschliffen, typisch für das Landschaftsbild des südlichen Arizonas waren.
Der wolkenlose Himmel färbte sich blauviolett und leuchtete am Horizont, dort, wo die Sonne jetzt hinter den Bergen untergegangen war, in strahlendem Purpur.
Da gewahrte das scharfe Auge des Missouriers in der Ferne einen auf und nieder tanzenden Punkt.
Er nahm sein Nelsonglas aus der Satteltasche, zog es auseinander und richtete es nach Südwesten.
Im Fernrohr tauchte das Bild eines näherkommenden Reiters auf.
Jetzt hatte auch der Spieler den Punkt entdeckt. Er beschattete die Augen mit der Hand und musterte den Punkt.
»Ein Bekannter?« fragte er den Marshal.
Wyatt zuckte mit den Schultern. »Das kann ich noch nicht erkennen.«
Sie ritten langsam weiter.
Nach einer Weile nahm der Marshal das Glas wieder auf, setzte es ans Auge und berichtete: »Es ist ein älterer Mann. Ich kann sein Gesicht immer noch nicht genau erkennen.«
Als der Mann so nahe herangekommen war, daß man sein Gesicht auch schon mit bloßem Auge erkennen konnte, pfiff der Georgier verblüfft durch die Zähne: »Den Burschen kenne ich.«
»Natürlich«, meldete sich jetzt auch Shibell, der sichtlich aufgelebt war, seitdem er wußte, daß Doc Holliday sich wieder erholt hatte. »Das ist Richter Croydon!«
»Croydon!« Wyatt überlegte. »Den Namen habe ich schon gehört. Ist das nicht der Oberrichter aus Flagstaff?«
»Das war er«, erklärte Holliday. »Sie haben ihn an die Luft gesetzt. Er ist der fürchterlichste Säufer, der mir je über den Weg gelaufen ist. Ich habe in Phoenix einmal mit ihm gepokert. Ich glaube, er arbeitet nur noch auf Bestellung.«
»Also eine Art Reiserichter«, meinte der Texaner.
Jonathan Croydon hatte den Trupp mit bangem Argwohn entgegengesehen. Aber aus Erfahrung wußte er, daß es falsch wäre, jetzt die Richtung zu ändern; deshalb hielt er an und wartete, bis die Reiter ihn erreicht hatten. Wie groß aber wurden seine Augen, als er Curle Shibell erkannte und neben ihm Doc Holliday.
»He!« rief er rasch näherkommend und vor den Reitern sein Pferd parierend. »Wen sehe ich denn da? Doc Holliday? Und Sheriff Shibell! Welch eine Überraschung.« Aber es war keine echte Freude, die aus seinen Worten klang.
Holliday stützte sich mit beiden Händen auf den Sattelknauf, kniff das linke Auge ein und meinte: »Gibt’s in Nogales keinen Whisky mehr?« Der Spott war unüberhörbar.
Croydon lächelte gekünstelt. »Doch, schon, Doc, nur – man kann ja nicht ewig auf einem Fleck bleiben!«
»Da stimme ich Ihnen zu.«
Verwundert blickte der Richter auf den Sheriff, der unbeteiligt geradeaus blickte. Er glaubte, ein Wort an ihn richten zu müssen, und fragte deshalb: »Mister Shibell, Sie reiten auch nach Nogales?«
Der Sheriff versetzte finster: »Wie Sie sehen, Croydon.«
Der Richter hatte indessen den Blick über die anderen Gesichter schweifen lassen. Plötzlich entdeckte er die gefesselten Hände Chandlers. »He, wen schleppt ihr denn da in der Gegend herum?«
Und jetzt blieb sein Auge auf der Gestalt des Missouriers haften. Wer war dieser Mann? überlegte er. Ich habe ihn doch schon irgendwo gesehen? Aber wo? Der Gedanke bereitete ihm sichtlich Unbehagen.
Da öffnete Wyatt die Lippen und fragte halblaut: »Sie hatten in Nogales zu tun, Mister Croydon?«
Der Richter nickte. »Ja, eine Verhandlung.«
»Darf man erfahren, gegen wen?«
Der Richter antwortete sofort mit einer Gegenfrage: »Darf man erfahren, mit wem man spricht?«
Es war Curle Shibell, der zur Verblüffung der anderen die Antwort gab: »Ja, Croydon, das müssen Sie auf jeden Fall erfahren. Dieser Mann da ist Wyatt Earp! Ich hoffe, Sie freuen sich über diese Begegnung.«
Shibell lehnte sich auf den Sattelknauf und beobachtete den Schrecken, der plötzlich in den Augen des Wanderrichters stand.
»Wyatt Earp? Marshal Earp?« Er klatschte sich mit der flachen Hand gegen die Stirn. »Natürlich, wo Doc Holliday ist, muß auch Wyatt Earp sein!« Und dann schlug er ein Lachen an, das aus einem Grabgewölbe zu kommen schien. »Auf diesen Sch…« Er wollte Schreck sagen, verbesserte sich aber rasch: »Auf diese Freude hin, muß ich sofort einen Schluck aus meiner Flasche nehmen, Gents!«
Wyatt trieb seinen Falben näher an ihn heran.
»Sie haben meine Farge noch nicht beantwortet, Mister Croydon.«
Der Richter nahm einen tiefen Schluck, während er fieberhaft überlegte. Und als er jetzt den Kopf wandte und sprach, schlug dem Marshal der Whiskydunst wie eine Flamme entgegen.
»Ja«, erklärte er abgehackt, »ich hatte eine Verhandlung gegen den Mayor von Nogales.«
»Gegen den Mayor?«
»Ja, er gehört zu den Galgenmännern!«
Das Erstaunen, das sich jetzt auf den Gesichtern der Reiter malte, hätte kaum größer sein können.
»Zu den Galgenmännern?« fragte Wyatt. »Können Sie uns das nicht etwas genauer erklären?«
»Was gibt’s da zu erklären? Er ist überführt worden, daß er zu den Galgenmännern gehört. Einmal hat er ein Pferd gestohlen, das man in seinem Stall fand; und dann wurden in seinem Haus in einem Kleiderschrank mehrere graue Gesichtstücher entdeckt, wie die Galgenmänner sie verwenden.«
»Ach, und wer hat ihn angezeigt?«
»Angezeigt? Niemand. Er selbst hat einen Burschen namens Jimmy King wegen Pfedediebstahl verklagt. Gegen diesen ging eigentlich die Verhandlung. Und während dieser Verhandlung stellte sich dann die Schuld des Mayors heraus.«
»So ganz zufällig?« forschte der Marshal argwöhnisch.
Der Richter schoß ihm einen lauernden Blick zu.
»Wie meinen Sie das, Marshal?«
»Nun, immerhin ist es doch recht ungewöhnlich, wenn ein Mayor als Mitglied der Galgenmänner-Bande erkannt wird!«
»Natürlich! Die Strafe fiel auch entsprechend aus.«
»Sie haben den Mann doch nicht etwa an den Galgen gebracht?«
Zwischen den Brauen des Missouriers stand plötzlich eine steile Falte.
Croydon schüttelte den Kopf, setzte dann die Flasche wieder an, nahm noch einen kräftigen Schluck – und als er sie absetzte, war sie zu einem Drittel geleert.
»Nein«, meinte er, während er sich mit dem Handrücken den Mund abwischte und ein joviales Lächeln auf sein Gesicht zwang, »er wird lebenslänglich ins Zwangsarbeitslager geschickt. Da gehört er auch hin.«
Es war eine volle Minute still.
Dann drängte Sheriff Shibell sein Pferd an die andere Seite des Richters.
»Hören Sie, Croydon. Sie haben doch nicht allen Ernstes Angerer ins Straflager geschickt?«
»Wie reden Sie mit mir, Shibell? Was geht Sie Angerer an? Ich will doch nicht annehmen, daß Sie einen Galgenmann in Schutz nehmen wollen?«
»Nein, ganz und gar nicht«, entgegnete der Sheriff schroff, »aber ich kenne Angerer zufällig. Er ist ein aufrechter Mann, der sich niemals mit einer Verbrecherbande zusammentun würde. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer!«
»Aber ich bitte Sie, Sheriff. Bei der Verhandlung hatte sich die Schuld des Mayors ganz klar herausgestellt. Sie werden doch meinen Schuldspruch nicht anzweifeln?«
»Haben Sie Phin Clanton in der Stadt gesehen?« erkundigte sich Wyatt rasch.
Der Schreck in den Augen des Richters war nicht zu übersehen.
»Phin… Clanton…? Nein. Warten Sie, das heißt, ich habe ihn gesehen. Er war in einem der Saloons. Ach, richtig, wir machten sogar ein Spielchen miteinander. Hahahaha. Ich verlor natürlich. Aber dafür hat er die Drinks bezahlt.«
Die Freunde wechselten einen raschen Blick miteinander. Dann sagte der Marshal schroff: »Ich muß Sie bitten, mit mir nach Nogales zurückzureiten.«
In den Augen des Trinkers stand die Angst.
»Aber warum? Ich habe keinen Grund, dorthin zurückzukehren.«
»Den Grund werden Sie bald erfahren. Vorwärts!« Der Ton, in dem diese Worte gesprochen worden waren, ließ nichts an eindeutiger Schärfe zu wünschen übrig.
Jonathan Croydon wandte sein Pferd und trottete neben Luke Short hinter dem Trupp her.
Als sie etwa eine Meile zurückgelegt hatten, wandte er sich an den Texaner: »Sagen Sie, Mister, was hat der Marshal vor?«
Ohne ihn eines Blickes zu würdigen, entgegnete der Tex: »Am besten fragen Sie ihn selbst, Mister.«
»Sie scheinen reichlich kurz angebunden zu sein?«
»Ja, und wenn Sie mir einen Gefallen tun wollen, dann reiten Sie ein Stück vor mir her. Wenn ich in eine Kneipe gehe, nehme ich den Gestank in Kauf. Aber nicht hier in der freien Natur!« Das war deutlich.
Croydon entfernte sich und gesellte sich zu dem Neger, der sich aber ebenfalls nicht in ein Gespräch verwickeln ließ.
Es war dunkel, als sie die Stadt vor sich auftauchen sahen. Nogales lag in einer Bodensenke. Jetzt in der Nacht wirkte es mit seinen Lichtern fast friedlich.
Wyatt, der die Stadt von früheren Ritten her flüchtig kannte, hielt sofort auf das Sheriffs Office zu, öffnete das Hoftor, führte die Männer in den Hof und ließ sie dort halten.
Die Männer stiegen aus den Sätteln.
Sheriff Cornelly war durch das Geräusch der quietschenden Türangeln an die Hoftür gelockt worden. Verblüfft blickte er auf die Reiter.
Der Marshal trat auf ihn zu.
»Sie sind Sheriff Cornelly?«
»Ja, und wer sind Sie? Und was sind das für Leute? Was wollt ihr hier?« fauchte der kleine Sheriff mißtrauisch.
Wyatt nahm ihn am Arm und zog ihn mit sich ins Büro.
»Mein Name ist Earp, Mister Cornelly…«
Wie von einem Faustschlag getroffen, zuckte der Sheriff zurück und klammerte sich mit beiden Händen an den Gewehrständer.
Er war das personifizierte schlechte Gewissen.
Wyatt blickte ihn verblüfft an.
»Was ist denn mit Ihnen los?«
»Earp? Wyatt Earp?«
»Ja, was gefällt Ihnen nicht an meinem Namen?«
»Oh, oh, nichts«, stotterte der Sheriff, aber es war zu spät, den Fehler wiedergutzumachen, deshalb schlug er sofort einen schärferen Ton an: »So, Sie sind also Wyatt Earp? Was wollen Sie hier?«
»Das werden Sie schon noch erfahren. Vorerst habe ich die Männer in den Hof kommen lassen – es sind Gefangene dabei.«
»Gefangene? Wer?«
»Ein Sträfling, ein berüchtigter Schießer, der oben in Rapid City ausgebrochen ist und wegen Totschlags verurteilt wurde. Sein Name ist Nash Chandler.«
»Chandler? Nie gehört.«
»Sperren Sie den Mann ein. Und dann ist da noch ein Neger von der Shibell Ranch, dessen Boß höchstwahrscheinlich zu den Galgenmännern gehört.«
Als Wyatt das Wort Galgenmänner aussprach, beobachtete er das Gesicht des Sheriffs unauffällig aber scharf.
Wie ein Schatten huschte es über das faltige Gesicht des Gesetzeshüters von Nogales.
»Die Galgenmänner? Was habe ich damit zu tun?«
»Ich hoffe nichts«, gab Wyatt rasch zurück. »Aber der Neger scheint etwas damit zu tun zu haben, und deshalb wird er eingesperrt. Übrigens habe ich auch einen Richter mitgebracht, der mir unterwegs in die Finger lief.«
»Einen Richter?« Der Sheriff nahm den Hut vom Kopf und drehte ihn zwischen den Händen. »Welchen Richter?« stieß er heiser durch die Kehle.
»Richter Croydon.«
»Croydon? Ja«, tat Cornelly jetzt, als erinnere er sich nur flüchtig daran. »Sicher, er hat den Mayor verurteilt. Der Mayor gehört zu den Galgenmännern!«
»Also gibt’s doch Galgenmänner in der Stadt?«
»Nein, keine! Ja – jedenfalls gehörte der Mayor dazu, und deswegen ist er verurteilt worden. Ein wahres Glück für die Stadt! Ich hatte ihn immer für einen anständigen, ehrbaren Bürger gehalten. Glücklicherweise ist er der einzige Schurke in unserer Stadt.«
Der Missourier blickte dem Sheriff fest in die Augen.
»Der einzige Schurke? Das glaube ich nicht, Cornelly.«
»Was soll das heißen?« fragte der Sheriff mit bebender Stimme.
»Phin Clanton ist in der Stadt.«
»Phin…?Clanton?«
»Haben Sie das etwa nicht gewußt?«
Der Sheriff schüttelte den Kopf. »Nein«, tat er verblüfft.
»So etwas sollten Sie aber wissen, Mister Cornelly.«
In diesem Augenblick betrat der Deputy Lippit das Office, der das Verschwinden Judy Morrisons zu Protokoll genommen hatte. Er blickte auf den Fremden und sah zu seiner Verwunderung die Angst in den Augen des Sheriffs.
»Was gibt es, Boß?« fragte er.
Der Sheriff deutete mit dem Daumen auf den Missourier.
»Weißt du, wer das ist? Das wirst du nicht erraten. Ich wäre auch nicht darauf gekommen. Es ist Wyatt Earp.«
Der Deputy war ein Bild vollkommener Verblüffung.
»Wyatt Earp?« fragte er, und dann rief er sofort: »Marshal, Sie sind im richtigen Moment gekommen!«
»Was gibt’s denn?«
»Gestern nacht ist hier ein Kind entführt worden. Und gestern mittag, am hellichten Tage, wurde ein Mann erschossen, der Viehhändler Cox. Kurz darauf verschwand ein sechzehnjähriges Mädchen, die Tochter einer Wäscherin, Judy Morrison…«
»Ach, halt doch den Mund«, versuchte ihn der Sheriff zu unterbrechen. »Fasele dem Marshal doch keinen Unsinn vor. Das ist doch alles noch nicht erwiesen. Das Kind…, das kann bei Verwandten sein. Und der Viehagent hatte Streit mit vielen Leuten. Es ist durchaus möglich, daß er sich mit irgend jemandem duelliert hat. Außerdem gab es sicher viele Menschen, die Geld von ihm zu bekommen hatten; irgendeinem wird vielleicht der Kragen geplatzt sein. Und Judy Morrison? Gott, wer will schon für so ein halbwüchsiges Girl die Hand ins Feuer legen? Ganz sicher hatte sie mehrere Liebhaber, und einer davon wird sich mit ihr davongemacht haben. Versteht man ja…, die Jugend…«
»Seien Sie endlich still«, unterbrach ihn der Marshal mit schneidender Schärfe.
Da zog der Deputy einen Zettel aus der Tasche und reichte ihm dem Missourier hin.
»Hier, dieses Papier war um einen Stein gewickelt, der bei den Morrisons ins Fenster geschleudert wurde.«
Ehe der Marshal den Text las, entdeckte er das kleine Dreieck unten in der Ecke des Zettels.
Das Zeichen der Galgenmänner!
»Wer ist dieser Gilbert Morrison?« erkundigte er sich.
»Ach, ein zwielichtiger Bursche«, meinte der Sheriff erklären zu müssen. »Ein Bandit, könnte man sagen. Eine Zeitlang hatte er sich oben in Tombstone herumgetrieben; dann war er hier, und nun ist er wieder verschwunden. Weiß der Teufel, mit wem sich dieser Bursche herumtreibt!«
Da erklärte der Deputy: »Mister Earp, Phin Clanton ist in der Stadt! Ganz Nogales lebt in Furcht vor diesem Mann. Die Leute sagen, daß er mit der Entführung der kleinen Joan Benson zu tun hat und daß er auch am Tod des Viehagenten die Schuld trägt. Auch Judy Morrisons Verschwinden soll mit ihm zusammenhängen.«
»Aber, was faselst du denn da«, mischte sich der Sheriff gallig ein. »Das ist doch alles nicht bewiesen. Die Leute in der Stadt sind verrückt. Eine typische Panik ist das, nichts weiter.«
»Wo wohnt dieser Benson?« erkundigte sich der Marshal.
»Nicht weit von hier, Mister Earp. Ich werde es Ihnen sofort zeigen.«
»In Ordnung.«
Der Marshal verließ das Office, ohne den Sheriff noch eines Wortes zu würdigen, trat in den Hof, besprach sich kurz mit Holliday und ging dann mit dem Hilfssheriff hinaus und ließ sich das Haus des Pferdehändlers zeigen.
Harry Benson stand in seinem Wohnzimmer am Fenster und beobachtete die Straße. Er sah die beiden Männer kommen.
Der Deputy ging wieder zurück, und der Marshal betrat den Vorbau.
Da öffnete sich die Tür, und der Pferdehändler musterte den Fremden argwöhnisch.
»Wer sind Sie?« stieß er hervor.
»Mein Name ist Earp, Wyatt Earp. Ich hörte im Sheriffs Office, was geschehen ist.«
Da stürzte der Pferdehändler auf den Marshal zu und umspannte mit beiden Händen seine Rechte.
»Wyatt Earp? Großer Gott, Sie kommen im richtigen Augenblick in die Stadt, Marshal! Meine Tochter ist entführt worden, ein kleines Mädchen von sechs Jahren. Ich bitte Sie, ein kleines, hilfloses Ding! Nachts haben sie Joan hier aus dem Haus geholt. Meine Frau hat einen Nervenzusammenbruch erlitten…«
»Beruhigen Sie sich, Mister Benson«, unterbrach der Marshal den Redefluß des verängstigten Vaters. »Kann ich einen Augenblick drinnen mit Ihnen sprechen?«
»Ja, natürlich, bitte, kommen Sie doch herein.«
Als der Missourier das Haus nach einer Viertelstunde verließ, stand schräg gegenüber auf dem Vorbau der Monitor Bar ein Mann, der ihn offensichtlich beobachtete.
Wyatt ging an ihm vorbei, blieb plötzlich stehen, drehte sich um und trat auf ihn zu.
»Sie haben auf mich gewartet, Mister?«
Der Mann hatte ein schmales Mexikanergesicht und einen dünnen, ausrasierten Schnurrbart. Er wich zwei Schritte zurück und schnarrte in gebrochenem Englisch, wie es die Mexikaner sprechen: »Ich? Auf Sie? Nein, Mister Earp, ich kenne Sie doch gar nicht. Warum sollte ich hier auf Sie gewartet haben?«
»Sie kennen mich nicht und wissen doch meinen Namen?«
»Nein, ich hörte – ich vermutete – ich – ich…«
»Kommen Sie mit!« Wyatt ergriff ihn am Arm und führte ihn ins Sheriffs Office.
Er war nicht verwundert, den kleinen Cornelly hier nicht mehr vorzufinden.
»Seit wann ist er weg?« fragte er Lippit, der den Mexikaner sofort in Empfang nahm.
»Als ich zurückkam, war er schon nicht mehr hier.«
»Wo kann er hingegangen sein?«
»Möglicherweise in den Frontier Saloon, oder…«
»Wissen Sie, wo sich Phin Clanton aufhält?«
»Nein. Gestern soll er im ›Gold-Dollar‹ gewesen sein.«
»Wo ist die Schenke?«
»Wenn Sie hier die Straße ein Stück hinuntergehen, auf der linken Seite. Ein ziemlich neues, großes Haus.«
»All right, bringen Sie den Mex ins Jail. Er gehört zu der Bande. Ein Spitzel wahrscheinlich!«
Eine Viertelstunde später betrat der Missourier den Gold-Dollar Saloon.
Der Schankraum war vollkommen leer. Trotz der Abendstunde. Über der Theke brannte eine einzige schwache Kerosinlampe, in deren Schein eine schwarzhaarige junge Frau eine Gazette studierte.
Der Marshal trat an die Theke.
Da blickte die Frau auf. »Sie wünschen?«
»Ich suche Phin Clanton.«
Die Frau richtete sich mit einem Ruck auf und wurde blaß unter der dunklen Haut.
»Phin?«
»Ja.«
»Wer sind Sie?«
»Mein Name ist Earp.«
»Wyatt Earp?« stieß sie tonlos hervor.
»Ja. Wo finde ich Phin?«
»Ich weiß es nicht. Er war heute noch nicht hier.«
»Wissen Sie nicht, wo er wohnt?«
»Nein, das weiß ich nicht. Vielleicht bei Saunders.«
»Wer ist das?«
»Der Sattler, er wohnt hier nebenan in der Gasse. Es ist das dritte Haus auf der rechten Seite.«
Wyatt bedankte sich und ging hinaus.
Kaum hatte er die Ecke der Gassenmündung erreicht, als er – trotz der Dunkelheit – sah, wie die Frau aus dem Hoftor trat.
»Hallo, Madam!«
Verblüfft blickte sie sich um.
Da rief ihr der Missourier zu: »Geben Sie sich keine Mühe, mich in der Gegend herumzuschicken, damit Ihr Freund Phin einen besseren Vorsprung bekommt. Ich hole ihn ein, verlassen Sie sich darauf!«
Wyatt ging zurück. Er war davon überzeugt, daß Phin längst die Stadt verlassen hatte.
Auf einem Vorbau saß ein älterer Mann in einem Schaukelstuhl, stieß sich immer wieder mit einem Fuß von einem Vorbaubalken ab und hielt sich dadurch in ständiger Bewegung.
Wyatt erkundigte sich bei ihm nach dem Haus der Morrisons.
Der Mann federte sofort hoch, bewies dadurch bedeutend mehr Jugendlichkeit, als man ihm zugetraut hätte, und hielt beide Hände über den Revolverknäufen.
»Na, na«, meinte der Marshal. »Was ist denn hier los?«
»Wer sind Sie?« fragte der Mann.
»Mein Name ist Earp.«
»Earp?«
»Und wer sind Sie?«
»Mein Name ist… Ich heiße Miller.«
»Well, Mister Miller, dann zeigen Sie mir doch bitte das Haus der Familie Morrison.«
Der sonderbare Mister Miller erklärte ihm den Weg zur Wäscherei.
Wyatt blieb jedoch noch stehen. »Mister Miller, ich hätte noch eine Frage. Können Sie mir vielleicht auch sagen, wo ich Oswald Shibell finde?«
Es war nur eine Eingebung gewesen, aber sie hatte die Wirkung eines Granateneinschlags.
»Mister« Miller, griff zum Revolver.
Doch der Mann aus Missouri war schneller. Er stieß ihm den Lauf seines Buntline Specials vor die Brust, zog ihm beide Waffen aus dem Halfter und schleuderte sie auf die Straße.
»Kommen Sie, Miller, wir unterhalten uns im Sheriffs Office weiter.«
Doc Holliday lehnte im Office zwischen Tür und Fenster, wie er es immer gern tat, Luke Short stützte sich oben auf dem Gewehrständer auf, und Sheriff Shibell stand neben dem Schreibtisch.
Auch der Deputy war da. Nur Sheriff Cornelly nicht. Wyatt wußte jetzt, daß er mit Phin die Stadt verlassen hatte.
Mister Miller sah sich nach allen Seiten um und hob dann langsam die Hände.
»Ich gebe es auf«, stotterte er. »Ich will nicht mehr. Ich hatte ohnehin keine Lust.«
»Wovon sprechen Sie, Mister Miller? Wir verstehen Sie nicht.«
Miller ließ die Hände sinken.
»Verdammt. Sie verstehen mich genau, Mister Earp. Sie wissen, was hier los ist.«
»Ich will es von Ihnen noch einmal hören.«
»Nun, wir sind hierhergekommen, weil Phin es wünschte. Er hatte eine Sache mit dem Mayor, liegt schon eine Weile zurück. Jetzt wollte er sich an ihm rächen, deshalb hat er den Richter herbestellt und vorher die Sache mit Jimmy drehen lassen. Jimmy gehört auch zu Phins Freunden. Er hat das Pferd absichtlich in dem Augenblick gestohlen, in dem der Mayor vorüberkam und ihn erkennen konnte. Er hat es sogar zugelassen, daß er vom Mayor gestellt und ins Office geschleppt wurde. Und Croydon, diese Saufnase, hat den Mayor tatsächlich verurteilt. Das war es, nichts weiter. Deshalb mußten wir alle hierherkommen.«
»Was heißt, wir alle?«
»Nun, wir, die Freunde Phins.«
»Bei dem Mayor sind graue Tücher eingeschmuggelt worden, Gesichtstücher von den Galgenmännern. Die Leute, die die Tücher hingebracht haben, müssen also Galgenmänner sein.«
»Nichts da«, lachte Miller. »Sie irren sich, ich habe mit den Galgenmännern nichts zu tun. Und doch habe ich die Tücher selbst da hingebracht, weil Phin es so wollte. Das Ganze ist im Grunde eine völlige Idiotie.«
»Und was ist mit dem Kind von Benson?«
»Keine Ahnung.«
»Und wer hat Cox erschossen?«
»Das weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, daß wir nichts damit zu tun haben.«
»Phin auch nicht?«
»Ganz sicher nicht. Den trieb nur der Haß auf den Mayor nach Nogales. Er hatte es schon lange vor, zu einem Schlag gegen ihn auszuholen. Deshalb trommelte er alle seine früheren Freunde zusammen.«
»Auch Shibell?« erkundigte sich der Marshal.
»Phin hat ihm eine Nachricht geschickt. Er gehört ja auch zu seinen Freunden. Es war nicht notwendig, daß er herkam. Aber er kam – er, Darridge und…«
»Und wer noch?«
»Und die anderen eben. Nicht so wichtig. Phin hat seine Wut, die er auf den Mayor hatte, gekühlt. Und nachdem Sie nun gekommen sind, bin ich davon überzeugt, daß Phins Genugtuung nicht von Dauer sein wird. Immerhin ist der Mayor ja noch hier im Jail, und Sie werden ihn da ja wohl herausholen und dafür diesen trinkfesten Richter einlochen!«
»Darauf können Sie sich verlassen.«
»Und mich werden Sie auch hineinstecken!«
»Richtig, Mister Miller. Luke, nehmen Sie sich seiner und des Richters bitte an.«
Protestlos ließen sich die beiden sonderbaren Gauner abführen.
Sollte das bereits des Rätsels Lösung sein?
Die Freunde blickten einander betroffen an.
Da erklärte Curle Shibell: »Niemals stimmt das! Der Kerl hat gelogen. Wer hat denn Cox erschossen? Und wo sind die beiden Mädchen?«
»Alles der Reihe nach«, meinte der Georgier. »Jetzt haben wir es zunächst mit Phin zu tun.«
Da nahm Shibell seinen Hut vom Kopf und schleuderte ihn auf den Wandhaken.
»Marshal, ich werde Ihnen jetzt alles sagen. Es hat doch keinen Sinn mehr, zu schweigen. Ich bin von Tucson auf die Ranch meines Bruders geritten, weil ich erfahren habe, mit welchen Leuten Oswald zu tun hat. Ich wollte ihn warnen, nicht zuletzt deshalb, weil Sie in der Gegend sind. Und weil ich fest davon überzeugt war, daß Sie auch ihn aufspüren würden. Ich habe den Zettel gefunden, der auf dem Tisch lag. Ich wußte aber nicht um die Zusammenhänge. Aber, daß er etwas mit dem Mord an Cox oder mit der Entführung der beiden Mädchen zu tun haben könnte, das glaube ich nicht.«
»Das wird sich noch herausstellen.«
Wyatt nahm den Revolver, den er dem Sheriff auf der Ranch abgenommen hatte und warf ihn ihm zu.
»So, Mister Shibell, setzen Sie sich da auf den Stuhl. Mir scheint, die Stadt braucht im Augenblick einen wachsamen Gesetzesmann. Sie können eine ganze Menge wiedergutmachen, wenn Sie mir jetzt helfen.«
Der Sheriff nickte. »All right. Ich habe übrigens das Gefühl, daß sich Cornelly davongemacht hat.«
»Das Gefühl habe ich auch«, entgegnete der Marshal.
Luke Short kam aus dem Gefängnistrakt zurück und warf den Schlüsselbund auf den Haken.
»Möchte nur wissen, wohin die Tür führt, die ich am Ende des Zellenganges entdeckt habe.«
»Eine Tür?« Wyatt nahm sofort die Lampe und den Schlüsselbund und ging dann von Doc Holliday gefolgt in den Anbau, der als Jail diente.
Am Ende des Ganges war tatsächlich eine Tür. Sie war fest verschlossen. Wyatt versuchte einen Schlüssel nach dem anderen, aber sie ließ sich einfach nicht öffnen.
Da trat hinter ihm ein Mann an eine der Gittertüren.
»Ich weiß nicht, wer Sie sind, Mister. Mein Name ist Angerer… Ich…«
Wyatt wandte sich um. »Doc, bitte, holen Sie den Mayor heraus.«
Tom Angerer trat in den Zellengang und ging auf Wyatt Earp zu.
»Ich vermute, Sie sind Marshal Earp, nicht wahr? Ich habe vorhin schon so etwas gehört. Weiß der Teufel, wer mich hier in die Tinte geritten hat!«
»Phin Clanton«, entgegnete der Marshal. »Sie sollten es eigentlich wissen, Mayor. – Wissen Sie, wohin diese Tür hier führt?«
»Nicht genau. Es sind noch zwei Kammern dahinter, die später angebaut wurden.«
»Wo ist der Schlüssel für diese Tür?«
»Das weiß ich nicht.«
Wyatt lief ins Office zurück.
Shibell kam ihm schon entgegen.
»Hier habe ich noch einen Schlüssel gefunden! Vielleicht brauchen Sie den.«
Wyatt hatte kaum einen Blick darauf geworfen, als er auch schon nickte.
»Das ist der richtige.«
Die beiden Dodger verließen das Office wieder, durchquerten den Zellengang und öffneten die Tür.
Vor ihnen lag ein leerer, düsterer Raum, an dessen Ende wieder eine Tür zu sehen war.
Auch sie war verschlossen.
»Da drinnen atmet jemand!« raunte Wyatt dem Spieler zu. Der klopfte mit den Fingerknöcheln gegen die Türfüllung, erhielt aber keine Antwort. Da nahm er ein paar Schritte Anlauf, rannte gegen die Tür, warf sich mit der Schulter dagegen, und das Holz barst krachend auseinander.
Holliday hielt die Lampe in die Öffnung. Und dann bot sich den beiden Männern ein Bild, das sie verstummen ließ. Auf einem Strohlager lag ein kleines Mädchen an Händen und Füßen gefesselt und außerdem mit den Fesselschnüren an einem Wandring gesichert.
Wenige Schritte links des Kindes lag eine Frau, oder war es ein Mädchen, auf die gleiche brutale Art gefesselt.
Wyatt brach das Loch in der Tür sofort weiter auf, so daß er hindurchsteigen konnte, schnitt erst das Kind, dann die andere Gefangene los. Die beiden waren nicht nur gefesselt, sondern auch geknebelt.
Das Mädchen weinte. Der Marshal streichelte über seinen Kopf und tröstete es.
Doc Holliday nahm das Kind in Empfang und brachte es sofort zu seinen Eltern.
Das andere Mädchen war Judy Morrison. Sie sah den Marshal ganz ängstlich an.
»Mein Name ist Earp. Ich bin zufällig in die Stadt gekommen und habe von Ihrem Verschwinden gehört, Miß Morrison.«
»Earp?« fragte sie. »Wyatt Earp?«
»Ja.«
Da reichte Judy dem Marshal die Hand. Tränen standen in ihren Augen.
»Wer hat Sie hierher gebracht, Miß Morrison?«
»Ich weiß es nicht! Ich weiß nur, daß der Sheriff damit zu tun hat. Ich glaube, sie wollten wissen, wo mein Bruder ist. Er hat früher zu ihnen gehört.«
»Zu wem?«
»Zu Männern, mit denen er immer weggeritten ist. Ich glaube, es waren meistens Leute aus der Tombstoner Gegend.«
»So, Miß Morrison, und nun werde ich Sie zu Ihrer Mutter bringen. Ich glaube, es ist Zeit.«
Sie nickte.
Er riß von innen die Tür auf und führte das Mädchen hinaus. Als sie im Office ankamen, meinte der Texaner kopfschüttelnd: »Was Sie da so alles aus der geheimen Kammer herausbefördern, Marshal. Einfach unwahrscheinlich!«
Der Missourier blieb stehen und deutete auf den Texaner.
»Dieser Mann hat die geheime Tür entdeckt, Miß Morrison.«
Judy reichte dem Texaner dankend die Hand. Dann wurde sie von dem Missourier nach Hause gebracht.
Die alte Frau schloß ihre Tochter stumm vor Freude in die Arme. Als die beiden glücklichen Menschen aufblickten, hatte der Marshal das Haus schon verlassen.
Harry Benso wartete im Sheriffs Office.
»Mister Earp!« rief er in großer Erregung »Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll!«
Wyatt hatte alle Mühe, diesen Dank von sich abzuhalten. Und der überglückliche Vater dachte gar nicht daran, nachzuforschen, wer denn der Entführer seines Kindes gewesen sein könnte. Als er schließlich das Office verlassen hatte, meinte Shibell: »Jetzt möchte ich bloß wissen, wer Cox erschossen und wer die beiden Mädchen entführt hat. Es müssen doch die Galgenmänner die Hand dabei im Spiel gehabt haben, weil vor den Häusern von Cox und Benson Galgen aufgerichtet wurden.«
Der Marshal gab zu bedenken: »Judy Morrison ist von den ehemaligen Freunden ihres Bruders entführt worden. Nicht ausgeschlossen, daß Phin etwas damitziu tun hat. Aber, sicher ist es auch nicht. Ich werde außerdem das Gefühl nicht los, daß sich da mehrere Erpresser die Angst vor Phin und auch vor den Galgenmännern zunutze machten, und diese Gerüste aufstellten.«
»Das wäre wirklich ein teuflischer Trick«, fand der Georgier.
»Und – sind die Freunde von Gil Morrison nun die Galgenmänner?« wollte der Texaner wissen.
Wyatt zog die Schultern hoch und ließ sie wieder fallen.
Es war doch immer das gleiche. Phantome waren sie, die Männer mit den grauen Gesichtern, schattengleich, wenn man nach ihnen greifen wollte, lösten sie sich in einem Nichts auf.
»Ich bin überzeugt, daß Phin längst nicht mehr in Nogales ist«, warf Holliday ein.
»Davon bin ich auch überzeugt«, antwortete Wyatt.
Da wurde die Tür aufgestoßen, und der Pferdehändler trat wieder ein.
»Ich komme noch einmal zurück, Marshal«, meinte er. »Mir ist nämlich noch etwas eingefallen. Vor einiger Zeit fand ich unter meiner Post einen Brief, in dem ich aufgefordert wurde, fünftausend Dollar an eine Friedensorganisation zu zahlen.«
»Was?« fragte der Marshal verblüfft. »Haben Sie den Brief noch?«
»Ja.« Er nahm ihn aus der Tasche und reichte ihn dem Marshal.
Wyatt hatte kaum einen Blick darauf geworfen, als er unten das Dreieckzeichen sah.
Ein Brief von den Galgenmännern! Sie hatten also seine Tochter entführt, um das Geld von dem wohlhabenden Pferdehändler zu erpressen!
Eines stand also fest: der Sheriff von Nogales war ein Verbrecher. Einerlei, ob er zu den Galgenmännern gehörte oder nicht.
Ob Phin Clanton dazugehörte, war immer noch eine Frage. Sein Angriff auf den Mayor schien eine rein persönliche Sache gewesen zu sein, wenn auch seine Rache ein eindeutiges Gangsterstück war. Aber Wyatt nahm sich vor, das noch genau zu untersuchen. Er traute es dem unberechenbaren Phin ohne weiteres zu, daß er all seine Freunde zusammentrommelte, und nach Nogales rief, um eine persönliche Rache an einem einzelnen Mann zu nehmen. Die Angst, die er dabei verbreitet hatte, bereitete einem Mann wie ihm nur Befriedigung und Genugtuung.
Noch aber war die wichtigste Frage ungeklärt: Wer hatte den Viehhändler Cox getötet?
Jetzt war auch der andere Deputy im Office und versprach, wie sein Kamerad, dem County Sheriff Shibell alle Hilfe zu leisten, die er jetzt hier im Office brauchte.
Wyatt Earp, Doc Holliday und Luke Short verließen das Büro. Als sie auf der Straße standen, meinte der Georgier: »Phin und Cornelly sind bestimmt weg. Aber ich kann mir nicht denken, daß sie schon alle weg sind. Wenn wir nur einen von ihnen fänden, wäre schon viel gewonnen.«
Wyatt entgegnete: »Wir müssen nach ihnen suchen.«
Die Suche hatte nach anderthalb Stunden Erfolg. Und zwar ausgerechnet im Gold-Dollar Saloon.
Schwer angetrunken lehnte ein Mann an der Theke, den der Marshal genau kannte. Es war der Cowboy Darridge von Oswald Shibells Ranch.
Wyatt nahm ihn sofort mit hinaus, stülpte seinen Kopf in die Pferdetränke, schüttelte ihn, und brachte ihn dann ins Office.
»So, Cowboy, jetzt machst du den Mund auf! Wo ist Oswald Shibell?«
»Der Boß?« lallte der Cowboy immer noch benommen. »Er ist längst weggeritten. Ich weiß nicht wohin. Er wollte sich hier mit seinem alten Freund Phin treffen…«
Das schien also zu stimmen.
»Und du, was wolltest du hier?«
Sheriff Shibell hatte den Cowboy inzwischen untersucht und eine ganze Menge Geld bei ihm gefunden. Und außerdem eine Rechnung für dreitausend Rinder.
Da kniff der Missourier ein Auge ein, packte den Cowboy und zog ihn zu sich heran. Wie Brandpfeile zischten Darridge die Worte entgegen: »Weshalb hast du Cox erschossen?«
Der Cowboy wurde weiß wie die gekalkte Wand hinter ihm.
»Weil… ich«, stotterte er, dann brach er jäh ab.
»Rede!« donnerte ihn die metallene Stimme des Marshals an.
Der Cowboy zitterte an allen Gliedern. Plötzlich sank er in sich zusammen, kniete am Boden und keuchte: »Ich hörte, wie einer von Phins Freunden von den Rindern berichtete…, und dann dachte ich, weil Cox sie doch billig bekommen hatte…, würde er vielleicht das Geld herausrücken. Aber dann dachte ich…«
Wyatt schüttelte seinen nassen Schädel hin und her.
»Weshalb hast du ihn getötet?«
»Weil ich glaubte, er hätte mich erkannt…, und um meine Spur zu verwischen, setzte ich einen Galgen auf…«
Luke Short brachte den Mörder ins Jail.
Die Angst war von Nogales gewichen.
Phin Clanton, der sie in die Stadt getragen hatte, war längst nicht mehr hier. Auch der verräterische Sheriff Cornelly war verschwunden.
Richter Green, der aus Oro Blanco gerufen worden war, hatte eine schwere Verhandlung vor sich, in der alle Festgenommenen ihre gerechte Strafe erhielten. Über die echten Galgenmänner wurde nichts mehr ermittelt.
Die drei Freunde verließen wenige Tage später die Stadt. Als die Savanne wieder vor ihnen lag, meinte der Georgier: »Ich wette, daß wir jetzt wieder einen Ritt nach Norden vor uns haben.«
Der Marshal nickte. »Ja. Ich suche Phin Clanton und Jeff Cornelly!«