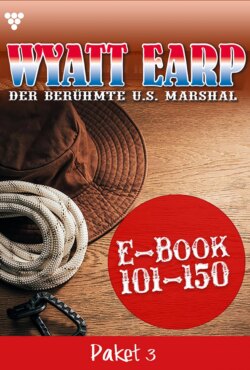Читать книгу Wyatt Earp Paket 3 – Western - William Mark D. - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеMitten unter der Menschenmenge, die sich gegen den Vorbau des Crystal Palace drängte, stand ein schnauzbärtiger Mann, der ein Gewehr in der Hand hielt.
Der Mörder Kilby. Mit kalten unbeteiligten Augen beobachtete er das Ringen vor der Schankhaustür.
Eben flog mit berstendem, krachendem Geräusch ein menschlicher Körper durch die Schwingarme der Tür, prallte draußen gegen einen Vorbaupfeiler und sackte auf die Stepwalkbohlen. Der schnauzbärtige Mann mit dem Gewehr sah, wie jetzt ein riesiger Mensch den Crystal Palace verließ.
Es war der Texaner Luke Short.
Er wurde draußen von mehreren Männern angegriffen, räumte aber mit seinen Bärenkräften fürchterlich unter ihnen auf.
Es war die Ringo-Bande, die hier den Vorbau zu stürmen versuchte.
Aber der Hüne erhielt jetzt wirksame Unterstützung von zwei Männern, die für ein halbes Dutzend zählten.
Wyatt Earp und Doc Holliday!
In diesem Augenblick stürmte eine junge Frau aus der Schanktür auf Doc Holliday zu und wies mit dem Arm in die Menge.
Kilby erschrak bis ins Mark.
Ich habe keine Chance! zuckte es durch sein Hirn. Und im Bruchteil einer Sekunde handelte er. Er hob den Lauf des Gewehrs, das bei ihm stets durchgeladen war, und zog den Stecher durch.
Der Schuß röhrte über den Vorbau.
Die Frau bekam einen Stoß und torkelte zurück. Der Marshal fing sie auf.
Kilby hatte das Gewehr blitzschnell zurück auf den Vorbau gelegt und es verstanden, die Panik der Menge für seine Flucht auszunutzen. Er stürmte an dem Vorbau entlang, weiter in die Dunkelheit der Gasse hinein, blieb bei Myers Clothing Store vor dem offenen Tor stehen und blickte in den düsteren Hof.
Aber dann entschloß er sich doch, sich hier nicht zu verstecken, da man ihn hier vermutlich zuerst suchen würde.
Er warf sich herum und tigerte in weiten Raubtiersätzen über die Straße, auf das dunkle Hoftor des Zimmermanns Lonegan zu.
In diesem Augenblick hörte er die Schritte des ersten Verfolgers in der Gasse.
Luke Short war ihm gefolgt.
Kilby stieß gegen das Tor – und mußte zu seinem Schrecken feststellen, daß es verschlossen war.
Wie ein gehetztes Tier wirbelte er herum und sprang auf einen Wagen zu, der neben dem Haus des Zimmermanns stand.
Es war ein großer vierspriegeliger Planwagen.
Auf der dem Texaner abgewandten Wagenseite zog Kilby sich unter der Plane an der Wagenplanke hoch und ließ sich auf die Bodenbretter gleiten. Schwer atmend lag er auf den kühlen Holzplanken und lauschte.
Dann hörte er drüben einen zweiten Mann herankommen.
Kilby richtete sich auf und entdeckte einen Schlitz in der Plane, durch den er die andere Straßenseite beobachten konnte, er sah jetzt die beiden Männer drüben stehen.
Schweiß rann ihm in Bächen unter dem Hutrand hervor.
Er sah, wie Luke Short sich umwandte und der Marshal drüben in Myers Hof verschwand. Es war also genauso gekommen, wie er befürchtet hatte.
Jetzt muß ich verschwinden! hämmerte es im Hirn des Verbrechers. Ich muß die Zeit ausnutzen, die der Verfolger in dem Hof drüben verbringt.
Er schob sich wieder über die Bordwand des Wagens, schlüpfte unter der Plane hervor und glitt neben dem rechten Hinterrad vom Wagen. Eine Sekunde blieb er lauschend stehen.
Dann entfernte er sich wie ein Schatten huschend, an der rechten Häuserfront entlang auf die Fremontstreet zu.
Als er sie erreicht hatte, hastete er vorwärts, blieb an der City Hall noch einmal stehen, um zu lauschen, wandte sich dann um und lief weiter. Er befand sich nur noch wenige Meter vor dem Eingang des O.K.-Corrals, als er jäh zusammenschrak und wie angenagelt stehenblieb.
Aus der Toreinfahrt schnellte ein Schatten hervor.
Kilby preßte sich gegen die Tür von Flys Galery.
Aber es war nur ein Hund, der aus dem Wagenabstellplatz hervorschoß; groß, schwarz und lautlos setzte er jetzt über die Straße und verschwand im Hof der Schneiderei Booland.
Aus der Gassenmündung der Secondstreet drang das Geräusch von Schritten.
Der Bandit wandte sich wieder um, huschte an der City Hall vorbei zurück, scheute aber die Einmündung der Thirdstreet. Geduckt überquerte er den breiten Fahrdamm der Fremontstreet und fand – erleichtert atmete er auf – das Hoftor neben Millers Bar geöffnet, stahl sich hindurch und hastete auf einen Kistenstapel im Hof zu, den er im diffusen Mondlicht schon vom Tor aus entdeckt hatte. Als er aber davorstand, mit den Händen nach den Kisten tastend, zuckte er zurück.
Särge! Er war in den Hof eines Undertakers (Beerdigungsunternehmer) geraten.
Aber die schnellen Schritte, die jetzt draußen auf der Straße zu hören waren, veranlaßten ihn, dennoch die Deckung dieser makabren Umgebung zu suchen.
Er kletterte an dem Stapel hinauf und verbarg sich in einem deckellosen Sargkasten.
Da hörte er, daß jemand im Hof war. Ganz deutlich vernahm er drüben am Stallhaus Schritte. Sie näherten sich dem Sargstapel. Plötzlich verstummte das Geräusch.
Der Mann im Sarg starrte mit weit aufgerissenen Augen in das mit flimmernden Sternen bedeckte Himmelsgewölbe. Den Mund hatte er weit geöffnet, um sich nicht durch ein Atemgeräusch zu verraten.
Plötzlich durchzuckte ihn jäher Schreck.
Ganz deutlich hörte er – an dem Sarg, der unter ihm stand, das Tasten einer Hand.
Es bestand für den Verbrecher nicht der geringste Zweifel, daß der Mann, der ihn da aufgespürt hatte, niemand anderes als Wyatt Earp sein konnte.
Der Bandit lag in äußerster Anspannung da und hielt den Atem an.
Dumpf dröhnte ihm der Schlag des eigenen Herzens in den Ohren. Und zwar so laut, daß Kilby befürchtete, der Mann unten, neben dem Sargstapel, müsse es hören können.
In diesem höllischen Augenblick wurde oben am Haus die Tür geöffnet, und eine kreischende Frauenstimme drang über den Hof.
»He, wer ist denn da? Was machen Sie denn hier?«
Die Frau hielt inne. »Marshal?« fragte sie ungläubig. Offenbar hatte sie den Mann erkannt. »Was suchen Sie in unserem Hof? Um Gottes willen – schmeißen Sie nicht die Särge um, die sind noch nicht bezahlt! Und leider auch noch nicht verkauft. Es sterben zu wenig Leute in dieser Stadt.«
Aus allernächster Nähe vernahm der Mann im Sarg die Stimme des Missouriers. Ihr metallener Klang ließ ihn erzittern.
»Tut mir leid, daß ich nichts zur Hebung Ihres Geschäftes tun kann, Mrs. Blaffer. – Ich suche einen Mann, der vorm Crystal Palace eine Frau niedergeschossen hat.«
Gleich darauf war die krächzende Stimme der Alten wieder zu hören.
»Sie werden doch nicht annehmen, daß er sich in einem unserer Särge versteckt hat.«
»Ausgeschlossen ist es nicht.«
»Um Himmels willen, schmeißen Sie die teuren Särge bloß nicht um. Mr. Putkin verlangt für das Stück siebzehn Dollar. Das Geld muß ja schließlich erst verdient werden…«
Der Marshal winkte ab und verließ den Hof.
Kilby atmete tief auf.
Die Frau, die noch im Hof gestanden und sich umgewandt hatte, fuhr zusammen.
»He?« fragte sie mit schiefgelegtem Kopf, »ist da jemand?« Sie blieb noch einen Augenblick stehen und verschwand dann im Haus. Die Tür wurde von innen verschlossen.
Kilby lag wie versteinert in dem Sargkasten und starrte wieder in die flimmernden Sterne.
»Das war nahe dran«, flüsterte er tonlos vor sich hin.
Minutenlang wagte er nicht, sich zu bewegen.
Wie konnte ich auch nur so wahnsinnig sein, mich ausgerechnet in diesem Hof zu verstecken, in einem Sargstapel! überlegte er. Vielleicht aber war gerade das seine Rettung gewesen. Er konnte nicht begreifen, wie der Marshal seine Spur bis hierher hatte verfolgen können.
Oder war Wyatt Earp zufällig in den Hof des Undertakers gekommen?
Auf der Fremontstreet draußen waren Schritte zu hören. Zwei Männer gingen vorüber und unterhielten sich ziemlich laut miteinander. Kilby konnte jedoch nichts von dem, was sie sagten, verstehen.
Er wartete eine Viertelstunde, ehe er es wagte, sein unheimliches Versteck zu verlassen.
Auf einem Umweg gelangte er in die Gasse, in der Rozy Gingers Bar lag. Befriedigt stellte der Verbrecher fest, daß der Saloon schon geschlossen war. Die Fenster waren zur Straße hin unbeleuchtet und keinerlei Geräusche mehr zu vernehmen.
Er schlich den gewohnten Weg durch den Hof an die rückwärtige Tür, fand diese aber verschlossen.
Zorn stieg in dem Banditen auf.
Er trat unter das Küchenfenster und versuchte es hochzuziehen, was ihm jedoch nicht gelang.
Da nahm er sein Bowiemesser aus dem Stiefelschacht, schob die Spitze unter das Fensterholz und preßte die Klinge mit aller Kraft tief in den entstandenen Spalt.
Als das Fenster sich auch jetzt noch nicht anheben ließ, stieß er das Messer noch einmal hart in den Spalt und brach den metallenen Bügel aus seiner Halterung.
Jetzt konnte er das Fenster hochschieben. Er schwang sich am Sims hinauf und stand gleich darauf in der dunklen Küche des Saloons.
Auf dem Weg zur Flurtür stieß er mit dem Schienbein gegen einen Hocker.
Er preßte einen Fluch durch die Zähne.
Die Flurtür war nicht ganz verschlossen.
Er legte das Ohr an den Spalt und lauschte hinaus.
Alles schien still zu sein.
Kilby hob die Tür vorsichtig an, um kein Geräusch zu machen, schob sich in den Flur und tastete sich dann zur Treppe weiter.
In diesem Augenblick hörte er vor der Straßentür Stimmen.
Zu seinem Entsetzen hörte er plötzlich, wie ein Schlüssel in die Haustür geschoben wurde.
Gerade gelang es Kilby noch, sich unter der Treppe durch den Vorhang in die Gerümpelecke zu zwängen, wo er kauernd stehenblieb.
Die Tür sprang auf, und gleich darauf war die Stimme eines Mannes zu hören.
»Leise! Macht keinen Lärm. Wir gehen die Treppe hinauf.«
Kilbys Kehle war wie ausgetrocknet vor Angst. Er hatte die Stimme des Desperados Frank McLowery erkannt!
Auf keinen Fall durfte er ihn hier finden.
Es waren fünf Männer; sie gingen die Treppe hinauf ins Obergeschoß, wo sie in dem großen Raum, den sie oft zu Beratungen benutzten, verschwanden.
Kilby hatte die Zähne hart aufeinander gepreßt.
Er dachte an die Frau! Sie hatte es also doch gewagt, ihm diesen Streich zu spielen. Sie wußte genau, daß er in der Nacht wiederkommen wollte. Sie hatte nicht den Marshal benachrichtigt, dafür anscheinend aber die Clantons. Das war für Kilby ebenso schlimm.
Er hatte keine Wahl. Hier konnte er nicht bleiben. Also verließ er das Haus auf dem gleichen Wege, auf dem er es betreten hatte. Als er das Hoftor erreicht hatte, wurde ihm klar, daß er die Stadt verlassen mußte.
Wyatt Earp würde ihn so lange suchen, bis er ihn gefunden hatte. Und welch gefährlicher Fährtensucher der Missourier war, hatte Kilby ja im Hof des Undertakers erlebt.
Er lief hinunter bis in die Sandstreet, an deren Ende sich der kleine Corral des Mexikaners Carlo befand.
Kilby hatte sein Pferd absichtlich dort abgestellt, um gegebenenfalls ungesehen die Stadt verlassen zu können.
Aber jetzt durfte auch der Mexikaner ihn nicht kommen und gehen sehen.
Er trat in den Hof, schlich zum Stall hinüber und schrak zusammen, als plötzlich eine Gestalt vor ihm auftauchte.
Er sah es sofort: es war der Mexikaner.
Kilby riß sein schweres Bowiemesser hoch und schlug dem Mexikaner mit dem Messerknauf hart über den Schädel.
Carlo sackte mit einem Röcheln an der Stallwand in sich zusammen.
Der Bandit tastete sich zur zweiten Box vor, nahm sein Pferd heraus und führte es in den Hof; dann zerrte er den Sattel vom Holm und legte ihn dem Wallach auf.
Für den Mann, der neben der Stalltür am Boden lag, hatte der Outlaw keinen Blick mehr.
Aber er verließ den Mietstall noch nicht, denn er brauchte ein Gewehr. Seine Büchse hatte er ja auf dem Vorbau des Crystal Palace liegengelassen.
Kilby führte den Wallach an das kleine Haus des Mietstallinhabers, trat durch die offenstehende Tür in den Korridor und fand sehr schnell, was er suchte. Zwar war es diesmal keine Winchester, sondern nur ein altes Sharpsgewehr, aber für Kilby, der unbedingt ein Gewehr brauchte, war es besser als nichts.
Zwei Minuten später sprengte er aus dem Mietstall hinaus in die Prärie und hielt nach Süden auf die Blauen Berge zu.
*
Im Hinterzimmer des Crystal Palace lag Laura Higgins mit beinernem Gesicht auf dem großen grünen Spieltisch.
Doc Holliday hatte ihr ein Kissen unter den Kopf geschoben und blickte jetzt auf den Fleck, der sich groß und dunkel auf ihrem grünen Brokatkleid ausgebreitet hatte.
Luke Short trat ein und stellte die schwarze krokodillederne Tasche des Georgiers auf einen Stuhl.
»Brauchen Sie mich noch, Doc?«
Der Georgier nickte. »Ja, bitte, bleiben Sie hier, Luke.«
Die Frau des Salooninhabers, eine hagere Fünfzigerin, lehnte mit ängstlichem Gesicht am Fenster und blickte auf die gespenstische Szene.
In diesem Augenblick schlug Laura Higgins die Augen auf. Sie sah das Gesicht des Georgiers über sich und fragte verwundert: »Doc…?«
»Machen Sie sich keine Sorgen, Miss Higgins«, suchte Doc Holliday sie zu beruhigen. »Es ist nicht so schlimm, wie es den Anschein hat.«
»Was…?« Sie wußte also gar nicht, was geschehen war.
Als sie sich aufrichten wollte, fuhr ein stechender Schmerz durch ihren Oberkörper. Sofort sank sie zurück und fiel glücklicherweise wieder in eine gnädige Ohnmacht.
Es dauerte nur Minuten, dann hatte der einstige Bostoner Arzt das verformte Geschoß in seiner Pinzette.
Die Frau am Fenster hatte sich längst umgewandt und starrte in den dunklen Hof.
Und Luke Short, der Mann ohne Nerven, hatte kleine Schweißperlen auf der Stirn stehen. »Damned, war das eine scheußliche Arbeit«, meinte er heiser. »Sie könnten mir tausend Dollar geben, ich möchte sie nicht tun.«
Nachdem der Georgier der Verletzten einen Verband angelegt hatte, schlug sie wieder die Augen auf. Jetzt stand blanke Angst in ihnen.
»Was ist geschehen, Doc?«
»Sie sind verletzt worden.«
»Verletzt? Wann? Wo?«
»Vorhin, draußen auf dem Vorbau.«
Eine Erinnerung schoß ihr blitzartig in den Kopf.
»Kilby!« hauchte sie, »Kilby! Ich habe ihn gesehen.«
»Sie meinen, daß es Kilby gewesen ist?«
»Er war es ganz bestimmt.«
»Wir haben ein Gewehr gefunden«, meldete sich der Riese von der Tür her.
»Und? Haben Sie den Mann gestellt?«
»Nein. Der Marshal ist ihm gefolgt. Aber in der allgemeinen Panik, die draußen vorm Eingang entstand, konnte sich der Halunke davonmachen.«
In den Augen der Frau stand eine bange Frage.
»Ist es schlimm?«
Der Spieler schüttelte den Kopf. »Nein, nicht sehr.«
Er nahm eine große goldene Brosche, die er ihr vom Kleid genommen hatte vom Tisch und hielt sie hoch.
»Sehen Sie die Beule hier? Dort ist die Kugel aufgeschlagen. Sie ist abgefälscht worden und in stumpfem Winkel oben in die Schulter geschlagen. Das war Ihr Glück.«
Plötzlich fühlte er, wie ihre Hand sich um seine Linke spannte.
Flüsternd kam es über die Lippen der Frau: »Ich danke Ihnen, John.«
Holliday machte sich von ihr los. »Ich werde Sie hinüber in Ihr Hotelzimmer bringen lassen, Miss Higgins.«
Sofort schwand der warme Glanz aus den Augen der Frau.
»Ja, und vergessen Sie nicht, mir die Rechnung zuzuschicken, Dr. Holliday.«
Der Spieler nahm seinen Hut und ging mit Luke Short hinaus.
»Übrigens, da fällt mir ein«, meinte der Texaner, »ich habe drüben in Virgils Hof einen Burschen eingesperrt. Jimmy King. Hieß so nicht der Mann aus Nogales, der den Mayor in die Tinte reiten wollte?«
»Richtig! Wo haben Sie ihn erwischt?«
»Er stand hier an der Theke, total betrunken.«
Als der Bursche aus seinem unbequemen Gefängnis im Geräteschuppen herausgeholt worden war, stand er verstockt und mit gesenktem Schädel vor den beiden Männern.
»Nun, Boy, hast du uns nichts zu sagen?« fragte ihn der Texaner.
Jimmy King schüttelte den Kopf. »Nein, nichts.«
»Wie du willst. Dann kommst du eben ins Jail.«
Ed Fletcher, Oswald Shibell und die Flanagans erhielten Zuwachs. Nur Shibell schien Jimmy King zu kennen. Als er ihn jetzt im Schein der Lampe, die Doc Holliday hielt, im Zellengang sah, konnte er einen Ausruf der Verwunderung nicht unterdrücken.
Aber er ließ sich nichts anmerken.
»So«, meinte Luke Short, als er die Tür zum Gefängnistrakt hinter sich verschlossen hatte, »jetzt habe ich noch einen Besuch zu machen.«
»Bei wem?« erkundigte sich der Georgier.
»Bei Jonny Behan!«
Während Doc Holliday auf dem Vorbau blieb, um auf die Rückkehr des Marshals zu warten, ging der Texaner in das Boardinghouse, in dem Jonny Behan ein Zimmer hatte.
Die Hauswirtin kam ihm schon auf der Treppe entgegen.
»Suchen Sie den Sheriff?«
»Den Sheriff?« fragte der Riese dröhnend, »diese Pappfigur ist alles andere nur kein Sheriff! Wo ist der Bursche?«
»Er ist nicht da. Er hat einen wichtigen Ritt zu unternehmen.«
»Zeigen Sie mir sein Zimmer.«
Die Frau führte ihn hinauf, leuchtete mit der kleinen Flurkerosinlampe in den Raum und blickte sich verblüfft um.
»Nanu, was ist denn das? Er hat ja alles mitgenommen!« stotterte sie.
Der schmale Schrank drüben stand offen und war vollkommen leer. Leer war auch die Nachtkommode und der Tisch. Jonny Behan hatte alles mitgenommen.
»Ausgeflogen ist er, der Vogel!« meinte der Riese grimmig und rieb sich das Kinn.
Wyatt war inzwischen beim Crystal Palace eingetroffen und sah Doc Holliday, der vom Bureau des Marshals auf ihn zukam.
»Nichts«, berichtete er.
»Dachte ich mir«, entgegnete der Spieler. »Der Bursche hatte Glück. Das Durcheinander vor der Schenke machte es ihm ganz leicht, zu entkommen.«
»Wir werden ihn finden.«
Da kam Luke Short auf die beiden zu.
»Tombstone ist von einem fürchterlichen Verlust betroffen worden!« rief er ihnen entgegen. »Jonny Behan hat sich auf und davon gemacht.«
Es war tatsächlich so. Der laue Hilfssheriff hatte die Stadt mit unbekanntem Ziel verlassen. Seiner Zimmerwirtin hatte er erklärt, daß er höchstwahrscheinlich nach Tucson reiten müsse. Aber das glaubten die drei Freunde nicht.
Doc Holliday hatte sich eine seiner langen russischen Zigaretten angezündet und blickte die dunkle Straße hinunter.
»Vielleicht wäre es nicht falsch, Marshal, wenn man jetzt noch einmal bei Rozy Ginger nachsehen würde.«
»Ja, das habe ich auch vor.«
Luke Short blieb in der Nähe des Office, um zu verhüten, daß die Gefangenen befreit wurden.
Wyatt Earp und Doc Holliday traten zum letzten Male den Weg zu Rozy Ginger an. Als sie oben in die finstere Mündung der gewundenen Gasse einbogen, hatten unten fünf Männer das Ende der Gasse erreicht und verließen sie gerade.
Kirk McLowery, Cass Claiborne, Curly Bill, Larry Lemon und William Hickok. In einem der Zimmer des Obergeschosses brannte noch Licht.
Wyatt klopfte an die Haustür.
Oben wurde ein Fenster geöffnet. »Wer ist da?« rief die Saloonerin.
»Wyatt Earp«, meldete sich der Marshal.
»Ich komme sofort!«
Die beiden Männer blickten einander verblüfft an.
»Seit wann ist die denn so freundlich?« fragte der Georgier.
»Das werden wir gleich erfahren.«
Lichtschein fiel durch die winzigen Türfenster. Ein Schlüssel wurde ins Schloß geschoben – die Tür öffnete sich.
»Mr. Enrique…«, Rozy Ginger stand mit bleichem Gesicht auf dem Flur und blickte dem Marshal entgegen.
»Nun, Miss Ginger?« fragte er. »Haben Sie mir jetzt etwas zu sagen?«
»Ja.« Jetzt endlich gestand die Frau, was sie längst hätte gestehen sollen: daß sie den Mord an Sheriff Cornelly hier vor ihrem Hause beobachtet hatte. Sie verschwieg zwar, daß Kirk McLowery auch in der Nähe gewesen war, beschrieb aber dem Marshal den Mörder Kilby haargenau. Sie berichtete auch, daß er mehrfach hierher gekommen war und sie erpreßt hatte.
»Vor einer halben Stunde war er wieder hier, verließ aber das Haus, weil… weil…«
»Es ist gut, Miss Ginger«, unterbrach sie der Marshal. »Gute Nacht.«
Die beiden verließen den Vorbau.
»Wir kennen ihn und wissen, was er für ein Pferd reitet«, überlegte der Marshal. »Wo mag er das Tier untergestellt haben? Vielleicht bei Horman?«
Sie trommelten oben an der Ecke der Allenstreet den alten Horman aus dem Bett. Obgleich der Mietstallinhaber erklärte, daß das Pferd nicht in seinen Stallungen stehe, verlangte der Marshal, die Boxen zu sehen.
Der Wallach des Mörders war wirklich nicht hier.
Wieder standen sie auf der Allenstreet und überlegten.
»Carlo…«, sagte der Marshal, »läge bedeutend günstiger für ihn. Unten am Stadtrand, ein einzelner Mann? Das Gegebene für einen Banditen wie diesen Kilby.«
Im Eilschritt näherten sie sich dem kleinen Mietstall des Mexikaners.
»Die Haustür steht offen!« rief Doc Holliday, der den Hof von der anderen Seite her betreten hatte.
Wyatt Earp, der auf den Stall zugegangen war, blieb stehen. Er sah neben der Tür einen dunklen Körper am Boden liegen. Sofort hatte er den Revolver in der Faust.
»Doc!«
Der Gambler kam heran und kniete neben dem Mann am Boden nieder.
»Er ist besinnungslos«, sagte er nach kurzer Unterhaltung.
Sie schleppten Carlo hinüber ins Haus und zündeten eine Kerosinlampe an.
Der Mexikaner kam erst jetzt wieder zu sich, so schwer hatte ihn der Hieb mit dem Messerkolben betäubt.
»Was ist passiert, Carlo?« forschte der Marshal.
»Ich weiß nicht… Nicht wissen…«
Der Marshal lief hinaus und suchte die Stallungen ab.
Der gesuchte Wallach befand sich nicht unter den Pferden.
Als er in den Küchenraum zurückkam, fixierte er den Mietstallinhaber scharf.
»Sie haben Kilbys Pferd im Stall gehabt?«
»Kilby? Ich kenne keinen Mann dieses Namens.«
»Ein Bursche von Ihrer Größe etwa mit einem gewaltigen Schnauzbart. Er trägt keinen Waffengurt…« Der Marshal unterbrach sich.
»Haben Sie ein Gewehr im Haus?«
»Ja, im Gewehrständer auf dem Flur, draußen, ein einzelnes Sharpsgewehr.«
Der Missourier trat hinaus auf den Flur.
Es war so, wie er vermutet hatte. Das Gewehr war nicht mehr da. Und der Mann, der den Mexikaner niedergeschlagen hatte, war niemand anderes als der Sheriffsmörder Kilby.
»Zu spät gekommen«, brach es über die Lippen des Marshals.
Luke Short lehnte neben der Tür des Marshal Office und wartete. Als er die beiden Gefährten kommen sah, meinte er: »Wirklich ein gemütliches Nest, dieses Tombstone. Ich werde mir überlegen, ob ich hier nicht Wurzeln schlagen soll.«
»Es gibt keinen Zweifel, der Mann war Kilby«, sagte der Marshal. »Ich muß ihm folgen.«
»Ja, natürlich! Wir reiten immer im Kreis herum«, entgegnete der Spieler. »Am besten sollte man Ike Clanton und die ganze Meute packen und irgendwo in einen Abgrund werfen, dann gäbe es in Arizona bestimmt endlich Ruhe.«
Ein junger Mann aus dem Grand Hotel kam auf den Vorbau und blieb vor Doc Holliday stehen.
»Miss Higgins möchte…«, stotterte er.
»Was ist mit ihr?« fragte der Spieler rauh.
»Ich weiß nicht. Sie schickt mich, Sie zu holen.«
Doc Holliday nickte. »Well, ich komme.«
Der Bursche lief mit der Nachricht zum Hotel hinüber.
»Ihnen bleibt auch nichts erspart«, grinste der Texaner.
Doc Holliday wechselte einen kurzen Blick mit dem Marshal.
»Ich komme gleich zurück.«
Als er an die Zimmertür klopfte, bekam er keine Antwort.
»Miss Higgins?«
»Doc«, kam es schwach zurück.
Er öffnete und trat ein.
»Verzeihen Sie, wenn ich Ihr Klopfen überhört habe, Doc!«
Er trat neben ihr Bett und blickte in ihre Augen.
»Fühlen Sie sich nicht gut, Miss Higgins?«
Die Frau hatte die Lippen zusammengepreßt. Winzige Schweißperlen standen auf ihrer Stirn.
»Miss Higgins!« kam es dann gepreßt aus ihrer Kehle. »Warum nennen Sie mich nicht Laura?«
»Also gut, Laura«, gab er nach, »kann ich irgend etwas für Sie tun?«
»Ja, nehmen Sie sich bitte einen Stuhl und setzen Sie sich zu mir.«
»Der Mann, der auf Sie geschossen hat, war Kilby, Miss Hig… Laura.«
»Ja, ich weiß es.«
»Er ist aus der Stadt geflüchtet.«
»Und…?«
»Wir müssen ihn verfolgen.«
»Wir?« Sie richtete sich mit einem Ruck auf, verzog aber schmerzhaft das Gesicht und sank wieder in die Kissen zurück.
»Sie müssen sich ruhig verhalten, Laura«, mahnte sie der Georgier.
»So, und Sie müssen ihm folgen? Sie? Warum Sie? Warum reitet der Marshal nicht allein?«
»Es hat keinen Zweck, Laura, sich mit Ihnen darüber zu unterhalten. Sie verstehen das doch nicht.«
»Nein, ganz sicher nicht. Und es ist so, wie ich schon gesagt habe. Eines Tages werde ich Sie neben dem großen Earp tot im Straßenstaub liegen sehen…«
Doc Holliday war wortlos hinausgegangen.
Unten vorm Eingang stand der Marshal. Er blickte die Straße hinunter und sagte halblaut: »Es ist hier so unruhig geworden…«
»Ja«, entgegnete der Georgier, »wie in einem Wespennest, dem man mit Rauch zu nahe gekommen ist.«
Sie verließen den Vorbau und hatten kaum drei Schritte gemacht, als ein Schuß über die Straße peitschte.
Wyatt Earp wirbelte herum, und sein Buntline Special brüllte auf. Yardhoch zuckte die orangerote Mündungsflamme.
Und drüben auf der anderen Straßenseite torkelte ein Mann, dessen helles Hemd in der Dunkelheit schimmerte und fiel neben dem Vorbau nieder.
Wyatt, der auf ihn zulaufen wollte, sah im letzten Augenblick, wie der Georgier nach vorn einknickte und sich mit beiden Händen im Staub der Straße aufstützte.
»Doc…!«
Der Spieler schüttelte den Kopf.
Wyatt hatte den Revolver noch in der Linken und legte die Rechte um die Schultern des Freundes.
Er ließ die andere Straßenseite nicht aus den Augen, während er den Georgier aufrichtete.
Vom Marshals Office kam mit weiten Sprüngen der Texaner angerannt.
»Wyatt! Was ist passiert?«
»Holliday ist angeschossen worden.«
»Was?«
»Der Kerl da drüben…«
Luke Short sah sich um.
»Den hat es ja schon erwischt. Ich werde ihn mir ansehen.«
Wyatt Earp führte den Georgier zur Vorbautreppe des Grand Hotels.
Der Spieler saß auf der vorletzten Stufe und blickte starr auf die Straße.
»Im Sand…, im Sand der Straße«, flüsterte er.
Da kam der Texaner wieder heran. »Huxley. Der Bursche, der neulich gegenüber vom Totenhaus auf uns gewartet hat.«
Mehrere Männer kamen aus Harpers Bar und den benachbarten Häusern heran.
Der Marshal erklärte ihnen, was geschehen war.
»Kümmert euch um den da drüben.«
Sie schoben davon.
»Kommen Sie, Luke, wir bringen den Doc ins Russian House.«
Als der Spieler auf seiner Bettkante saß, zogen sie ihm die Jacke aus.
Sein Hemd war am rechten Oberarm dunkel vom Blut.
»Wir müssen Doc Sommers holen«, entschied der Marshal.
Doc Holliday, der die Lippen fest zusammengepreßt hatte, öffnete sie jetzt widerwillig und meinte: »Ich glaube, es wäre besser, wenn Luke das Jail nicht aus den Augen lassen würde.«
Der Texaner nickte. »Aber erst benachrichtige ich Doc Sommers.«
Es dauerte nicht sehr lange, und der greise gebeugte Arzt erschien im Russian House.
Nellie Cashman führte ihn in das Zimmer des Gamblers.
»Doc Holliday«, sagte der alte Arzt. »Damned, ich erinnere mich gut daran, daß Sie mir einmal einen Zahn gezogen haben. Und Sie haben eine saubere Wurzelbehandlung hingelegt. Vergesse ich nie.«
»Dafür dürfen Sie mir jetzt auch einen Zahn ziehen. Er sitzt oben rechts in meinem Arm und ist leider aus Blei. – Übrigens, Marshal«, wandte er sich an den Freund. »Sie brauchen nicht hierzubleiben.«
Der Missourier ging hinaus. Zehn Minuten später stand er vor der Tür des Mayors von Tombstone.
But McIntosh hatte sich trotz der späten Stunde noch nicht schlafen gelegt.
»Earp? Was wollen Sie?«
»Sie können sich ruhig eines anderen Tones befleißigen, McIntosh, denn ich schätze, daß Sie die längste Zeit Mayor dieser Stadt gewesen sind. Nehmen Sie Ihre Jacke und kommen Sie mit.«
»Wohin?«
»Das werden Sie schon sehen.«
Obgleich McIntosh wenig Interesse daran hatte, den Marshal durch die nächtlichen Straßen zu begleiten, trottete er neben ihm her. Es ging hinauf in die Fremontstreet zu John Clum.
Auch der alte Zeitungsmann schlief noch nicht. Ja, er hatte sein Schmerzenslager, das er so lange mit einer schweren Verletzung gehütet hatte, verlassen, saß in seiner Stube und las in einer Zeitung.
»Hallo, John«, begrüßte ihn der Marshal. »Sie hatten doch früher so ein prächtiges System, den Stadtrat blitzschnell zusammenzurufen.«
»Ja, weshalb fragen Sie?«
»Ich hätte dem Stadtrat etwas mitzuteilen.«
»Dieser Mann da ist der Mayor von Tombstone.« Clum deutete mit dem rechten Daumen auf den Pferdehändler McIntosh.
»Well, noch ist er Mayor, morgen nicht mehr – Mr. Clum, die Stadt hat keinen Gesetzesmann!«
»Sind Sie denn nicht hier?« fragte McIntosh dazwischen.
»Nein, ich werde die Stadt noch heute verlassen, um einem Mörder zu folgen.«
Clum kratzte sich am Kinn. »Well, McIntosh«, wandte er sich an den Pferdehändler. »Sie müssen auf dem schnellsten Wege wenigstens drei Männer des Stadtrates zusammentrommeln. Lancona und noch zwei andere.«
Es dauerte eine Viertelstunde, bis McIntosh mit dem Gunsmith Lancona, dem Sattler Henderson und dem Butcher O’Connor zurückkam.
Die drei bärtigen Männer standen in Clums Stube und blickten auf den Marshal.
Wyatt Earp erklärte ihnen, um was es sich handelte.
Lancona nickte. »Well, wir müssen sofort einen Sheriff wählen.«
»Wen?« Die Frage kam von John Clum.
Henderson kratzte sich den grauen Kopf.
»Ich könnte mir vorstellen, daß es niemanden gibt, der sich um diesen Job hier reißt.«
»Eben«, fand auch O’Connor.
Lancona knurrte: »Wir müssen einen Sheriff haben.«
Es war McIntosh, der plötzlich sagte: »Wie wäre es mit Luke Short?«
»Der nimmt den Job nicht an«, erklärte Wyatt Earp.
»Er braucht ihn ja nicht zu behalten. Aber vorübergehend könnte er doch den Stern nehmen.«
Auch John Clum stimmte dieser Ansicht zu.
»Doch, Wyatt, das wäre ein Gedanke. Niemand ist geeigneter für diesen Posten als der Texaner. Vor ihm haben die Leute Respekt, er ist bärenstark und ein schneller und sicherer Schütze.«
Der Marshal überlegte nicht lange.
»Well, dann müssen Sie es ihm selbst sagen.«
John Clum zog seinen braunen Gehrock an, stülpte seinen Hut auf und humpelte mit den anderen die Thirdstreet hinunter.
Der Texaner machte große Augen, als er die Männer bei sich im Office eintreten sah. Dann blickte er den Marshal an und meinte: »Das sieht ja nach einem Komitee aus.«
»Das ist es in gewisser Hinsicht auch«, entgegnete John Clum.
»He, wo wollen Sie hin, Wyatt?« meinte der Texaner, dem bei der Sache nicht geheuer war, als er sah, daß der Missourier in den Hof gehen wollte.
Wyatt blieb stehen. »Well, John Clum und die Männer vom Stadtrat haben Ihnen etwas zu sagen, Luke.«
Da trug der einstige Indianeragent und Gründer vieler Reservate, John Clum, der vor McIntosh lange Jahre Mayor von Tombstone gewesen war, dem Texaner die Bitte des Stadtrats vor.
»Was, Sheriff? In diesem Nest? Ich bin doch nicht lebensmüde.«
Da trat der Marshal auf ihn zu und blickte ihm in die Augen.
»Luke, ich muß jetzt weg, Sie wissen es. Und der Doc liegt drüben bei Nellie Cashman mit einer Schußverletzung. Es ist niemand da, der auf die Gefangenen aufpaßt. Und…«
Der Texaner winkte ab und ließ sich krachend auf den Stuhl hinterm Schreibtisch fallen.
»All right, aber drehen Sie mir bloß keinen Stern an, Mr. Clum!«
Der greise Zeitungsmann blickte sich verlegen nach dem Marshal um. »Sagen Sie es ihm bitte, Wyatt.«
»Well«, meinte der Missourier. »Sie sind erst ein Sheriff, wenn Sie vereidigt sind und den Stern tragen.«
»Ich weiß, ich weiß, also schnell…«
Er liebte diese Zeremonie nicht.
Fünf Minuten später hatte das heiße Tombstone einen neuen Sheriff.
Der Riese blickte auf den Stern, den John Clum ihm an die Brust geheftet hatte, und meinte: »Wenn ihr aber glaubt, daß ich jetzt drüben in das Kabuff von Vetter Behan ziehe, dann habt ihr euch geirrt.«
»Nicht nötig, bleiben Sie nur hier«, entgegnete John Clum. »Ihr Vorgänger, der früher hier gesessen hat, würde sich bestimmt über einen solchen Nachfolger freuen…«
Der Marshal hatte sich von Luke Short verabschiedet und sattelte wenige Minuten später unten im Hof des Russian Hotels sein Pferd.
Er stand im Hof und blickte durch eine Vorhangspalte in das Zimmer des Spielers.
Doc Holliday lag mit bleichem, kantigem Gesicht auf seinem Bett.
»Fare well«, kam es tonlos über die Lippen des Marshals. Der Mann drinnen konnte es nicht hören. Und Wyatt wollte das auch gar nicht.
Er zog sich in den Sattel und ritt aus dem Hof. Als er die Stadt hinter sich hatte, preschte er in scharfem Galopp durch die mondhelle Nacht nach Süden.
Kirk McLowery, Cass Claiborne, James Curly Bill, William Hickok und Larry Lemon hatten sich nicht lange im Haus Rozy Gingers aufgehalten. Als der Marshal und Doc Holliday auf dem Weg zu der Saloonerin waren, hatten sie die Gasse verlassen, unten bei Fulham ihre Pferde geholt und die Stadt verlassen.
Kirk McLowery ritt allein voran. Schräg hinter ihm folgte Larry Lemon, denn kam Cass Claiborne, und Hickok war der vorletzte. Ein Stück hinter den anderen ritt der Schläger James Curly Bill.
Die fünf Desperados sprengten nach Süden und hielten auf die großen Kaktusfelder zu, die am Rande der Clanton-Weide lagen.
Es war schon spät in der Nacht, als sie den Ranchhof erreichten.
Schwacher Lichtschein fiel durch die beiden Fenster auf den Vorbau.
Sie machten ihre Pferde fest, und Kirk McLowery klopfte an die Tür.
»Wer ist da?« kam die heisere Stimme des Ranchers.
»McLowery.«
Ike Clanton hatte hinten in der Zimmerecke in einem verschlissenen Sessel gesessen, die Beine weit von sich gestreckt und brütend vor sich hin gestarrt, wie er es häufig tat. Mehrmals war seine alte Mutter aus der Schlafstube hereingekommen und hatte gefragt, ob er sich denn nicht hinlegen wollte. Er hatte ihr überhaupt keine Antwort gegeben.
Jetzt stand er auf und stampfte zur Tür. Er riß sie auf, zog die Brauen zusammen und blickte die Männer finster an.
»Was wollt ihr?«
»Wir haben mit dir zu reden, Ike«, entgegnete Kirk McLowery.
»Ich habe nichts mit euch zu reden. Laßt mich zufrieden!«
»Ike, du mußt uns anhören. Wyatt Earp hat Hal und Ed Flanagan eingesperrt. Auch Oswald Shibell sitzt im Jail, und Jimmy King.«
Der bärenhafte Rancher warf den Kopf herum und knurrte: »Was geht mich das an! Ich kenne die Burschen ja gar nicht. Und Jimmy King, wer ist das überhaupt?«
Kirk schluckte vor Wut. »Das spielt doch jetzt keine Rolle, ob du diesen oder jenen kennst. Wichtig ist doch nur, daß wir etwas gegen den Marshal unternehmen müssen!«
Da stieß der Rancher den Kopf vor und brüllte: »Ihr sollt mich zufrieden lassen!«
Fern im Osten kroch schon das erste silbrige Grau des Morgens über den Horizont.
Es war still auf dem Vorbau.
Der Wind, der aus der Savanne kam, trieb den Flugsand schmirgelnd an dem Holz der Giebel entlang.
Doch plötzlich horchten die Männer auf.
In der Ferne war das trommelnde Geräusch näherkommenden Hufschlags zu hören.
Ike wandte den Blick über die Köpfe der Männer.
»Verschwindet!« knurrte er.
Sie nahmen ihre Pferde, gingen um das Haus herum, und während Hickok die Zügelleinen der Tiere hielt, warteten die vier anderen an der Ecke hinter dem Vorbau.
Bald sahen sie drüben in den Kaktusfeldern die charakteristische Staubwolke aufsteigen, die rasch näher kam.
»Der hat ja einen Höllenzahn drauf«, krächzte Curly Bill.
»Maul halten!« wies ihn McLowery zurecht.
Es war Wyatt Earp, der auf den Ranchhof ritt, sein Pferd am Zügelholm zum Stehen brachte und sich aus dem Sattel schwang.
Der Rancher stand noch oben auf dem Vorbau und blickte ihm finster entgegen.
Langsam kam der Marshal die Vorbaustufen herauf.
Stumm standen die beiden Männer einander gegenüber.
Da sprangen die Lippen des einstigen Bandenführers wie Gesteinsbrocken auseinander. »Sie kommen in letzter Zeit ziemlich häufig, Wyatt. Ich habe das Gefühl, daß es Ihnen hier gefällt. Wenn Sie wollen, schlage ich Ihnen drüben im Bunkhaus ein Bett auf.«
»Sparen Sie sich Ihren Hohn, Ike«, wies ihn der Marshal ab. »Ich komme noch einmal wegen Kilby.«
Als der Reiter vor dem Querholm aus dem Sattel gerutscht war, wich Kirk McLowery unwillkürlich einen Schritt zurück und preßte sich an die Wand.
»Was ist los?« zischte Lemon, der jetzt neben ihm stand.
»Wyatt Earp!« flüsterte der Desperado ihm zu.
»Was…?«
»Los!« befahl Kirk. »Larry und James, ihr geht auf die andere Seite des Hauses. Wenn ich hier hinausgehe, kommt ihr von der anderen Seite. Mit dem Revolver, versteht sich.«
Die beiden machten sich davon.
Kirk wartete so lange, bis er davon überzeugt sein konnte, daß Lemon und James Curly Bill die andere Hausecke erreicht hatten. Dann zog er seinen Revolver, spannte ihn und trat plötzlich auf den Vorbau.
Lemon und James Curly Bill kamen von der anderen Seite.
Die vier Banditen bauten sich mit gezogenen Revolvern vor dem Marshal wie eine Mauer auf.
»Ist das eine Überraschung, Earp?« Kirk McLowerys Stimme troff vor Hohn und Spott. »Das hätten Sie sich sicher nicht träumen lassen, daß Sie uns hier zu so ungewohnter Stunde treffen.«
Der strohblonde Cass Claiborne trat ungeduldig von einem Fuß auf den anderen.
»Worauf warten wir denn?«
Curly Bill krächzte: »Ein Wort, Kirk, und ich schlage ihn zusammen wie einen Pfannkuchen.«
»Nur nicht so hastig«, entgegnete McLowery siegessicher. »Diese Minute muß ich auskosten.«
Wyatt stand auf der Vorbaukante.
Die vier Männer hielten dicht nebeneinander vor ihm.
Kirk McLowery lächelte zynisch, als er erklärte: »Auf diese Minute habe ich zwei Jahre gewartet. Besser konnten wir es nicht treffen. Jetzt steht er da, der große Earp, vor vier schnellen Revolvern. Ganz allein, ohne seinen Schatten im Rücken. Was ist das eigentlich für ein Gefühl, Earp, wenn man weiß, daß man gleich von glühendem Blei durchlöchert wird und rückwärts über eine Vorbaukante in den harten Sand der Clanton-Ranch stürzen wird?«
Ruhig und reglos stand der Missourier da.
»Dem hat es die Sprache verschlagen«, rief Cass Claiborne, während er noch ungeduldiger von einem Bein auf das andere trat. »Mach doch endlich kurzen Prozeß. Der Kerl lebt doch ohnehin schon viel zu lange! Jede Minute, die er eher tot ist, ist ein Gewinn für uns!«
»Nur keine Hast«, versetzte der Mann aus dem San Pedro Valley, (McLowery). »Ich habe dir doch gesagt, daß ich diese Minute auskosten will bis zum letzten.«
»Sie ist aber ziemlich lang, diese Minute. Ich schätze, sie ist rum!« knurrte Claiborne.
»Wann sie zu Ende ist, bestimme ich!« Kirk McLowery stand mit gespreizten Beinen da und spannte knackend den Revolverhahn. »Und ich werde es auch sein, der ihm den Fangschuß gibt.«
Deutlich sah der Marshal das gefährliche Glimmen in den Augen des Desperados.
»Los!« meldete sich Curly Bill, »das geht einem ja an die Nerven! Warum steht der Kerl noch da!«
Klick! machte es da plötzlich hinter ihnen.
Die vier Desperados wagten sich nicht umzudrehen.
»Hände hoch!« Es war die Stimme Ike Clantons. Die Stimme ihres einstigen Anführers, ihres Abgottes! Noch immer besaß sie Gewalt und Macht genug, um die Desperados im Zaum zu halten.
Keiner rührte sich.
»Hände hoch!« befahl Ike, »wird es bald!«
Langsam krochen die Arme der Tramps in die Höhe.
»Du auch, Kirk.«
Da wandte sich McLowery um.
Mit einem blitzschnellen Fußtritt hieb ihm Ike den Revolver aus der Hand.
Der Schuß löste sich, und die Kugel klatschte auf eine eiserne Krampe, quarrend und jaulend als Querschläger davonzischend.
»Was soll das, Ike«, stieß der Mann aus dem San Pedro Valley in höchster Erregung heiser hervor.
»Hier auf meinem Hof geschieht nichts, was ich nicht will, verstanden? Auch du wirst noch gehorchen lernen. So, und jetzt packt euch!«
Die vier schoben ihre Revolver in die Halfter zurück und gingen davon.
Am Ende des Vorbaus blieb einer von ihnen stehen. Kirk McLowery.
»Diese Minute kommt wieder, Earp! Verlassen Sie sich darauf. Ich werde keine Ruhe haben, bis sie wieder da ist.« Damit verließ auch er den Vorbau.
Gleich darauf sprengten die fünf aus dem Hof und preschten, eine gewaltige Staubwolke nach sich ziehend, auf die Kakteenfelder zu.
Wyatt Earp und Ike Clanton standen einander gegenüber.
Der Marshal an der Kante des Vorbaus, der Rancher in seiner Tür.
Ike hatte noch immer den Revolver in der Hand.
Im fahlen Licht des Morgens sah der Missourier, daß es die Waffe seines Bruders Billy war. Jener Colt, den er selbst drüben in Costa Rica gefunden und vor wenigen Stunden erst dem Rancher gebracht hatte.
Ike schob den Colt in den Gurt.
»Damit wir uns richtig verstehen – ich bilde mir nicht etwa ein, Sie aus einer hoffnungslosen Lage gerettet zu haben, Wyatt. Ich weiß, daß die Brüder nicht mit Ihnen fertiggeworden wären. Aber diese Idioten wußten es nicht. Und ich will keine Toten liegen haben. Auch wenn es McLowery oder Claiborne gewesen wären!«
Verwunderung stand in den Augen des Marshals.
»Sie überschätzen mich, Ike«, entgegnete er. »Ich hatte mich zwar nicht aufgegeben, aber immerhin waren es vier Mann, und einer stand drüben bei den Pferden.«
Der Rancher winkte ab und wandte sich um, in den Raum zurückgehend.
»Ich habe Sie vor zehn Mann stehen sehen. Das hat Ihnen auch nichts gemacht. Offenbar sind Sie mit dem Teufel im Bunde.«
Wyatt blickte auf den breiten Rücken des einstigen Banden-Chiefs und hatte jetzt sogar den Anflug eines Lächelns in den Augenwinkeln.
»Dann sind Sie diesmal der Teufel, Ike Clanton.«
Der wandte sich mit einem Ruck um.
»Was wollen Sie von mir, Wyatt?« fauchte er.
»Ich sagte es Ihnen ja: Ich suche Kilby.«
»Ich kenne ihn nicht, und hier ist kein Kilby.«
»Und Phin…?«
»Ist auch nicht hier!«
Wyatt tippte an den Hutrand und verließ den Vorbau.
Oben fiel die Tür des Ranchhauses krachend ins Schloß. Als der Marshal sich in den Sattel gezogen hatte, wurde sie noch einmal aufgerissen, und der Rancher stampfte auf die Treppe zu. »Hören Sie, Wyatt. Ich weiß, daß Sie eine verdammt scharfe Nase haben. Falls Sie also nicht zufällig hergekommen sind, sondern etwa wegen Kirk und den anderen – dann sind Sie wirklich umsonst gekommen, denn ich habe niemanden hierher bestellt.«
»Das hatte ich auch nicht angenommen, Ike.«
Die beiden Männer blickten einander in die Augen.
Dann nahm der Marshal die Zügelleinen hoch und ritt davon.
Mit finsterem Gesicht sah der einstige König von Arizona ihm nach, bis die Staubfontäne den Reiter vor den Kaktusfeldern verschluckte.
Wyatt war nach Süden geritten, dahin, wo er vor Tagen schon einmal gewesen war: auf die Shibell Ranch.
Aber der Weg hierher war umsonst gewesen. Die Ranch lag völlig verlassen da.
Einige Rinder schien Oswald Shibell gar nicht zu haben, offenbar hatte er seine Herde immer drüben hinter der Grenze bei den kleinen Hazienderos zusammengestohlen und hier in Arizona verkauft.
Eine Hehler-Ranch.
Wyatt wandte seinen Hengst und ritt durch das Steingeröll weiter auf die Blauen Berge zu, die sich nicht weit hinter der Ranch aus tafelglatter Ebene erhoben. Azurblauer, wolkenloser Himmel lag über dem Grenzland.
Bewußt hatte der Marshal den Weg scharf nach Süden eingeschlagen, da es nicht ausgeschlossen war, daß Kilby die nahe Grenze zu erreichen suchte. Es gab hier mehrere Pässe, die nach hartem Anstieg dann verhältnismäßig leicht zu überqueren waren. Der Missourier hatte den Fuß der Berge fast erreicht, als er aus einer Schlucht einen einzelnen Reiter auf die Ebene hinaustraben sah.
Wyatt hielt seinen Rappen an.
Der Mann, der da drüben aus den Bergen kam, war ein Indianer. Das scharfe Auge des Marshals entdeckte es sofort.
Als der Rote bis auf zweihundert Yard herangekommen war, entfuhr dem Missourier ein Ausruf der Verwunderung.
Der Reiter war ein hochgewachsener Mann mit blauschwarzem Haar, das von Silberfäden durchzogen war. Sein bronzebraunes Gesicht war edelgeschnitten und wurde von einem schwarzen funkelnden Augenpaar beherrscht.
Der ganz in dünnes Leder gekleidete Mann hatte eine wahrhaft königliche Haltung.
Und er war auch ein König. Ein Fürst seines Volkes. Sein Name war Cochise!
Der oberste Häuptling aller Apachenvölker hatte sich schon in jungen Jahren einen großen Namen in den Staaten gemacht, der ihm nicht nur die Ergebenheit fast aller Indianer gesichert, sondern auch die Achtung der Weißen eingebracht hatte. Cochise hatte wie kein anderer Indianerführer die roten Volksstämme gesammelt und in zwei historischen Begegnungen mit Abgesandten des US-Präsidenten den Frieden für sein Volk zu sichern gesucht. Daß dieser Friede nicht von ewiger Dauer war, ja, nicht einmal das Leben dieses einzigartigen Mannes überdauerte, lag – so betrüblich diese Feststellung auch ist – an den Weißen selbst. Aber Cochise hatte es nie aufgegeben, seine Friedensverhandlungen mit den Weißen fortzusetzen, obwohl er in den letzten Jahren auch von Mitgliedern seines eigenen Volkes, ja, seines Stammes stark bekämpft wurde. Berüchtigt wurde ein Mimbrenjo-Häuptling namens Geronimo, der die Abtrünnigen anführte und nichts anderes als eine Horde von Verbrechern aus ihnen machte, die das Land tyrannisierten und dem roten Volk und seinem Ansehen großen Schaden bereiteten. Er war ein ganz einmaliger Mann, dieser Häuptling Cochise, von adliger Einfachheit, wie jeder wahrhaft große Mensch. Still, zurückhaltend und doch vermochte sich niemand, der ihm einmal begegnet war, der Bannkraft seiner Persönlichkeit zu entziehen.
Nur noch fünf Yard lagen zwischen den beiden Reitern, als sie ihre Tiere anhielten.
Das Gesicht des Häuptlings war wie aus rotem Felsstein gehauen, und kein Muskel darin verriet, was die Seele dieses Mannes jetzt bewegte.
Eine volle Minute herrschte Schweigen zwischen den beiden Reitern.
Dann hob der Marshal die Hand und sagte: »Ich freue mich, Cochise zu treffen.«
Auch der Indianer hob die Hand. »Die Freude, weißer Mann, ist auch auf meiner Seite.«
Sie stiegen ab, gingen aufeinander zu und reichten sich die Hände.
Wyatt, der den Häuptling schon mehrmals auf seinen weiten Ritten getroffen hatte, berichtete dem Indianer, was ihn in die Blauen Berge führte.
Der Apache schüttelte den Kopf.
»Der weiße Mann kann sich den Weg über die Blauen Berge ersparen.«
Wyatt sah ihn verblüfft an.
Cochise fuhr fort: »Das Bleichgesicht, das der Sheriff Earp sucht, ist südwestlich, auf die Stadt zugeritten, die Nogales heißt.«
Der Missourier blickte verblüfft in das Gesicht des Indianers.
Das war doch fast unmöglich, denn er kam doch aus den Bergen, und wenn Kilby tatsächlich auf Nogales zugeritten sein sollte, dann mußte er in der Nacht schon weit von Shibells Ranch rechts abgebogen sein.
In den Augen des Indianers stand ein winziges Lächeln.
»Der weiße Mann braucht sich keine Gedanken über das zu machen, was Cochise ihm gesagt hat. Cochise hat seine Augen überall, in der Savanne und auf den Bergen.«
So war das also! Der Häuptling hatte diese Nachricht von einem Späher erhalten. Wyatt erinnerte sich daran, daß Cochise ab und zu seine Leute in die Prärie und auch in die Berge schickte, um Ausschau nach der Bande Geronimos zu halten, die immer wieder in der Savanne und bei den Städten der Weißen auftauchte.
Wenn Kilby also nach Nogales geritten war, dann hatte er jetzt einen gewaltigen Vorsprung.
Wyatt bedauerte es, daß er Cochise schon wieder verlassen mußte. Man traf so selten in diesem Lande einen Mann, bei dem es sich lohnte, zu verweilen.
Der Indianer blickte nach Norden und meinte: »Cochise hörte, daß der Sheriff Earp getötet werden sollte! Er soll in der Stadt, die die Bleichgesichter Tombstone nennen, erschossen worden sein. Cochise war deshalb auf dem Wege nach Tombstone.«
Verdutzt blickte Wyatt in die Augen des Apachen. So weit reichten also die Fühler dieses Mannes!
Cochise beschattete die Hand mit den Augen und wandte den Blick hinüber nach Nordwesten.
»Es sollen die Männer mit den grauen Gesichtern gewesen sein, wurde mir berichtet. Aber wie ich zu meiner Freude sehe, ist es ein Irrtum gewesen.«
Er hatte also auch schon von den Galgenmännern gehört!
»Ja, ich bin hinter den Männern mit den grauen Gesichtern her. Sie haben seit den Tagen der Clanton Gang die schlimmste Bande auf die Beine gebracht, die es je in Arizona gegeben hat.«
»Weiß Wyatt Earp, wer die Graugesichter anführt?«
»Nein, leider nicht.«
Da stellte der Indianer Chief die seltsame Frage: »Ist es nicht Ike Clanton?«
Wyatt zog die Schultern hoch. »Ich kann Cochise diese Frage nicht beantworten. Lange Zeit habe ich diesen Mann für den Anführer der Galgenmänner gehalten, aber dann erfaßten mich wieder Zweifel, ich habe Ike Clanton mehrmals aufgesucht und mit ihm gesprochen. Er ist undurchsichtig wie Stein, und heute im Morgengrauen hat er mir sogar das Leben gerettet.«
Der Indianer schüttelte leicht den Kopf.
»Das kann bei einem Mann wie Ike Clanton eine Schlinge sein, in der sich der Sheriff Earp verfangen soll.«
Der Missourier wußte, was der Indianer sagen wollte. Auch er hatte sich seine Gedanken über die letzte Begegnung mit dem einstigen Banden-Chief gemacht. Ike hatte ihn zwar gerettet, aber das konnte tatsächlich ein ganz raffinierter Trick sein, mit dem der Mann, der möglicherweise doch der oberste Boß der Galgenmänner war, den Marshal täuschen und ihm den Argwohn nehmen wollte. Andererseits war es schließlich nicht ausgeschlossen, daß dieser Isaac Joseph Clanton sich geändert hatte. Seit dem Tode seines Bruders Billy war ja tatsächlich irgendeine Wandlung mit ihm vorgegangen, deren Bedeutung und wirkliche Tiefe allerdings niemals auszuloten war.
Die beiden Männer standen nur noch wenige Minuten beieinander, dann bedankte sich der Marshal bei Cochise, zog sich in den Sattel, grüßte mit der Hand und sprengte mit verhängten Zügeln am Fuß der Blauen Berge entlang nach Westen davon.
Der Indianerfürst stand mit steinernem Gesicht zwei Schritte vor seinem Pferd und blickte dem Reiter nach, bis er in dem Flimmern der Savanne verschwunden war.
*
Es war Nacht, als der Reiter in Nogales eintraf. Flimmernd standen die Sterne am blauschwarzen Himmel, und der Mond warf ein fahles Licht auf die Häusergiebel.
Vorm Sheriffs Office sprang Wyatt Earp aus dem Sattel, warf seine Zügelleinen um den Querholm und betrat den Vorbau. Er klopfte an die Tür und öffnete.
Der junge Lippit hatte hinterm Schreibtisch gesessen, sprang auf und stieß verblüfft hervor: »Wyatt Earp!«
Wyatt reichte dem jungen Mann die Hand.
»Mr. Earp, Sie sind wieder in Nogales.«
»Ja, leider.«
»Was ist mit Cornelly?«
»Er ist tot.«
»Ich habe es gehört. Und der Mörder?«
»Seinetwegen bin ich hier.«
»Hier? Soll er in Nogales sein? Wissen Sie denn, wer es ist?«
»Ziemlich sicher, ein Mann namens Kilby. Kennen Sie ihn?«
»Kilby? Oben in der Newtonstreet wohnt eine Familie Kilby, aber das sind alte Leute. Und ich kann mir nicht vorstellen, daß der Alte…«
»Nein, nein, es ist ein junger Mann, höchstens vierzig.« Und dann beschrieb er Lippit den Mann, dem er gefolgt war.
Der schüttelte den Kopf. »Well, ich kenne jemanden, der so aussieht, aber er heißt nicht Kilby. Er ist Percy Farell.«
»Farell. Wo wohnt er?«
»Unten in der Lincolnstreet.«
Wyatt überlegte. »Können Sie hier weg?«
»Ja, natürlich. Ich kann überhaupt hier frei schalten und walten. Man hat mich zum Sheriff gewählt, nachdem Mr. Shibell weggeritten ist.«
»Gratuliere.« Wyatt reichte ihm die Hand.
Lippit nahm seinen Hut vom Haken und ging mit dem Marshal hinaus.
Als sie das Ende der Lincolnstreet erreicht hatten, deutete der Sheriff auf einen kleinen Bau, der etwas zurücklag und eine düstere Fassade hatte.
Wyatt hatte auf dem Weg hierher überlegt, ob es möglich wäre, daß der Mann, der sich Kilby nannte, hier als ehrbarer Bürger unter einem anderen Namen lebte. Lippit hatte ihm unterwegs berichtet, daß Farell lange Zeit für die Wells Fargo gearbeitet hatte und seit einem Jahr als Scout an der mexikanischen Grenze arbeitete, Wagenkolonnen durch die unwegsamen Berge führte und hin und wieder auch auf dem Postdepot aushelfe.
Wyatt ging allein auf das Haus zu und blickte durch eine Bretterlücke in den Hof.
Auch da war alles still.
Da betrat der Marshal den Vorbau und klopfte an die Tür.
Es dauerte sehr lange, bis er einen schlurfenden Schritt im Hausgang hörte. Ein Schlüssel wurde im Schloß umgedreht und die Tür einen Spalt breit geöffnet.
Der fahle Mondschein warf nur ein diffuses Licht auf das Gesicht der alten Frau, die den Mann mit heiserer Stimme ankrächzte: »Was wollen Sie?«
»Kann ich Mr. Farell sprechen?«
»Nein, er ist nicht daheim.«
Da kam der Sheriff über die Straße und trat an die Tür.
»Verzeihung, Mrs. Farell, können Sie uns sagen, wo wir Ihren Sohn finden?«
Die Frau hüstelte und schien zu überlegen. Schließlich sagte sie: »Ich glaube, er ist im Gold Dollar Saloon.«
Die beiden Gesetzesmänner blickten einander an, dann entschuldigten sie sich und verließen das Haus.
»Dann wollen wir in der Kneipe einmal nachsehen«, meinte Lippit.
Wyatt war nur bis an die nächste Ecke gegangen und dann stehengeblieben.
»Nein«, entgegnete er.
Lippit blickte ihn verwundert an.
»Warum nicht?«
»Weil die Frau gelogen hat.«
Lippits Augen wurden kugelrund.
»Sie glauben…«
»Ich bin fest davon überzeugt!«
»Aber warum nur? Das bedeutete ja…«
»Eben«, entgegnete der Missourier. »Wir müssen zurückgehen.«
»Was haben Sie denn vor?« fragte Lippit, als der Marshal sich schon wieder umgewandt hatte.
»Das Haus steht nicht frei. Wir sind also gezwungen, in den Hof zu steigen.«
»Und?«
»Farell ist im Haus. Es kann natürlich sein, daß er nicht Kilby ist. Aber da der Mann, den wir suchen, ein gefährlicher Verbrecher ist, können wir kein Risiko eingehen.«
Der Sheriff mußte sich gegen den Zaun stellen, und Wyatt stieg über seine zusammengelegten Hände und seine rechte Schulter über die Fenz. Federnd und mit einem leisen Geräusch langte er drüben auf dem Boden an.
Dann öffnete er vorsichtig das Tor und ließ auch Lippit in den Hof.
Offensichtlich hatte der junge Sheriff noch kein Anwesen auf diese Weise betreten.
»Wenn er nun schießt«, flüsterte er mit bebender Stimme.
»Bleiben Sie hier am Tor«, entgegnete der Marshal.
»Nein, nein, ich komme schon mit.«
»Sie sollen hier am Tor bleiben, Lippit!« gebot Wyatt. Er wußte, daß dieser Mann ihm nicht viel helfen würde. Er mußte allein handeln. Vorsichtig schlich er sich an das Haus heran, schob sich an der Fassade, die hier allerdings unglücklicherweise im hellen Mondlicht lag, vorwärts, bis er unter ein Fenster kam, das offen stand. Aber es lag zu hoch vom Boden, als daß er es im Sprung hätte erreichen können.
Er verharrte eine Weile lauschend, mußte sich dann über Lippit ärgern, der am Tor ein Geräusch verursacht hatte.
Da schlug im Nachbarhof ein Hund an.
Jaulend stand das Tier vor seiner Hütte, zerrte an der Kette und bellte ganz sicher nicht nur den bleichen Arizonamond an.
Durch dieses Geheul vermochte der Missourier nichts mehr zu hören. Dafür war jetzt ein Geräusch links neben ihm am Haus zu vernehmen. Die Hoftür wurde geöffnet. Es war die alte Frau, die herauskam und sich umsah.
Wyatt, der einen raschen Blick zum Tor hinüber geworfen hatte, mußte zu seinem Ärger feststellen, daß Lippit gegen das helle Tor deutlich zu erkennen war.
Auch die Frau hatte ihn offensichtlich erkannt. Sie wandte sich sofort um und verschwand im Haus.
Wyatt hatte gehört, daß sie die Tür nicht abgeschlossen hatte. Behutsam näherte er sich der steinernen Treppe, schlich hinauf und blieb dicht gebückt neben der Tür kauern.
Da hörte er drinnen im Flur Stimmen. Auch die Stimme eines Mannes!
Aber was gesprochen wurde, konnte er nicht verstehen.
Er wartete. Nach einer Minute wurde rechts über ihm ein Fenster hochgedrückt und ein Gewehrlauf herausgeschoben, dessen Mündung sich auf das Tor richtete.
Wyatt hatte keine Wahl, er sprang hoch, packte das Gewehr und riß die Waffe herum.
Drinnen im Raum schrie ein Mann verblüfft auf.
Wyatt setzte über die Treppe, stieß die Tür auf und stand mit gezogenem Revolver im Korridor. Im nächsten Augenblick hatte er auch die Tür zum Hofzimmer aufgestoßen.
Aber der Mann war nicht zu sehen.
Sofort wandte sich der Marshal zurück in den Flur, kauerte sich tief an den Boden und lauschte angestrengt.
Durch ein kleines Fenster der Straßentür drang ein winziger Lichtschein in den Flur.
Da war ein Geräusch dicht hinter ihm, eine Tür wurde knarrend geöffnet, und ein Mensch sprang an ihm vorbei in den Flur und hastete eine Treppe hinauf.
Wyatt folgte ihm sofort und bekam ihn zu packen.
»Jesus Maria«, gellte da die Stimme der Frau durch den Flur.
Wyatt schob den Mann vor sich her in den Flur hinunter.
»Wer sind Sie?«
»Das geht Sie nichts an, Sie verdammter Bandit! Was wollt ihr überhaupt von uns? Laßt uns ins Ruhe, wir haben kein Geld!«
»Ich will von Ihnen kein Geld, Mister. Wie ist Ihr Name?«
»Mein Name ist Farell. Was wollen Sie?«
»Sind Sie Percy Farell?«
»Nein, das ist mein Bruder.«
»Und wo kann ich ihn finden?«
»Er ist nicht da!«
Da wurde hinten die Hoftür aufgestoßen, und der Sheriff trat ein!
»Weshalb belügen Sie den Marshal, Mr. Farell? Sie haben keinen Bruder. Sie selbst sind Percy Farell.«
Der Mann riß sich los und versuchte durch die Haustür zu entkommen.
Aber Wyatt Earp hatte ihn schon am Jackenärmel gepackt und zerrte ihn herum.
»Wohin so eilig, Mr. Farell?«
Da brachte die Frau aus der Küche eine Öllampe.
Der Lichtschein geisterte über die Gesichter der Männer.
Wyatt mußte feststellen, daß Lippit recht hatte, denn Percy Farell war tatsächlich ein untersetzter kräftiger Mann von etwa vierzig Jahren, der einen gewaltigen Seehundschnauzbart trug, blondes Haar und farblose Augen hatte.
Farell starrte den Marshall kalt an und schnauzte: »Was wollen Sie von mir? Ich kenne Sie nicht!«
»Er ist Wyatt Earp«, erklärte der Sheriff. »Ich habe es Ihnen gerade schon gesagt, Mr. Farell.«
»Und wenn schon. Was geht es mich an. Er hat nicht in mein Haus einzudringen.«
»Sie scheinen ein ganz verdammt schlechtes Gewissen zu haben, Mr. Farell«, unterbrach ihn der Marshal.
»Was wollen Sie von mir?«
»Ich muß Sie bitten, mit ins Sheriffs Bureau zu kommen.«
»Ich denke nicht daran. Warum auch? Was habe ich getan? Wie kommen Sie dazu, mich zu stören? Es ist spät, und ich wollte mich gerade hinlegen.«
»Sie können sich gleich hinlegen. Es wird nicht lange dauern.«
Der Mann hatte die Fäuste geballt.
Wyatt sah, daß er keinen Waffengurt trug, rechts an der Wand hingen zwei Gewehre. Eine Winchester und ein Remington-Gewehr.
Wyatt hatte Farells Blick zu den Waffen aufgefangen.
Mit raschem Griff nahm er ein Gewehr von der Wand und hielt es ihm hin.
»Hier, nehmen Sie es mit. Sie fühlen sich ohne eine Flinte nicht wohl.«
Farell spannte seine Faust um die Waffe und hängte sie blitzschnell an die Wand zurück. Die Art, in der er das schwere Gewehr handhabte, zeigte dem Marshal, wie ungeheuer geschickt er damit umzugehen vermochte. Der Verdacht, daß er der gesuchte Mörder war, verstärkte sich in dem Missourier.
Da krächzte die Frau: »Aber, Percy, so sag dem Marshal doch, daß du nichts mit den Rindern zu tun hast! Es war doch Jussuf Kliban…«
Wyatt lauschte dem Namen nach.
Kliban? Kilby! Man konnte aus dem einen Namen sehr leicht den anderen machen. Und jemand, der Grund hatte, sich zu verbergen, aber nicht viel Phantasie besaß, konnte sehr rasch auf den Gedanken kommen, den Namen Kliban in Kilby umzuwandeln.
»Was ist mit diesem Kliban, Mrs. Farell?«
»Er ist es gewesen, der auf den Gedanken gekommen ist mit dem Postsack…«
»Eben«, sagte Wyatt rasch, eine neue Geschichte witternd.
»Kommen Sie mit, Farell. Und Sie auch, Madam.«
»Warum meine Frau?« krächzte Farell heiser.
»Weil ich auch sie verhören muß.«
»Sie können ja hier mit ihr sprechen.«
»Nein, sie kommt mit!«
Da meinte Lippit einlenken zu müssen: »Die Frau können wir doch auch hier verhören, Mr. Earp.«
»Es tut mir leid, Mr. Lippit, daß ich Sie darauf aufmerksam machen muß, daß die Frau, wenn wir uns entfernt haben, irgend jemanden warnen kann, den wir nicht gern gewarnt wissen wollen. Also, Sie kommen beide mit.«
Mürrisch folgten beide dieser Aufforderung.
Im Sheriffs Office standen sie verstockt vor dem Schreibtisch und starrten den Missourier böse an.
»Well«, erklärte Farell. »Ich werde Ihnen die Geschichte also beichten. Meine Idee war es nicht – Jussuf ist darauf gekommen. Wir verdienten ja nichts, beide nicht. Er nicht und ich auch nicht. Und die großen Gelder stecken die Bosse ein.«
»Machen Sie es kurz«, unterbrach ihn der Marshal.
»Ja, ja. Wir haben dann eben einen der Säcke beiseite geschafft. Aber es war nichts darin, was wir hätten brauchen können. Nur Post. Und jetzt steht der Sack da, und wir können ihn nicht zurückbringen, da der Boß ja immer die Säcke zählt.«
»Und weiter?«
»Was weiter?« meinte der Mann und blickte den Missourier verstört an. »Nichts weiter.«
»Wo waren Sie heute nachmittag?«
»Heute nachmittag? Im Office der Wells Fargo.«
»Das werde ich feststellen. So lange bleiben Sie hier. Und Ihre Frau muß auch hierbleiben.«
»Aber was hat meine Frau mit der Geschichte zu tun? Lassen Sie sie doch da heraus, Marshal!«
»Sie bleiben beide hier!«
Wyatt suchte das Büro der Wells Fargo auf und kam nach zehn Minuten mit dem Posthalter zurück, der nicht wenig überrascht war, einen seiner Leute hier vorzufinden.
»Sie haben gelogen!« wandte sich der Marshal sofort an den Scout. »Sie sind heute nicht im Office gewesen.«
»Well, wenn Sie es schon wissen, ich bin nicht da gewesen, gut. Na und?«
»Wo sind Sie gewesen?«
»Drüben.«
»Wo drüben?«
»Hinter der Grenze…«
»Reden Sie endlich deutlich, Farell. Wir haben keine Zeit!«
Der Postmaster erklärte: »Er ist seit ein paar Tagen unterwegs. Ich weiß nicht, in welchen Geschäften, aber nicht für die Wells Fargo.«
»Haben Sie irgend jemanden, der beweisen kann, daß Sie in Mexiko waren?« fragte der Marshal.
Farell schüttelte den Kopf.
»Das ist schlecht für Sie, Farell.«
Da stieß die Frau ihren Mann an.
»So sagt ihm doch endlich alles!«
»Ich halte es auch für besser«, setzte der Marshal hinzu.
»Well, also, ich war drüben in Mexiko. Wir haben…, wir wollten Rinder holen.«
»Und…?«
»Es ist uns einer dazwischengekommen.«
»Können Sie einen Zeugen beibringen, daß Sie in Mexiko waren?«
»Ja, natürlich. Jussuf.«
»Wo ist er?«
»Na, drüben.«
»Das ist kein Zeuge für mich. Einen anderen Zeugen haben Sie nicht?«
»Doch!« rief Farell plötzlich.
»Phin! Phineas Clanton.«
Der Marshal schluckte vor Verblüffung.
»Phin Clanton? Ihn wollen Sie als Zeugen angeben?« Mißtrauen stand in seinem Gesicht. »Wo soll er Sie gesehen haben?«
»Drüben.«
»Wo?«
»Drüben – in Martini.«
»Das ist ein kleines Nest, etwa fünfundzwanzig Meilen von hier«, erklärte Lippit.
Der Postmaster blickte Farell fragend an.
»Sie haben also den Postsack weggenommen?«
»Well, es ist klar, daß ich Klage gegen Sie und Jussuf erheben werde. Und den Job bei uns sind Sie natürlich los!«
Da geschah es.
Farell hechtete zum Gewehrständer, riß eine Remingtonbüchse heraus und stürmte durch die Hintertür, ehe ihn jemand daran hindern konnte.
Wyatt, der vorn neben dem Eingang gestanden hatte, erreichte die Tür erst, als draußen im Hof der Schuß krachte.
Die Frau im Office schrie gellend auf.
Als Wyatt den Mann im Hof erreichte, war er schon tot. Er hatte sich selbst gerichtet.
Betroffen standen die drei Männer um ihn herum.
Die Frau verharrte oben wie gelähmt in der Hoftür.
»Er ist tot, Mrs. Farell«, sagte der Marshal dumpf.
Die Frau brach zusammen.
Bedrückt von diesem fürchterlichen Ereignis stand der Marshal eine halbe Stunde später im Office vor Lippit und überlegte.
War der Tote wirklich der Mörder Kilby? Es sprach vieles dafür. Vor allem die Tatsache, daß er sich selbst das Leben genommen hatte. Und nicht zuletzt auch die Fertigkeit, mit der er mit dem Gewehr umzugehen verstand. Es war gar nicht so sehr leicht, sich mit einer Remingtonbüchse in dieser Geschwindigkeit selbst einen Schuß beizubringen.
War damit die Suche nach dem Mörder von Sheriff Cornelly zu Ende?
War der tote Scout Percy Farell wirklich der gesuchte Kilby?
Der Marshal mußte sich eingestehen, daß er nicht fest davon überzeugt war. Percy Farell konnte ein gewöhnlicher Bandit gewesen sein, der sich das Leben genommen hatte, nachdem er sich einiger schwerer Vergehen überführt sah. Er hatte immerhin einen Postsack gestohlen, worauf schon mehrere Jahre Straflager standen, und dann war bei dieser Gelegenheit auch herausgekommen, daß er drüben jenseits der Grenze, mit Viehdiebstählen zu tun gehabt hatte. Was Wyatt an der Sache besonders interessierte, war die Erwähnung von Phin Clanton.
Sollte der berüchtigte Phin also doch nicht auf die Ranch seines Bruders geritten sein? Sollte er nach seinem heimtückischen Auftritt hier in Nogales vor wenigen Tagen nicht hinauf nach Tombstone, sondern hinüber nach Mexiko geritten sein?
Dieser Phineas Clanton spielte seine geheimnisvolle Rolle weiter. Was hatte er mit den Galgenmännern zu tun? Daß er in irgendeiner Verbindung mit ihnen stand, schien dem Marshal festzustehen. Hatte er auch etwas mit dem Mord an Sheriff Cornelly zu tun? Wenn der Mann, der jetzt drüben im Totenhaus lag, wirklich der Mörder Kilby war, dann hatte er Phin gekannt! Wieder galt es, Phin zu suchen.
Zwar war der Marshal davon überzeugt, daß auch damit keineswegs alle Rätsel gelöst waren, denn der gerissene Phin würde sich schon aus der Affäre zu ziehen wissen, und so wie früher würde er auch jetzt wahrscheinlich nachweisen können, daß er direkt mit diesen Dingen nichts zu tun hatte. Dennoch war und blieb er eine unselige Schlüsselfigur in allen diesen Geschehnissen.
Als der Marshal vorhin mit dem Sheriff das Totenhaus verlassen hatte, geschah es in dem unguten Bewußtsein, daß der Mann, der da lag, wohl ein Verbrecher, aber nicht mit Sicherheit ein Mörder gewesen war. Well, Percy Farell hatte sich selbst gerichtet. Wahrscheinlich hatte er dazu Grund genug gehabt.
Aber er nahm ein Geheimnis mit in sein Grab – wenn er nämlich nicht der Mörder Kilby war – wer war es dann?
»Ich komme morgen früh noch einmal herein«, sagte der Marshal, und Lippit nickte betreten.
Wyatt trat auf die Straße hinaus und beschloß, noch einen Blick in den Gold Dollar Saloon zu werfen.
Als er die Straße hinunterging, sah er im Haus der Wäscherin Morrison noch Licht. Er klopfte an die Tür, und die junge Judy Morrison, die er vor kurzem aus der Hand der Banditen befreit hatte, öffnete und wich verblüfft zurück, als sie den Missourier erkannte.
»Mr. Earp!« rief sie erfreut. »Das ist ja eine große Überraschung! Kommen Sie bitte herein. – Mutter, Mr. Earp ist da!«
Judy führte den Marshal in die Stube, in der die alte Wäscherin über einer Näharbeit saß. Auch sie begrüßte Wyatt mit großer Herzlichkeit.
Als der Missourier berichtet hatte, aus welchem Anlaß er wieder in die Stadt gekommen war, meinte die Wäscherin: »Daß Percy Farell ein Bandit war, war in der Stadt gar nicht so unbekannt. Schließlich hat er mehrere Jahre wegen Bandenüberfällen unten in Fort Worth gesessen. Aber, da Sie von einem Mann namens Kilby sprechen – ich habe vor etwa acht oder zehn Tagen Wäsche für einen Mann namens Kilby gewaschen. Mehrere Hemden…«
»Haben Sie den Mann gesehen?«
»Ja, als ich die Wäsche ablieferte.«
»Wo wohnt er?«
»Im Gold Dollar Saloon.«
Und nun erklärte die Frau, daß sie diesen Kilby nicht deutlich gesehen habe, da es Abend gewesen sei und sie ihm die Wäsche an der dunklen Zimmertür im Obergeschoß des Gold Dollar abgeliefert hatte. Aber sie konnte doch sagen, daß es ein mittelgroßer Mann war, der breite Schultern hatte und ganz sicher auch einen Schnurrbart trug.
Das war eine heiße Spur!
Zehn Minuten später betrat der Missourier den Gold Dollar Saloon. Als er die Pendeltür auseinandergestoßen hatte, drehte sich einer der Männer, die an der Theke standen, um.
Wyatt blieb wie versteinert stehen.
Der Mann drüben an der Theke war groß, kräftig gebaut, hatte einen vierkantigen Schädel, ein etwas schwammiges Gesicht und gelbliche Augen. Sein Haar war dunkelbraun. Er trug einen hellen Hut, eine helle Jacke und sandfarbene Hosen. Über beiden Oberschenkeln hingen zwei schwere Hampton-Revolver.
Ein Mann, der auf den ersten Blick völlig unbedeutend wirkte – der es aber ganz und gar nicht war.
Phineas Clanton.
Beide, der Marshal und auch der Desperado, starrten einander verblüfft in die Augen.
Die Leute in der Schenke wurden aufmerksam. Rechts und links von Phin wichen die Männer langsam zurück, so daß zwischen den beiden eine freie Gasse von etwa sieben Yard Länge und vier Yard Breite entstand.
Nur der Keeper blieb hinter der Theke stehen. Er war ein Mann von vielleicht fünfzig Jahren, mit haarlosem, verformtem Schädel und einem Gesicht, dessen Schnitt deutlich den Kreolen verriet. Der Keeper Harry Madock!
Phins linke Hand lag noch auf der Theke, um sein Glas gespannt, und die rechte hing neben seinem Oberschenkel. In seinen Augen stand ein gefährliches Glimmen.
»Wyatt Earp! Sieh an. Das ist ja ein unerwarteter Besuch!« Der Hohn in der Stimme des Desperados war unüberhörbar. »Hallo, Wyatt!«
»Hallo, Phin«, entgegnete der Marshal kühl. »Ich habe Ihnen einen Gruß auszurichten.«
»Interessant. Von wem?«
»Von Ihrem Freund Percy Farell.«
Phin ließ das Glas los und stieß sich einen Schritt von der Thekenkante ab.
»Was habe ich mit Farell zu tun?«
»Ich hoffe nichts, Phin.«
»Was ist mit ihm?«
»Er hat mir einiges erzählt.«
»Erzählt?« Der gefährliche Phineas Clanton warf den Kopf in den Nacken und lachte blechern. »Hören Sie, Marshal, mit dem Burschen können Sie mich nicht schrecken. Ich habe nichts mit ihm zu tun. Und auch nichts mit den Dingen, mit denen er sich beschäftigt. Was wollen Sie von mir?«
»Ich sagte schon, daß ich Ihnen einen Gruß von Percy Farell bestellen will.«
Da schob der Bandit sein schweres Kinn vor und fauchte: »Lassen Sie mich in Ruhe, Earp! Ich habe nichts mit ihm zu tun!«
»Ich wollte Ihnen auch einen Gruß von Jeff Cornelly bestellen!« schoß ihm der Marshal mit eisiger Ruhe zu.
Phins Gesicht wurde hart wie Felsstein.
»Was geht mich dieser Bursche an?«
»Er ist tot, Phin.«
»Ich habe es gehört.«
»Ich bin hinter seinem Mörder her.«
»Was kümmert mich das? Ich habe K… Ich habe nichts mit ihm zu schaffen.«
»Sie können seinen Namen ruhig aussprechen, Phin. Es ist Kilby.«
»Ja, ich dachte es mir schon, Jackson Kilby. Wer denn sonst?«
Fassungslos blickte der Marshal ihn an. Dann machte er einige Schritte vorwärts.
Phin stieß die Faust auf den rechten Revolverkolben.
Wyatt war nur noch drei Schritte von ihm entfernt und blieb jetzt stehen.
»Nehmen Sie die Hand von der Waffe, Phin.«
»Bleiben Sie mir vom Leib, Earp.«
Der Marshal senkte seinen Blick bleiern in die Augen des Desperados.
»Wo ist Jackson Kilby?«
»Ich weiß es nicht. Was habe ich damit zu tun?«
»Phin, Sie wissen, daß er ein Mörder ist!«
»Ich vermute es, ich weiß es aber nicht. Das ist der Unterschied.«
»Die Vermutung genügt mir. Ich habe lange gebraucht, bis ich das herausgefunden habe. Sie wußten, wer der Mörder ist, woher wußten Sie es?«
»Ach, lassen Sie mich in Ruhe.« Phin nahm sein Glas, trank einen Schluck und setzte es so hart ab, daß es zersprang und wandte sich wieder Earp zu.
»Ich will es Ihnen sagen. Kilby und Cornelly waren seit langem verfeindet. Das weiß doch jeder hier.«
»Jeder? Kilby ist in der Stadt doch gar nicht bekannt.«
»In der Stadt? Wer spricht von der Stadt? Hier an der Grenze wissen es die Leute schon.«
»Wo ist Kilby?«
»Ich weiß es nicht. Habe ich etwa auf ihn aufzupassen. Bin ich sein Hüter?«
»Nein, Phin, natürlich nicht. Diesen Satz habe ich schon irgendwo in der Bibel gelesen.«
»Ja, ich weiß. Bei Kain und Abel, nicht wahr?« Drohend richtete sich der Desperado auf. Er legte den Kopf schief und stieß aus verzerrtem Mund hervor: »Aber ich bin nicht Kain, Marshal, lassen Sie sich das gesagt sein. Ich habe mit diesen Leuten nichts zu schaffen.«
»Hören Sie, Phin, ich muß Kilby finden.«
»Suchen Sie ihn doch.«
»Ich bin dabei.«
»Dann lassen Sie mich zufrieden. Ich habe nichts mit ihm zu tun. Vielleicht ist er in den Blauen Bergen oder drüben in Mexiko?«
»Nein, in den Bergen ist er nicht und in Mexiko kann er noch nicht sein. Er ist in Nogales!«
»So, vielleicht. Ich weiß es nicht.«
»Noch etwas, Phin. Der Bursche, den Sie in dieser schiefen Sache gegen den Mayor benutzt haben, sitzt drüben im Tombstone Jail.«
Phins Augen wurden schmal wie Schießscharten.
»Jimmy King? Ja, das ist ein Ding! Übrigens habe ich mich mit dem Mayor längst vertragen. Sie können ihn ja fragen.«
»Das werde ich. Wenn er keine Klage gegen Sie erhebt, soll es mir einerlei sein.«
Wieder war es einen Augenblick still im Schankraum des Gold Dollar Saloon. Und die nächsten Worte, die der Marshal Earp sprach, fielen wie Gongschläge in die Stille hinein.
»Ich bin dem Boß der Galgenmänner auf der Spur, Phin Clanton.«
In dem Gesicht des Outlaws blitzte es für den Bruchteil einer Sekunde auf. Dann entgegnete er unendlich verächtlich: »Dann sehen Sie zu, daß Sie auf seiner Spur bleiben, Wyatt. Man rutscht so leicht davon ab.«
Zu lange hatte Wyatt diesen Mann gesucht. Er würde ihn jetzt nicht so leicht loslassen, obgleich er überzeugt war, daß es schwer sein würde, diesem Banditen etwas nachzuweisen.
»Kommen Sie mit, Phin!« sagte er jetzt mit scharfer Stimme.
Phin senkte den Kopf und stieß ihn dann vor wie ein Raubvogel.
»Mit? Wohin?«
»Zum Mayor.«
Zu Wyatts Verwunderung entgegnete der Outlaw plötzlich feixend: »All right, weshalb nicht? Das können wir machen.«
Er ging mit dem Marshal hinaus und trottete neben ihm her zum Haus des Mayors.
Der Bürgermeister hatte sich noch nicht zur Ruhe gelegt. Als er sah, wer da vor seiner Haustür stand, drückte sich in seinem Gesicht offene Bestürzung aus.
»Mayor, der Mann behauptet, sich mit Ihnen über die mulmige Geschichte neulich verständigt zu haben.«
»Verständigt?« entgegnete der Mayor. »Das ist wohl nicht das richtige Wort. Aber wir haben darüber gesprochen. Er bat mich um Verzeihung. Und, well…, ich habe ihm vergeben. Es wäre ja sinnlos, wenn ich es ihm nachtrüge…«
Wyatt starrte den Mayor entgeistert an. Da wollte dieser Mann eine solche Kränkung, eine Verleumdung, die ihn ohne Hilfe des Marshals todsicher ins Straflager gebracht hätte, vergeben.
»Sie sind ein Feigling!« entfuhr es Wyatt.
Der Mayor wich zurück. »Mr. Earp, ich muß doch sehr bitten…«
»Ein Feigling sind Sie. Sie haben Angst vor ihm. Das ist alles!«
Phin lachte blechern auf. »Na, was habe ich Ihnen gesagt, Earp. Dabei kommt nichts raus. Also…«
Wyatt wandte sich ab und verließ das Haus grußlos.
Phin folgte ihm mit raschen Schritten.
»Gehen Sie doch langsamer, Wyatt! – Ich verstehe Sie nicht. Sie verplempern hier Ihr Leben.«
»Lassen Sie mich in Ruhe!« Der Marshal blickte geradeaus.
Da tippte Phin ihn an.
»Wissen Sie, Wyatt, es ist direkt schade um Sie! Sie sind ein prächtiger Bursche. Mein Bruder Ike hat es immer gesagt. Es gibt keinen Mann hier weit und breit wie Wyatt Earp! Aber Sie stehen auf der falschen Seite!«
Da blieb der Marshal stehen. Er war einen halben Kopf größer als Phin, dennoch brachte er jetzt sein Gesicht nahe vor das des Banditen.
»Ich stehe auf der richtigen Seite, Phin, und zwar auf der Seite des Gesetzes.«
Der Bandit wandte sich ab und ging weiter.
»Auf der Seite des Gesetzes, lächerlich! Gesetz! Ein albernes Gesetz, Wyatt? Nichts, Plagerei, Schießerei, Ärger, Kampf, das ist Ihr Leben. Und der Lohn? Eine lächerliche Abfindung von hundert Dollar im Monat.«
Das Lachen des Outlaws dröhnte durch die Straße.
»Lassen Sie mich zufrieden, Phin. Und das kann ich Ihnen sagen: ich bekomme es raus, ob Sie etwas mit dieser Bande zu tun haben. Und wenn – dann sind Sie geliefert. Das verspreche ich Ihnen.«
»Hahaha«, lachte ihm der Bandit dröhnend entgegen. »Ich sage Ihnen, Sie laufen im Kreis herum, Wyatt. Immer im Kreis herum. Und Sie werden doch nichts erreichen.«
Inzwischen hatten sie den Gold Dollar Saloon erreicht.
Wyatt ging weiter.
Phin trat auf den Vorbau und rief dem Marshal nach: »Und einen schönen Gruß von mir an den Big Boß der Galgenmänner, wenn Sie ihn treffen! Hahahahaha!«
Der Missourier hatte die dröhnende, scheppernde Lache des Desperados noch in den Ohren und war höchstens zehn Schritte weitergegangen, als plötzlich ein Gewehrschuß über die Straße heulte und ihn wie ein Keulenschlag hinten gegen den Schädel traf.
Er fiel vornüber in den Staub der Straße und blieb lang ausgestreckt am Boden liegen.
Phin, der gerade zwei Schritte in die Schenke gemacht hatte, blieb stehen, wandte sich um, kam auf den Vorbau, rannte mit zwei Sätzen auf die Straße, blieb vor dem Körper des Niedergestreckten stehen und starrte fassungslos auf ihn nieder.
»Damned«, entfuhr es ihm. »Das ist doch…«
Dann kniete er nieder und drehte den Marshal auf den Rücken.
»Wyatt!« Er stieß ihn an. »Wyatt! He, was ist los?« Entsetzt starrte er auf das Gesicht, das im fahlen Mondschein wie das Antlitz eines Toten aussah.
Der Desperado hatte ein Frösteln zu überwinden und wußte nicht, wie lange er neben dem Mann am Boden gekniet hatte, als plötzlich ein Gedanke durch seinen Kopf zuckte:
Ich muß sofort verschwinden! Sofort! Dann vernahm er vor sich ein Geräusch und hob den Kopf. Unter dem Hutrand hinweg gewahrte er hinter dem Kopf des Marshals ein Stiefelpaar!
Ein unheimliches Gefühl beschlich ihn. Wie eine Eishand griff es nach seinem Herzen.
Er wußte, wer da stand, noch ehe er den Blick erhoben hatte. Ganz langsam sah er an dem Mann hinauf. Dann blieben seine Augen auf dessen steinernem Gesicht haften.
»Ike!« Heiser brach es aus Phins Lippen hervor, ein Ton, wie aus einer Tierkehle.
Ja, der Mann, der da hinter dem Niedergeschossenen stand, war niemand anderes als Isaac Joseph Clanton, Phins älterer Bruder. Und immer noch der gefürchtetste Mann in ganz Arizona.
Der Mondschein warf eine geisterhafte Blässe auf sein kantiges Gesicht. Beide Fäuste hatte er geballt. »Phin«, preßte er leise und bebend durch die Zähne. Und dann brüllte er: »Phin!« Seine Linke zuckte blitzartig nach vorn, packte den Bruder, zerrte ihn herum und schleuderte ihn mit Urgewalt zu Boden.
Mit gespreizten Beinen stand Ike Clanton da, den Kopf zur Seite gelegt, beide Fäuste zum Schlage geballt.
»Steh auf!«
Phin lag am Boden, auf die Ellbogen gestützt. Hastig robbte er ein Stück zurück.
»Aufstehen sollst du!« schrie ihm Ike entgegen.
Phin stützte sich auf die Arme und richtete sich auf.
Wie zwei Tiere standen die beiden Clantonbrüder einander gegenüber. Es war eine Szene von höchster dramatischer Spannung. Drüben auf dem Vorbau des Gold Dollar Saloons standen mehrere Männer, die Ike jetzt erkannt hatten und gebannt auf die Szene starrten.
Phin zitterte am ganzen Leib.
»Ike.« Er streckte die linke Hand vor und öffnete sie. »Ike, ich muß dir das erklären. Du irrst dich, Ike…«
Da machte der Rancher einen schnellen Schritt vorwärts.
Phin wich zwei Schritte zurück. »Ike, ich bitte dich, du mußt mich anhören!«
»Was gibt es da noch anzuhören«, preßte der Rancher wild durch die Zähne.
»Ike, ich war es nicht!«
Viel schneller als man es dem wuchtigen vierkantigen Rancher zugetraut hätte, war er bei Phin, packte ihn und schleuderte ihn so derb zurück, daß er gegen den Vorbau prallte und das Holz im Gefüge ächzte.
»Ike!« Phin hatte sich gegen die Planken gestemmt und schrie den Namen des Bruders in die Nacht.
Der stand vor ihm wie ein Rachegott.
»Du hast ihn niedergeschossen! Du erbärmlicher Strolch!«
»Ike, ich war es nicht! Ich schwöre dir!«
»Wo ist das Gewehr?«
»Ich habe kein Gewehr!« beteuerte Phin.
»Es war ein Gewehrschuß!«
Da machte Phin einen Schritt vorwärts. »Ike, ich habe kein Gewehr, ich kann es dir beschwören. Die Leute da, frag sie doch. Ich war doch eben noch in der Kneipe. Sie müssen mich gesehen haben. Ich habe kein Gewehr! Meine Winchester hängt daheim an der Flurwand neben deiner Büchse.«
Ganz langsam wandte sich Isaac Joseph Clanton um und blickte auf den immer noch reglos am Boden liegenden Marshal nieder. Wie ein Gigant stand er auf der nächtlichen Straße, der Rebell aus Tombstone. Das Mondlicht beleuchtete die makabre Szene auf eine gespenstische Weise.
Es war sehr still auf der Mainstreet von Nogales geworden.
Endlich öffnete Ike Clanton die Lippen.
»Er ist tot.« Er hatte es leise gesagt, und doch drang es den Männern oben auf dem Vorbau ins Mark.
Phin, der einige Schritte hinter dem Bruder stand, wagte kein Wort mehr zu sagen.
Plötzlich spreizte Ike die Beine, ballte die Fäuste und schrie in die Nacht hinein: »Phin, wer hat das getan?«
Das Echo brach sich an den kahlen Häuserfronten.
Ike wirbelte herum, hatte die linke Schulter seltsam verkrampft hoch unter das Ohr gezogen und starrte den Bruder an.
»Ich will wissen, wer ihn niedergeschossen hat, Phin!«
Der wich zurück zur Vorbautreppe und versuchte, in die Nähe der anderen Männer zu kommen. Aber unter denen gab es niemanden, der dem dynamischen Mann da unten auf der Straße hätte trotzen wollen.
Phin stolperte gegen die unterste Vorbaustufe, fing sich wieder, breitete beide Hände aus und beschwor den Bruder: »Ike, ich weiß es nicht. Ich schwöre es dir, ich weiß es nicht. Ich bin mit ihm drüben beim Mayor gewesen. Wir kamen zurück, ich ging in den Saloon – und dann fiel der Schuß.«
»Du mußt es doch wissen, wer geschossen hat, Mensch!«
»Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht!«
Da setzte sich Ike in Bewegung. Er kam so schnell heran, daß Phin nicht mehr ausweichen konnte, blieb vor dem Bruder stehen, packte mit seinen gewaltigen behaarten Fäusten dessen Oberarme und sagte: »Phin, er ist nicht irgendwer! Er ist Wyatt Earp! Verstehst du, er ist Wyatt Earp. Und als er getötet wurde, war ein Clanton bei ihm! Sagt dir das nichts! Beide Clantons sogar, du und ich! Und ich will nicht dabeigewesen sein. Hinter ihm steht nicht nur ein Mann, nicht nur Doc Holliday. Und auch nicht nur Luke Short. Hinter ihm steht das Gesetz. Wann wirst du das endlich einmal begreifen!« Nach diesem Ausbruch herrschte Totenstille auf der Mainstreet von Nogales.
Ike hatte den Niedergeschossenen eine Weile beobachtet, lief jetzt mit großen, weiten Schritten auf ihn zu, kniete neben ihm nieder, legte die Linke unter seinen Kopf und hob ihn an.
Jäh zuckte er zusammen. »Er ist noch nicht tot. Phin! Los, komm her!«
Er faßte den Marshal unter den Armen, und Phin mußte ihn an den Füßen nehmen.
Ike warf den Kopf herum und blickte zu den Männern auf den Vorbau hinauf.
»Was steht ihr da herum, ihr Tränentiere! Los, packt an! Einer läuft zum Doc.«
Drei Männer kamen heran, und einer rannte los, blieb dann aber stehen und fragte: »Zu welchem Doc?«
»Das ist mir doch egal! Zu irgendeinem! Bin ich hier zu Hause oder ihr? Los, Mensch, hau ab!«
»Well, ich laufe zu Dr. Cochran.«
»Wo wohnt der?«
»Nicht weit vom Sheriffs Office. Baxter weiß es!«
»Vorwärts!« rief Ike ihm nach.
Sie schleppten den schweren Körper des Marshals die nächtliche Straße hinunter auf das Haus des Wundarztes Jeremias Cochran zu.
Cochran war ein verhältnismäßig junger Mann, der noch nicht lange in der Stadt lebte, ein blaßgesichtiger schlanker Mensch, hochgewachsen, mit einer Nickelbrille auf der Nase. Er hatte auch noch nicht geschlafen, als der Peon Andrew Harrington ihn aufschreckte.
»Wyatt Earp ist niedergeschossen worden, Doc!«
»Wer?«
»Wyatt Earp!«
»Der Marshal Earp? Ja, ist er denn in der Stadt?«
»Ja, er ist niedergeschossen worden. Ike Clanton ist auch hier!«
»Ike Clanton…?« stotterte der Arzt und griff sich an die Kehle. »Um Gottes willen!«
Düstere Visionen an den O.K.-Corral tauchten in seinem Gedächtnis auf, hervorgerufen durch den Namen Wyatt Earp und Clanton.
Da hörte er draußen schon die Schritte der Männer. Und als die beiden Clantons ihm den Marshal ins Haus trugen, ging er zitternd neben ihnen her.
»Da drüben auf den Behandlungstisch.«
Die vier Männer waren dem Transport gefolgt.
Der Arzt beugte sich über den Kopf des Missouriers.
Da wandte sich Ike um und blickte die Männer an. »Raus! Was wollt ihr hier? Verschwindet!«
Phin blieb an der Tür stehen.
Als Ike sich umdrehte, wollte auch er sich entfernen. Ohne sich wieder umzuwenden und den Blick von dem Marshal zu nehmen, zischte Ike: »Du bleibst hier!«
Phin nickte nur.
Der Arzt tastete den Körper des Marshals ab.
Während Ike den schwarzen Hut Wyatts auf einen Stuhl legte und nicht einen Blick von seinem Gesicht nahm, tastete der Arzt den Körper des leblosen Mannes ab.
Ike stieß ihn an.
Der Arzt fuhr zurück und starrte erschrocken in die Augen des ehemaligen Bandenführers.
»Ist er tot?« krächzte Ike.
Der Arzt zog die Schultern hoch. »Ich weiß es nicht.« Er beugte sich über ihn, horchte hinab und schüttelte den Kopf. »Nein – tot ist er nicht. Aber…«
»Was aber? So untersuchen Sie ihn doch schon.«
Der Arzt wandte den Kopf. »Ist er wirklich Wyatt Earp?«
»Ja!« herrschte ihn der Rancher an. »Jetzt sehen Sie zu, daß Sie ihn zusammenflicken. Ich bezahle alles.«
Der Arzt starrte auf den Missourier. Leise kam es über seine Lippen: »Er ist also wirklich der berühmte Wyatt Earp!«
Da stieß Ike ihn grob an. »Ja, er ist der berühmte Wyatt Earp. Sie können sich darauf verlassen, Doktor. Ich bürge dafür. Er ist ein Bekannter von mir.«
Mit einem Ruck flog der Kopf des Arztes herum. »Und Sie sind tatsächlich Ike Clanton?«
»Ja. Manchmal kommt es mir zwar selbst so vor, als wenn es nicht so wäre, aber es ist so!« Er deutete mit dem linken Daumen über die Schulter. »Und der Bursche da hinter mir, dieser Trottel, das ist mein Bruder Phin. Jetzt fehlt uns nur noch der Kerl, der den Marshal niedergeknallt hat. Dann sind wir alle beieinander.«
Der Arzt war zusammengezuckt, fröstelte unter dem Klang dieser Stimme und beugte sich wieder über den Marshal. Er hatte dessen Weste geöffnet und das Hemd und drehte ihn jetzt behutsam auf die Seite. Aber die Suche nach der Schußwunde war vergeblich.
»Mensch, was suchen Sie denn da herum?« fuhr der Rancher ihn an. »Sind Sie nun ein Doktor oder ein Kesselflicker, Mann? So finden Sie schon endlich den Einschuß!«
Der Arzt hob verzweifelt die Hände. »Ich kann ihn nicht finden, Mr. Clanton!«
Da schob ihn Ike grob zur Seite und winkte seinem Bruder.
»Los, faß an!«
Sie richteten den Besinnungslosen in sitzende Stellung auf. Ike knöpfte ihm das Hemd auf und starrte dann verwundert auf den muskulösen Körper des Marshals, der tatsächlich nirgends eine Verletzung aufwies.
Sie legten ihn wieder nieder. Und Ike wandte sich nach dem Arzt um: »So reden Sie schon, Mann! Was hat er? Hat er vielleicht einen Herzschlag bekommen?« zischte Ike heiser.
Der Arzt schüttelte den Kopf. »Nein, er hat keinen Herzschlag bekommen.«
»Das wissen Sie genau?«
»Ganz genau.«
»Mensch, er muß doch irgend etwas haben. Er schläft doch nicht!«
Wieder tastete der Arzt den Körper des Marshals ab. Als er an den Hinterkopf kam, hielt er plötzlich inne.
»Hier ist eine Beule!«
»Eine Beule am Hinterkopf? Was soll denn das, er ist doch aufs Gesicht gefallen. – Augenblick mal.«
Ike wandte sich um, griff nach dem schwarzen Hut des Marshals, öffnete das Schweißband, nahm hinten eine leicht gebogene Metallplatte heraus und warf sie auf den Tisch.
»Ich hätte eher dran denken sollen«, sagte er leise vor sich hin. Und dann fauchte er Phin an: »Da hast du noch einmal Schwein gehabt. Los, komm mit raus!«
Als die beiden Brüder draußen im Korridor standen, der nur von einer kleinen an der Wand hängenden Kerosinlampe beleuchtet wurde, zog Ike einen Revolver hervor und hielt ihn Phin hin.
»Kennst du das?« fragte er leise.
Phin starrte auf die Waffe.
»Ja, das ist doch Bills Revolver!«
»Richtig, wo habe ich den wohl her?«
»Ich… weiß es nicht…«, stotterte Phin.
Klatsch! brannte die schwere Hand des Ranchers in seinem Gesicht.
»Ike, das kannst du doch nicht machen! Was fällt dir denn ein!« brüllte Phin.
Klatsch! Eine neue Ohrfeige wirbelte Phin um die eigene Achse.
»Ich werde dir sagen, wo ich ihn her habe: Ich habe ihn von Wyatt Earp!« brüllte Ike.
»Was?« krächzte Phin fassungslos. »Das ist doch ausgeschlossen.«
»Er hat ihn dem Kerl abgenommen, an den du ihn im Spiel verloren hast, du verdammter Halunke!«
Klatsch! Klatsch!
Phin senkte den Kopf, dann stotterte er: »Stilwell wollte ihn unbedingt haben. Als Erinnerung gewissermaßen…«
Da fletschte Ike die Zähne, stieß die Rechte vor und krallte sie in das Hemd des Bruders. Mit einem gewaltigen Ruck schmetterte er Phin gegen die Straßentür, daß es im ganzen Haus dröhnte.
»Du Dreckskerl. Unsere Erinnerungen verkaufst du! Verschwinde aus meinen Augen! Verschwinde!«
Der Doktor kam an die Tür des Behandlungszimmers und fragte schüchtern: »Was geht hier vor?«
»Ach, lassen Sie mich in Frieden!« winkte der Rancher ab.
Während Phin das Haus verließ, schob Ike den Arzt zur Seite, betrat das Behandlungszimmer und blickte auf den noch immer reglos daliegenden Marshal.
»Was ist nun mit ihm?«
»Wir müssen abwarten. Es war ein schwerer Schlag auf den Hinterkopf. Davon muß sich ein Mensch erst einmal erholen. Ein anderer wäre vielleicht tot, obgleich die Kugel nicht in den Schädel eingedrungen ist.«
»Der erholt sich. Verlassen Sie sich drauf!« Ike nahm eine Strohhalmzigarre aus der Tasche, schob sie zwischen die Zähne und riß unter der Fensterbank ein Zündholz an. Draußen auf der hellen Straße sah er die Gestalt des Bruders. Da schob er mit der Linken das Fenster hoch und brüllte hinaus: »Ich habe gesagt, du sollst verschwinden.«
Phin trottete davon.
Ike blickte ihm finster nach. Schließlich wandte er sich um.
»Hören Sie, Mann. Sie sind ein Stümper. Mehr will ich Ihnen nicht sagen.«
»Aber ich bitte Sie…«
»Schweigen Sie. Ich kenne einen Arzt, der hätte den Mann längst wieder zu sich gebracht. Schon mal was von Doc Holliday gehört? Ich habe Leute gesehen, die noch ganz anders zusammengeschlagen dalagen – er hat sie in wenigen Minuten auf die Beine gebracht. Und Sie stehen herum und falten die Hände und rufen den Großen Manitu um Hilfe an. Wozu sind Sie eigentlich Doktor geworden? Schuster hätten Sie werden sollen, Mann!« Er stampfte durch den Raum. »Haben Sie denn keinen Whisky im Haus?«
»Whisky? Doch, natürlich, hier.« Der Arzt holte rasch eine noch halbvolle Flasche aus dem Schrank.
Ike setzte sie an den Hals und nahm einen Schluck. Dann trat er auf den Marshal zu und goß ihm etwas Whisky über den Kopf, richtete ihn auf und setzte ihm die Flasche an die Lippen.
»Los, helfen Sie mir schon!« forderte er den Doktor auf.
Reichlich unsanft flößte er dem Missourier ein paar Schlucke Whisky ein.
Wyatt schlug die Augen auf. Als er über sich das Gesicht Ike Clantons sah, schloß er es sofort wieder.
Welch ein Schock für ihn, aus tiefster Ohnmacht erwacht, ausgerechnet das Gesicht seines größten Widersachers vor sich zu sehen.
»Er muß noch einen Schluck haben.«
Deutlich drangen die Worte an das Ohr des Marshals. Wyatt hob mit einer schwachen Bewegung die Hand und schob die Flasche zurück.
»Er will nicht. Also, er zeigt schon wieder seinen eigenen Willen. Dann ist er auch schon auf dem Trail zurück.«
Und richtig. – Der Marshal stützte sich auf seine Arme und blickte forschend in das Gesicht des ehemaligen Gangsters. »Ike!«
»Ja, ich bin es leider, Marshal.« Der Rancher hob die Hände und ließ sie wieder fallen. »So verrückt Ihnen das auch erscheinen mag.«?Er schob seine Strohhalmzigarre mit Zähnen und Zunge von einem Mundwinkel in den anderen.
Wyatt wandte den Kopf und sah jetzt das bleiche Gesicht des Arztes hinter Ike. Dann nahm er auch die Gegenstände des Raumes wahr, in dem er sich befand – und griff sich mit der Linken an den Schädel.
»Was ist passiert?« Er tastete seinen Kopf ab und fühlte die Beule.
»Das möchte ich auch wissen«, knurrte Ike. »Sie sind angeschossen worden!«
»Von wem?«
»Das ist eben die Preisfrage!«
Wyatt setzte sich auf die Tischkante und stemmte die Stiefel auf den Boden.
»Wo ist Phin?« kam es dumpf aus seiner Kehle.
Ike, der ihm den Rücken zugekehrt hatte und auf das Fenster zugegangen war, blieb stehen. Die Frage hatte ihn wie ein Pfeil getroffen.
Er wandte sich langsam um und blickte dem Marshal ins Gesicht.
»Er war es nicht.«
»Wo ist er?«
»Ich habe ihn fortgeschickt.«
»Warum?«
»Weil ich nicht will, daß er mit Ihnen zusammengerät.«
»Wer hat auf mich geschossen, Ike?«
»Ich weiß es nicht. Jedenfalls war es nicht Phin.«
»Tut mir leid, diesmal müssen Sie mir schon glauben.«
»Das hätte ich ihn gern selbst gefragt.«
Wyatt erhob sich, nahm ein Geldstück aus der Westentasche und warf es dem Doktor hin.
Der schüttelte den Kopf. »Nein, Marshal, ich habe ja nichts für Sie tun können…«
Der Missourier winkte ab und ging wortlos hinaus in die Nacht von Nogales.
Da hörte er stampfende Schritte hinter sich.
Es war Ike. Er blieb oben auf dem Vorbau stehen.
»Wyatt!«
Der Marshal, der schon die Mitte der Straße erreicht hatte, wandte sich um.
»Wyatt, Phin war es nicht!«
Der Marshal griff nach seinem Schädel, nickte und ging weiter die Straße hinunter. Er hielt auf das schmalbrüstige Boardinghouse zu, das er neulich bei seinem letzten Aufenthalt in Nogales gesehen hatte.
Vor der Tür brannte ein Windlicht.
Er klopfte an.
Ein alter Mann öffnete und ließ ihn ein.
»Haben Sie noch ein Zimmer frei?«
»Ja, noch eine ganze Menge. Sie können noch fünf Stück haben.«
»Ich brauche nur eins.«
Der Alte ging vor dem Marshal her die Treppe hinauf.
Das Öllicht, das er dabei in der Hand trug, stank entsetzlich.
Er führte den Marshal im oberen Korridor in eines der Zimmer und wünschte ihm eine gute Nacht.
Wyatt zündete die Kerosinlampe gar nicht erst an, trat ans Fenster und blickte auf die Straße und sah einen Mann unten stehen.
Es war Ike Clanton.
Vom Mondlicht geisterhaft beleuchtet, stand der rätselhafte Mann mitten auf der Straße und starrte vor sich hin.
Wyatt ging zurück ins Zimmer, steckte den schmerzenden Kopf in die Wasserschüssel und trocknete ihn dann ab.
Dann schnallte er den Waffengurt ab, hing ihn an den Bettpfosten, zog die Stiefel aus und legte sich nieder.
Als er die Augen aufschlug, stand die Sonne schon steil am Himmel und warf ein kurzes, hartes Licht durch das Fenster in den Raum.
Wyatt stand sofort auf, rasierte sich, wusch sich gründlich und ging dann hinunter.
Der Boardinghousebesitzer kam ihm entgegen.
»Ich habe Ihren Frühstücksplatz vorn am Fenster decken lassen, Marshal.«
Wyatt wunderte sich nicht darüber, daß der Mann ihn kannte. Es hatte sich natürlich längst in der Stadt herumgesprochen, daß er hier war.
Er setzte sich an den kleinen Fenstertisch und sah, daß zwei Gedecke aufgelegt waren.
Kaum hatte er einen Schluck von dem Kaffee genommen, als ein Fremder durch die Flurtür in den Speiseraum kam. Er war groß, Mitte der Vierzig, hatte ein längliches Gesicht und helle Augen. Er trug einen grünen Swifty-Anzug, dessen Taschen und Revers schwarz paspeliert waren und machte einen gepflegten Eindruck. Suchend sah er sich im Speiseraum um und kam dann auf den Fenstertisch des Marshals zu.
»Ist es gestattet?«
Wyatt nickte. »Bitte.«
Der Fremde ließ sich nieder, und sein Frühstück wurde gebracht.
Wyatt fühlte, daß der Mann ihn scharf, wenn auch bemüht unauffällig beobachtete.
Plötzlich setzte der Fremde seine Tasse ab und fragte: »Sie sind Wyatt Earp, nicht wahr?«
Der Marshal nickte wieder. »Ja.«
»Es freut mich, Mr. Earp, Ihre Bekanntschaft zu machen. Mein Name ist Callagan, Cass Callagan.«
Wyatt nickte uninteressiert.
Da fuhr Callagan fort. »Ich bin in Geschäften unterwegs.«
Wyatt verzehrte den Rest seines Käsebrotes und blickte dann auf die Straße.
Da hörte er den Mann sagen: »Ich habe ein einträgliches Geschäft, das seinen Mann ernährt.«
»Das ist ja schön«, entgegnete der Marshal und wollte aufstehen.
Da sah er plötzlich die beringte Hand Callagans auf seinem Unterarm liegen.
Er hob den Kopf und blickte in die wasserhellen Augen des Fremden.
»Moment noch, Mr. Earp!« sagte er in vertraulichem Ton.
Wyatt blickte ihn nicht eben erwartungsvoll an.
Callagan lehnte sich in seinem Stuhl zurück, zündete sich eine Zigarette an und fragte mit gespieltem Interesse: »Was verdient eigentlich so ein Marshal?«
»Kommt ganz darauf an«, entgegnete der Marshal ausweichend.
»Hundertfünfzig im Monat! Mehr auf keinen Fall!« versetzte Callagan abfällig.
Der Marshal schüttelte den Kopf. »Nein, mehr nicht.«
»Finden Sie eigentlich, daß das eine ausreichende Bezahlung für einen Mann wie Sie ist?« fragte Callagan, und es schien dem Missourier, daß er plötzlich einen lauernden Zug im Gesicht hätte.
»Wenn nicht mehr drin ist, ist nicht mehr drin, Mr. Callagan.«
»Damit sollte sich aber doch ein Mann Ihres Formats nicht zufrieden geben.«
Wyatt durchforschte das Gesicht des merkwürdigen Fremden. Worauf wollte dieser Mann eigentlich hinaus?
»Haben Sie einen besseren Job für mich, Mister?«
»Vielleicht.«
»Und, der wäre?«
»Drüben in Texas wird nach Öl gebohrt.«
»Ich hörte davon.«
»Die Arbeiten machen gute Fortschritte, und die Company braucht Leute.«
Wyatt lachte. »Vielen Dank, Callagan. Aber ich bin doch kein Ölarbeiter.«
Der andere lachte jovial. »Die Company braucht einen Boß für die Bohrungen.«
»Aha«, entgegnete Wyatt völlig uninteressiert, »dann soll sie ihn sich suchen.«
»Vielleicht habe ich ihn gefunden, Mr. Earp.«
Wyatt tippte sich mit der Linken auf die Brust.
»Ich?« Er lachte. »Tut mir leid, Mr. Callagan, davon verstehe ich zu wenig.«
»Sie brauchen nichts davon zu verstehen, Mr. Earp. Es kommt der Company nur auf einen Mann an, der Format hat. Von den Bohrungen selbst braucht er nicht viel zu verstehen. Das kommt schon von ganz alleine. Das Gewerbe ist hier noch jung, und die Leute wachsen damit auf. Sie wissen ja selbst noch kaum etwas davon. Jetzt suchen sie einen Mannschafts-Chief. Und der Job wird gut bezahlt.«
»Nein, danke. Schuster bleib bei deinen Leisten.«
»Trauriger Leisten, den Sie hier schlagen, Earp.«
»Vielleicht scheint Ihnen das nur so. So traurig ist er gar nicht. Außerdem müssen ja auch Männer da sein, die in diesem jungen Land für das Gesetz kämpfen.«
Der Mann von der texanischen Ölkompany lächelte überlegen.
»Ich glaube, das Öl ist wenigstens ebenso wichtig wie das Gesetz, Mr. Earp.«
»Ich möchte darüber nicht mit Ihnen streiten, Callagan.«
Wyatt erhob sich und deutete eine Verbeugung an.
Callagan war auch aufgestanden. Er hatte plötzlich ein dickes Geldscheinbündel in der linken Hand.
»Hören Sie, Earp. Das sind zweitausend. Zweitausend! Verstehen Sie?«
Der Marshal hatte auf einmal eine steile Falte zwischen den geschwungenen schwarzen Brauen stehen.
»Was soll das heißen?«
»Wir brauchen einen Bohrmeister drüben in Texas.«
»Ich habe Ihnen doch gesagt, daß der Job mich nicht interessiert.«
»Das ist nicht wichtig, Mr. Earp. Das Interesse kommt mit der Zeit.«
»Was soll ich mit dem Geld?«
»Das ist ein Vorschuß. Sie können ihn sofort nach der Vertragsunterzeichnung einstecken. Im Monat gibt es für den Bohrmeister Earp siebenhundert.«
»Siebenhundert Dollar! Das glauben Sie doch selbst nicht!«
»Ich würde es Ihnen sonst nicht sagen. Schließlich ist es nicht mein Geld, Marshal, sondern das der Company.«
Wyatt ließ sich auf den Stuhl nieder.
»Hören Sie, Callagan. Wenn die Company so verschwenderisch mit ihrem Geld ist, dann wird sie bald pleite sein. Bestellen Sie das meinethalber Ihrem Boß von mir.«
»Die Company ist nicht verschwenderisch mit ihrem Geld.«
»Siebenhundert für einen einzelnen Mann?«
»Nein, nicht für einen einzelnen Mann, sondern für Wyatt Earp.«
Der Marshal schüttelte den Kopf. »Das verstehe ich nicht. Wie kommen Sie überhaupt auf mich?«
»Ich bin nicht selbst darauf gekommen. Fred McLean ist drauf gekommen.«
»Wer ist das?«
»Der Mann, dem das Bohrland gehört.«
»Und wo sitzt er?«
»Drüben in Texas.«
»Nun erzählen Sie mir nur noch, er hätte Sie hierher geschickt.«
»Allerdings. Ich war gestern in Tombstone und bin erst spät in der Nacht hier angekommen.«
»Dann verfügt die McLean Company über ausgezeichnete Reiter.«
Callagan nahm eine Zigarre aus einer feinen Ledertasche und bot auch dem Marshal eine an.
Der lehnte ab.
»Mr. Earp, ich habe den weiten Weg nicht gemacht, um mit einer Ablehnung zurückzukommen. Überlegen Sie es sich gut. Sie haben Zeit bis heute abend. Es ist ein großartiger Job. Und siebenhundert Dollar im Monat sind nicht zu verachten.«
»Aber das ist doch glatter Unfug!«
»Nein, es ist kein Unfug. Bei den Bohrarbeiten entstehen oft Streitereien und Unstimmigkeiten unter den Arbeitern. Earp, Sie sollen ja nicht irgendein Bohrmeister sein, sondern der Vormann gewissermaßen, der noch sechs andere Bohrmeister und hundert Arbeiter unter sich hat.
Ihr Name allein und Ihre Persönlichkeit würden genügen, um die Leute bei der Stange zu halten. Verstehen Sie?«
»Ja, ich verstehe jetzt. Aber…«
Wyatt schüttelte den Kopf. »Nein, Mr. Callagan. Sie haben den Weg umsonst gemacht. Es hat keinen Sinn. Ich bin Gesetzesmann und werde es auch bleiben.«
Er blickte versonnen durch das Fenster auf die Straße und fuhr fort: »Später einmal, wenn ich zehn oder zwanzig Jahre älter bin, dann werde ich drüben in Kalifornien ja vielleicht einmal selbst nach Öl bohren.«
Callagan schlug ein spöttisches Lachen an. »Bis dahin gibt es kein Öl mehr, Earp. Verlassen Sie sich darauf. Dann haben es Ihnen die anderen längst vor der Nase weggeschnappt. Und das hatte ich Ihnen noch sagen wollen: Wenn Sie erst Chief der Bohrmeister sind, und eine Weile bei der Company gearbeitet haben und der Besitzer der Felder Sie schätzengelernt hat, dann ist es nicht ausgeschlossen, daß er Sie zu seinem Partner macht. Dann verdienen Sie erst wirklich Geld. Überlegen Sie sich die Sache, Mr. Earp. Es ist doch eine Affenschande, daß Sie mit so ein paar Dollar im Monat herumlaufen und dafür Ihr Leben ständig riskieren. Ein Mann wie Sie müßte doch das Fünffache verdienen. Und das können Sie bei der Company, wenn Sie erst eine Weile dabei sind.«
Wyatt betrachtete den Mann, der ihm das seltsame Angebot gemacht hatte, forschend.
»Nein, Mr. Callagan, geben Sie es auf. Sie brauchen nicht bis heute abend zu warten. Es hat keinen Zweck. Ich bleibe, was ich bin.«
»Ich werde trotzdem warten, Marshal«, entgegnete Callagan und es war dem Missourier, als ob bei diesen Worten in die Augen des Ölmannes ein undurchsichtiges Grinsen trat.
In diesem Moment zog draußen auf der Straße ein Leichenzug vorüber.
Wyatt blickte hinaus und sah hinter dem Wagen, der den Sarg trug, die Frau des Posträubers Percy Farell gehen. Sonst begleitete den toten Outlaw niemand auf seiner letzten Reise.
Wyatt wandte sich an Callagan.
»Ich muß jetzt gehen, Mister. Leben Sie wohl. Und – ganz sicher werden Sie einen besseren Mann für den Job finden, als ich es je sein würde.«
»Das werde ich ganz sicher nicht«, entgegnete Callagan sofort.
Der Marshal ging hinaus und fragte einen Jungen, wie er zum Friedhof käme. Der Kleine erklärte ihm den Weg.
Der Boot Hill von Nogales lag auf einer buschbesetzten Anhöhe im Süden der Stadt.
Der Marshal hatte sie noch nicht ganz erreicht, als er einen Reiter von der Stadt her kommen sah. Wyatt blieb hinter einem der Büsche stehen und wartete, bis der Mann herangekommen war.
Es war Ike Clanton!
Wyatt beobachtete den Tombstoner Rancher verwundert. Was trieb diesen Mann nur immer in die Nähe von Friedhöfen?
Ike stieg vom Pferd, ließ die Zügelleinen fallen und wollte auf den Busch zugehen, hinter dem der Marshal stand.
Da trat Wyatt hinter den Zweigen hervor.
Ike blieb stehen.
»Sie sind auch hier?« Er hatte einen verstörten Ausdruck in den Augen, schien aber mehr verwundert als erschrocken den Marshal hier zu treffen.
Dann nahm er den Hut ab und wischte sich über die Stirn.
»Es wird langsam kälter«, sagte er leise, »man spürt schon den November.«
Wyatt deutete auf den Leichenzug, der jetzt die letzten Häuser hinter sich gelassen hatte. »Kannten Sie den Mann?«
Ike schüttelte den Kopf. »Nein.«
Als der Wagen nähergekommen war, blickte er zu dem düster wirkenden Gottesacker hinüber.
»Immer wenn ich einen Leichenzug sehe, muß ich an den Tag denken, an dem Billy…«
Der Marshal nickte. »Ja, ich weiß.«
Er mußte an den Tag denken, an dem sein Bruder Billy in Tombstone hinaus auf den Graveyard geführt worden war.
Ike wandte den Kopf. Er hatte den Hut noch in der Hand, und der Wind, der aus der Savanne herüber gegen den kleinen Hügel strich, trieb ihm das Haar in die Stirn.
Geistesabwesend fuhr er fort: »Da, der klapprige Gaul bringt ihn fast allein hier heraus. Selbst die Frau ist zurückgeblieben. Ich wußte es ja. Und ich hasse es, wenn einer seine letzte Reise allein antreten muß.«
Sollte er sich wirklich hier eingefunden haben, weil er Mitleid mit einem Toten hatte, den niemand hinaus auf den Boot Hill begleiten wollte?
Wyatt vermochte das nur schwer zu glauben.
Stumm warteten die beiden Männer, bis der Wagen mit dem Sarg an ihnen vorüber war.
Ike setzte sich in Bewegung und ging hinter dem Wagen her.
Da ließ der Marshal seine Zügelleinen los und folgte ihm.
Ein zwergenhafter, etwas buckliger Mensch mit galligem Gesichtsausdruck hockte auf dem Kutschbock und döste vor sich hin.
Als der Wagen auf dem Friedhof angelangt war und schon längst in einer der Gräberreihen vor einer nicht sehr tiefen Gruft hielt, hockte der Mann immer noch auf seinem Kutschbock.
Da trat Ike vor, stieß ihn an und rief: »He, schläfst du schon, Brother, oder ist es für immer? Dann können wir dich ja gleich neben den da packen.«
Der Driver warf den Kopf herum und starrte den Sprecher aus großen Froschaugen an.
»Ike Clanton«, entfuhr es ihm.
»Ja, ich hoffe, du hast nichts dagegen.«
Jetzt kam auch die Frau heran. Der Trott des Pferdes war ihr doch zu schnell gewesen. Schmerzgebeugt stand sie vor dem offenen Grab, in das die drei Männer den Sarg hinuntergelassen hatten.
Da stieß Ike den Totengräber an.
»Ich wüßte bloß gern, wie du das allein gemacht hättest, Alter?«
Der blickte mit zerknittertem Gesicht auf und krächzte: »Ich mache es immer allein, Mr. Clanton.«
»Ja, das glaube ich schon. Irgendwie wirst du die Kästen schon von deinem Karren herunterbringen. Und dem, der darin liegt, dem macht es ja nichts mehr aus.«
Sie standen eine Weile stumm vor dem Grab. Als der Alte zu schaufeln begann, wandte Wyatt sich um und verließ den Graveyard.
Der Rancher blieb noch.
Erst als der Marshal sich in den Sattel gezogen hatte, verließ auch er den Friedhof.
»Übrigens, was ich sagen wollte, Wyatt«, meinte er, während er sich eine halbangerauchte Strohhalmzigarre anzündete, »Phin war es nicht.«
Wyatt zuckte nur mit den Schultern.
»Er kann es nicht gewesen sein«, sagte Ike. »Der Mann, der auf Sie geschossen hat, benutzte ein Gewehr. Und Phin hat kein Gewehr.«
»Ein Gewehr?« Wyatt glitt aus dem Sattel. »Woher wissen Sie das?«
»Weil es ein Gewehrschuß war. Ich habe ihn gehört.«
Wyatt forschte in den bernsteinfarbenen Augen des Rebellen. »Ike, ich habe noch eine Frage«, sagte er leise.
Der Rancher wandte sich ab und stieß den Rauch durch die Nase aus. »Ich habe etwas gegen Ihre Fragen, Wyatt Earp.«
»Ich weiß. Trotzdem werde ich Sie fragen: Was suchen Sie jetzt hier in Nogales?«
Ganz langsam wandte Ike Clanton den Kopf. Verblüffung stand in seinen Augen.
»Was ich hier suche? Können Sie es sich nicht denken?«
Wyatt war bis zum äußersten gespannt, als er entgegnete: »Nein, das kann ich nicht.«
Da griff der Rancher nach seinem Sattelknauf und zog sich auf den Rücken seines Pferdes.
»Tut mir leid, ich kann Ihnen keine Antwort auf diese Frage geben.«
Er tippte an den Hutrand und wollte weg.
»Ike!«
Der Reiter wandte sich noch einmal um.
»Ist es wegen Phin?«
Es dauerte sehr lange, bis sich der Rancher zu einer Antwort bequemte. »Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich. So long.« Er trabte nach Nordosten davon.
Wyatt ritt in die Stadt zurück. Er war gestern auf dem Weg zum Gold Dollar Saloon gewesen, als ihn die hinterhältige Kugel aufgehalten hatte. Glücklicherweise war das Geschoß im stumpfen Winkel auf die Metallplatte geschlagen, die er immer hinten im Schweißband seines Hutes trug und die ihm schon oft das Leben gerettet hatte.
Der Schuß war also aus einem Gewehr abgegeben worden. Und wahrscheinlich hatte ihn der Schütze aus einem der Fenster des Gold Dollar Saloons abgefeuert.
Wyatt betrat den zu dieser Mittagsstunde noch leeren Schankraum.
Hinter der Theke stand der kahlköpfige Keeper, der ihm gestern abend, als er Phin getroffen hatte, schon aufgefallen war.
Jetzt hatte der Marshal Muße, diesen eigenartigen Menschen genauer zu betrachten. Er war ziemlich groß, hatte eine etwas vornübergebeugte Gestalt und mochte an die Fünfzig sein. In seinem länglichen Gesicht standen Augen, die seltsam stechend wirkten und tief in den Höhlen lagen. Die Nase war lang und schmal, die Spitze nach unten gebogen. Eingefallen und klein war der Mund, der einen zahnlosen Oberkiefer verriet. Spitz stach das Kinn nach vorn. Die Ohren waren lang und hatten eine ungesunde gelbliche Farbe.
Was Wyatt schon am Vorabend aufgefallen war – der Schädel dieses Mannes war eigenartig verformt. Über dem rechten Ohr wuchs der Schädelknochen weit hinaus, und über dem linken Ohr schien an dieser Stelle etwas zu fehlen.
Der Mann trug ein weißes Hemd, eine schwarze Halsschleife, eine schreiendgelbe Weste und eine braune Hose. Seine langen Arme mit den Spinnenhänden lagen auf dem Thekenblech.
In seinem rechten Mundwinkel steckte ein erloschener Zigarillo.
Dieser Harry Madock hatte ganz unzweifelhaft etwas Abstoßendes. Und das lag nicht unbedingt in seinem Gesicht, sondern auch in seinen Bewegungen, in seinem ganzen Wesen und – nicht zuletzt in seiner Stimme.
»Hallo, da kommt ja hoher Besuch in unsere Hütte«, spöttelte er.
Linkisch blickte er dem Marshal entgegen und beugte sich mit einer ruckhaften Bewegung vor, als er fragte: »Was soll es sein?«
»Kilby wohnt bei Ihnen?«
»Kilby?« tat der Keeper, als müßte er überlegen. »Ja, ich erinnere mich. Er wohnt hier.«?Dann wandte er sich um und rief: »Conchita!«
Das hübsche glutäugige Mädchen, das der Marshal neulich schon gesehen hatte, trat in den Perlschnurvorhang und blieb dort stehen. Während sie die glitzernden Glasperlen durch die Finger gleiten ließ, fragte sie: »Was gibt es? Oh, der Marshal ist da!« Echte Verwunderung, ja, sogar Schreck stand in ihren dunklen Augen.
Madock krächzte: »Äh, wohnt Kilby noch bei uns?«
»Kilby?« Sie schoß ihm einen fragenden Blick zu. »Nein, ich glaube, er ist nicht mehr da.«
Da blickte der Marshal das Mädchen an.
»Führen Sie mich bitte zu seinem Zimmer, Miss.«
»Mein Name ist Conchita«, meinte sie und versuchte ihn mit einem verführerischen Blick zu verwirren.
Aber Frauen dieser Art hatten niemals eine tiefere Wirkung auf den Missourier ausüben können.
»Sparen Sie sich die Bemühungen, Miss, und bringen Sie mich zu Kilby.«
»Mr. Kilby wohnt nicht mehr bei uns.«
»Seit wann?«
»Seit gestern.«
»Das stimmt nicht. Gestern war er noch hier.«
»Ja«, meinte Madock, »gestern noch, aber heute nacht ist er abgereist.«
»So, abgereist, wohl mit der Overland?«
Der Keeper lächelte mokant. »Ich weiß es nicht, Marshal. Ich glaube, er ist weggeritten. Aber ich kann mich nicht im einzelnen um die Gäste des Hauses kümmern – Conchita, weißt du etwas darüber?«
Die Frage enthielt schon die Antwort in sich.
Das Mädchen, das bereits auf der Treppe zum Obergeschoß stand, schüttelte den Kopf.
»Kommen Sie!« sagte der Marshal rauh.
Sie ging vor ihm die Treppe hinauf und öffnete die Tür eines Zimmers, das zum Hof hinausführte. Wyatt warf einen kurzen Blick in den Raum und schüttelte dann den Kopf. »Kilby hat nicht in diesem Zimmer gewohnt!«
»Nicht?« Sie lehnte sich gegen den Türpfosten und verschränkte die Arme vor der Brust. Dann sagte sie in lockendem Ton: »Ich hatte mir schon immer gewünscht, Sie einmal zu sehen, Mr. Earp. Wenn man so viel von Ihnen gehört hat, ist es schließlich kein Wunder. Die Männer an der Theke erzählen doch seit Jahren von Ihnen.«
Sie ließ diesen Worten einen verführerischen Augenaufschlag folgen, der jedoch bei dem Marshal nicht verfing.
Barsch sagte er: »Wo ist Kilbys Zimmer?«
»Ich dachte, er hätte hier gewohnt.«
»Sie dachten? Sie wissen es also nicht?« erkundigte er sich schroff.
Conchita zog die Schultern hoch und ließ sie wieder fallen, ohne ihren Platz am Türpfosten zu verlassen.
»Wer wohnt da drüben?« Wyatt deutete auf die gegenüberliegende Tür.
»Das Zimmer ist besetzt.«
Der Marshal trat auf die Tür zu, klopfte und stieß sie dann auf.
Mit hysterischem Schrei fuhr eine Frau, die am Tisch gesessen und Whisky getrunken hatte, auf, preßte den Morgenmantel um sich und suchte mit der Linken ihr strähniges rotes Haar aus dem Gesicht zu streichen.
»Pardon, Madam«, entschuldigte sich der Marshal und wollte die Tür zuziehen.
»Wer sind Sie und was wollen Sie?« rief die Frau.
Da trat Conchita neben den Marshal an die Tür.
»Er ist Wyatt Earp, Dolores.«
»Wyatt Earp?« fragte die Frau. »Nein.« Dunkle Röte überzog ihr vom Alkohol aufgeschwemmtes Gesicht. »Ich bin die Frau des Salooners«, erklärte sie.
»Mrs. Madock also?«
»Nein, Mr. Madock ist nur der Keeper. Mein Mann ist nicht da. Vielleicht kann ich Ihnen helfen?«
»Ja, das können Sie, Madam. Ich suche einen Mann namens Kilby.«
»Mr. Kilby?«
Zu spät bemerkte Dolores den warnenden Blick, den ihr Conchita zuwarf. »Der wohnt hier nebenan.«
»Danke.« Wyatt entschuldigte sich und war sofort an der Nebentür.
Sie war verschlossen.
»Öffnen Sie, Miss Conchita.«
Das Mädchen zog die Schultern hoch. »Ich habe keinen Schlüssel.«
»Wenn Sie nicht öffnen, werde ich die Tür aufbrechen!«
Da kam die Saloonerin auf den Gang und rasselte mit einem Schlüsselbund. »Einer davon muß es sein.«
Sie versuchte mehrere Schlüssel. Und als sie keinen passenden fand, nahm ihr der Marshal den Bund aus der Hand, und schon der zweite Schlüssel paßte.
Die Tür sprang auf. Wyatt blickte in einen leeren Raum. Er untersuchte ihn kurz und kam dann wieder auf den Gang zurück. Die beiden Frauen blickten ihm erwartungsvoll entgegen.
»Da hat er also gewohnt? Well, das kann stimmen. Da von dem Fenster aus hat er gestern nacht den Schuß auf mich abgegeben.«
»Den Schuß?« Die Saloonerin griff sich an die Kehle und schwankte. Offensichtlich war sie eine Trinkerin, ihr Gesicht verriet es. Als sie den Blick des Marshals bemerkte, wandte sie sich ab und verschwand mit nicht ganz sicheren Schritten und einer gemurmelten Entschuldigung in ihrem Zimmer.
Conchita lächelte gehässig und blickte den Marshal siegessicher an. »Da bin ich doch eine andere Frau, nicht wahr, Mr. Earp?«
»Wann ist er abgeritten?« umging der Marshal ihre Frage.
»Ich weiß es nicht.«
Wyatt stand jetzt vor ihr und umspannte mit der Linken ihren Oberarm, so daß sie das Gesicht verzog.
»Miss Conchita«, sagte er eindringlich, »dieser Mann ist ein Mörder! Außerdem hat er oben in Tombstone eine Frau schwer verwundet!«
In Conchitas Augen war plötzlich nur noch Angst.
»Ich weiß… es nicht. Er ist weg!«
»Also, das wissen Sie, daß er weg ist.«
»Ja, ich glaube, ich habe ihn gehört. Mein Zimmer ist ja nebenan.«
»Kann ich Ihr Zimmer sehen?«
»O ja.« Sofort trat wieder das erfolggewohnte Lächeln in ihre Augen. Sie öffnete die Tür ihres Zimmers, und Wyatt warf einen kurzen Blick hinein. Die Vermutung, daß sich Kilby vielleicht dort verborgen haben könnte, wurde enttäuscht.
»Möchten Sie vielleicht auch ein Zimmer bei uns?«
»Nein, danke.«
»Schade, ich hätte Ihnen gern unser bestes Zimmer gegeben.«
Wyatt blieb stehen und senkte seinen Blick in die Augen des Mädchens.
Conchita vermochte diesem Blick nicht standzuhalten und senkte die Augen zu Boden.
»Ja, bitte«, sagte sie leise.
»Wo ist Kilby hingeritten?«
»Ich weiß es nicht«, flüsterte sie.
Wyatt umspannte jetzt ihre beiden Oberarme.
»Conchita«, sagte er noch eindringlicher, »Sie müssen es mir sagen. Sie machen sich sonst mitschuldig.«
Als die den Kopf hob, hatte die tatsächlich Tränen in den Augen.
»Nach Martini«, flüsterte sie hastig.
»Nach Martini?« wiederholte der Marshal. »Das liegt doch drüben in Mexiko!«
Sie nickte nur.
»Conchita, was haben Sie mir noch zu sagen?«
Sie schüttelte nur den Kopf und versuchte sich von ihm loszumachen.
Da gab er sie frei und wandte sich um und ging die Treppe hinunter.
Als er an der Theke vorbeikam, hatte Madock ein Glas in der Hand, aus dem er gerade einen tiefen Schluck genommen hatte.
Die Inhaber und die Bediensteten des Gold Dollar Saloons schienen dem Alkohol schon sehr früh am Tage zuzusprechen.
»Na?« fragte Madock in näselndem Ton. »Haben Sie ihn gefunden, Marshal?«
»Ich werde ihn finden, Madock. Verlassen Sie sich darauf.«
»Na, dann viel Glück«, meinte der Keeper, goß sich den Rest aus dem Glas in die Kehle und warf den Kopf dabei auf eine unangenehme Art ins Genick, so daß man sehen konnte, wie sein scharfer Adamsapfel auf und nieder rutschte. Als er den Kopf wieder senkte, sah er – zu seinem Schrecken hinter der Theke den Marshal vor sich stehen. Madock wich zurück und prallte so hart gegen das Flaschenbord, daß die Gläser aneinanderklirrten.
»Was wollen Sie von mir?« stotterte er.
»Sie haben mir viel Glück gewünscht, Madock. Und ich möchte mich dafür bedanken.«
Der Keeper starrte den Missourier unsicher an.
»Sie… wollen doch etwas?«
Wyatt blieb stehen und ließ den Mann nicht aus den Augen.
Da geschah etwas Sonderbares: das Glas entglitt Madocks Hand und zerschellte am Boden. Und im nächsten Augenblick stieß der Mann die Hand zum Revolver, den Wyatt bis dahin gar nicht bemerkt hatte. Er trug ihn am langen Halfter, rechts tief über dem Oberschenkel.
Aber ehe der Keeper die Waffe hätte hochbringen können, ließ der Marshal einen pfeifenden Handkantenschlag auf sein rechtes Schultergelenk fallen, der den Arm des entstellten Mannes sofort erschlaffen ließ.
Das Gesicht Madocks veränderte sich in Sekundenschnelle zur zynischen diabolischen Fratze. Er wich zur Seite und krächzte schnarrend: »Das werden Sie bereuen, Earp!«
Wyatt nahm ihm mit einer blitzschnellen Bewegung den Revolver aus dem Halfter und schleuderte ihn quer durch den Schankraum. Die Waffe rutschte bis unter das alte Orchestrion.
Madocks Augen flogen zum Musikautomaten hinüber und dann wieder zurück zum Marshal. Er stieß den Kopf vor und bleckte die Zähne und ohne sie auseinanderzunehmen, zischelte er: »Das war ein Fehler, Earp. Ein großer Fehler! Sie machen mit mir nicht, was Sie wollen, verstehen Sie? Mit Mühe und Not sind Sie gestern dem Totengräber von der Schippe gesprungen…«
Diese Worte waren ihm in rasendem Zorn entfahren.
»Sprechen Sie nur weiter, Madock.«
Jetzt sprang urplötzlich Angst in die Augen des Keepers.
Wyatt stieß ihn zurück, daß er auf einen Hocker fiel und blickte verächtlich auf ihn nieder.
»Interessant, Mr. Madock. Sehr interessant.« Er wandte sich um und verließ den Gold Dollar Saloon.
Als er am Hoftor der Schenke vorbeikam, hielt ihn ein zischendes Geräusch auf. Er wandte sich um und sah Conchita hinter dem Torpfeiler stehen.
»Mr. Earp!« flüsterte sie.
Wyatt blieb stehen und machte einen Schritt in den Hof.
In den großen dunklen Augen des Mädchens stand helle Furcht.
»Sie dürfen ihm nicht folgen, Mr. Earp.«
»Warum nicht?«
»Weil er dann weiß, daß ich ihn verraten habe…«
»Davon wird er nichts erfahren!«
»Doch, er kann es sich denken!«
»Beruhigen Sie sich, Miss Conchita. Wenn ich den Mörder stelle, wird er keine Gelegenheit mehr finden, an Ihnen Rache zu nehmen.«
»Er nicht, aber die an…«
»Die anderen, wollten Sie sagen?«
Sie ließ den Kopf sinken.
Da legte der Marshal den rechten Zeigefinger unter ihr Kinn und hob es an.
»Conchita, sagen Sie mir bitte, was Sie wissen!« mahnte er sie eindringlich.
Sie schüttelte den Kopf. »Ich kann Ihnen nicht mehr sagen, Mr. Earp. Nur so viel, daß Sie ihm nicht folgen dürfen!«
»Nein?«
»Weil Sie… in Ihr Verderben reiten würden!«
Eine Viertelstunde später hatte der Missourier die Stadt verlassen. Er ritt nach Süden auf die Grenze zu. Während des ganzen Rittes hatte er das Teufelsgesicht Madocks vor sich. Dieser Mann war der typische Hehler irgendeiner Bande. Er war frech, kaltschnäuzig, großspurig. Obendrein war er einfältig genug gewesen, sich selbst zu verraten. Sein Haß auf den Gesetzesmann war so groß, daß er sein wahres Gesicht nicht hatte vor ihm verbergen können.
Wo steckte Phin Clanton? War er mit Kilby zusammen aus Nogales geritten.
Und Ike? War er wirklich nur wegen des Bruders nach Nogales gekommen? Je länger Wyatt darüber nachdachte, desto unwahrscheinlicher erschien es ihm. Natürlich war es nicht ausgeschlossen, daß sich ein geläuterter Isaac Joseph Clanton Sorgen um seinen Bruder machte, der von dem alten Lebenswandel nicht lassen wollte. Aber der Missourier vermochte nicht zu glauben, daß ein Mann wie Ike Clanton sich so vollkommen geändert haben könnte. Zu viele Kämpfe hatte er mit ihm ausgetragen und zu hart und energisch war der Widerstand gewesen, den der einstige König von Arizona ihm geboten hatte. Nie war der Marshal einem Banden-Chief begegnet, der ihm ähnlich viel Schwierigkeiten gemacht hätte und in dessen Angriffen so viel Überlegung, List und System gesteckt hätte. Selbst der reiche Colorado-Rancher King Astor oben aus dem Garfield County hatte doch nichts von der dynamischen Kraft von der Urgewalt in sich, die in dem Tombstoner Cowboy Ike Clanton schlummerten.
Und immer wenn er in seiner Nähe war, wenn er neben ihm oder vor ihm stand, dann hatte Wyatt das Gefühl, daß er plötzlich die Hand ausstrecken mußte, um ihn zu Boden zu stoßen, den Revolver zu ziehen und zu rufen: »Ike, gib es auf! Du bist der Führer der Galgenmänner!« Er wollte ihm entgegenschreien, daß er wußte, daß Ike ihn nur an der Nase herumführen wollte, daß er ihn aus brenzligen Situationen gerettet hatte, um seinen Argwohn zu zerstreuen.
Gerade diese Dinge waren es ja, die typisch für Ike Clanton waren. Schon früher hatte er es geradezu meisterhaft verstanden, seine Angriffe zu tarnen, zu verschleiern, sein wahres Vorhaben bis zum letzten Moment zu verbergen und die Menschen zu täuschen.
Nicht umsonst hatte Cochise jetzt seinen Namen erwähnt, als er von dem Chief der Graugesichter sprach.
Und die in die Nacht hinausgeschrienen Worte, die gestern auf der Mainstreet von Nogales wie aus weiter Ferne in das Unterbewußtsein des Marshals gedrungen waren, auch sie vermochten nichts daran zu ändern. Denn selbst wenn sie ehrlich gemeint waren, konnte der Mann, der sie ausgestoßen hatte, dennoch der Chief der Galgenmänner sein! Denn Ike Clanton war viel zu klug, als daß er neben einem toten Marshal gesehen werden wollte. Und da seine Familienliebe bekannt war, wollte er natürlich auch nicht seinen Bruder Phin in einer solchen Situation entdeckt wissen. Der ganze Kampf der letzten Wochen, dieses nervenaufreibende Jagen nach immer neuen geisterhaften Verbrechern war ja nichts weiter als eine einzige Jagd nach dem großen Unbekannten: Nach dem Boß der Galgenmänner! Denn alles, was sich in der letzten Zeit in Nogales, oben in Tucson, in Kom Vo, in Costa Rica und vor allem in Tombstone ereignet hatte, war unzweifelhaft das Werk der Galgenmänner.
Sicher mochte Doc Holliday recht haben, wenn er vermutete, daß sich andere Banditen und vielleicht auch ganze Banden die Angst vor den Galgenmännern zunutze machten. Ike Clanton selbst hatte das ja auch schon einmal angedeutet. Aber gerade diese Andeutungen hatten den Argwohn des Missouriers wachgerufen. Wer wollte ihm sagen, ob der Rancher damit nicht den Verdacht von sich ablenken wollte?
Man hätte es als ein Wagnis ansehen können, daß der Marshal jetzt – auf den Tip des Schankmädchens Conchita hin – nach Mexiko ritt. Immerhin war es doch durchaus möglich, daß sie mit den Banditen unter einer Decke steckte. Aber der Missourier hatte das sichere Gefühl, daß Kilby sich nicht mehr in Nogales aufhielt. Und da Wyatt die Ortschaft Martini schon mehrfach hatte erwähnen hören, war er in den Sattel gestiegen, um hinüberzureiten. Möglicherweise war auch dort ein Schlupfwinkel der Galgenmänner.
Die Grenze hinter Nogales war bergig und unwegsam. Da keine direkte Overlandlinie hinüberführte, folgte der Marshal der überwachsenen Zwillingsspur, die die Wagenreifen schwerer Prärieschooner, die die Grenze hier vor nicht allzulanger Zeit passiert hatten, hinterlassen hatten.
Das Land jenseits der Grenze machte einen trostlosen Eindruck. Es senkte sich von Nord nach Süd in einem gewaltigen Plateau, das dem fernen Golf zustrebte. In den flachen Tälern lagen kleine weiße Städte und Ansiedlungen. Hin und wieder gab es eine Hazienda, deren große Rinderbestände durch die Banditen des eigenen Landes schon genug gefährdet waren, außerdem aber noch durch die Gringos aus den Staaten stark gelichtet wurden.
Am späten Nachmittag begegnete der Marshal einem einzelnen Reiter. Es war ein älterer, knurriger Mann mit kränklichem Gesicht, gebeugtem Körper und asthmatischem Atem. Er trug ein gelbgrünes Hemd, das aus grobem Leinen gewebt war, ein blaues Halstuch und eine graublaue Hose. Sein Hut war mißfarben und an den Rändern der Krempe ausgefranst.
Der Reiter hing vornüber im Sattel, hatte die Fäuste auf das breite Sattelhorn gestützt und blickte dem Missourier unterm Hutrand hervor entgegen.
Wyatt hatte seinen Falbhengst angehalten.
Die beiden Männer grüßten einander.
Dann fragte der Marshal den Alten nach dem Weg nach Martini.
Der Mann nahm die rechte Hand vom Sattelknauf und deutete nach Süden!
»Wenn Sie hier weiterreisen, Mister«, meinte er, wobei sich nur seine Unterlippe bewegte, »dann wären Sie schon auf dem richtigen Weg und könnten die Stadt noch vor Einbruch der Dunkelheit erreichen. Aber es ist steiniges Land da hinten südlich von den Hügeln. Da ist schwer durchzukommen, wenn man die Gegend nicht kennt. Ich würde Ihnen raten, halten Sie sich weiter westlich, da kommen Sie an den Lue Lon River. Er fließt nach Südosten, und wenn Sie an seinem linken Ufer bleiben, können Sie die Stadt nicht verfehlen.«
Danach ritt der Alte grußlos weiter.
Wyatt blickte ihm eine Weile nach und setzte den Falben dann auch in Bewegung. Er hatte beschlossen, dem Rat des Alten Folge zu leisten, da er die Schwierigkeiten kannte, die ein Ritt durch Steingeröll und wegloses Gebiet verursachen konnte. Nichts war für einen Reiter hinderlicher, als Geröllhalden. Und er hatte ja auch keinen Grund, anzunehmen, daß der Alte ihn in einen Hinterhalt schicken wollte.
So hielt er dann nach Südwesten hinüber, kam durch ein breites, flaches Tal, das nur von dünnen Steppengrasbüscheln bestanden war, und sah, als er die Anhöhen hinter sich hatte, in der Ferne das silberne Band des Creeks. Er ritt im spitzen Winkel darauf zu, um nicht allzu weit von seiner Richtung abzukommen.
Je näher er dem Creek kam, desto stärker war das Gelände mit Mesquitesträuchern und Tecarillabüschen besetzt.
Plötzlich stutzte er.
Er hatte im Sand die Hufeindrücke mehrerer Pferde entdeckt.
Sofort glitt er aus dem Sattel und untersuchte die Spur.
Es mußten wenigstens fünf Reiter gewesen sein. Sie waren direkt von Norden herunter an den Fluß gekommen. Also auch aus der Richtung von der Grenze her, nur daß sie in schnurgerader Richtung geritten waren und nicht wie er auf die Hälfte seines Weges – den Steinhalden entgegen.
Er stieg nicht wieder in den Sattel, sondern führte den Hengst dem Wasser zu.
Da es tagsüber trotz der bereits empfindlichen kühlen Nächte immer noch heiß war, war das Tier durstig geworden und lief sofort, als der Marshal ihm die Zügel über dem Sattelholm festgeschnallt hatte, auf die Uferböschung zu und trabte eine sandige Einbuchtung hinunter, um sich an dem frischen Bergwasser zu laben.
Der Marshal blieb bei den Büschen stehen und blickte auf den Fluß hinunter.
Im Westen hatte sich die Sonne dem Horizont so weit genähert, daß ihr Licht in gleißenden Strahlenbündeln über die Savanne fiel.
Irgend etwas hatte den Marshal gewarnt, weiterzugehen. Er wußte selbst nicht, was es war. Aber es veranlaßte ihn doch, bei den Büschen stehenzubleiben.
Plötzlich gewahrte er, wie der Hengst den Kopf mit einem Ruck aus dem Wasser nahm und die Ohren steil aufstellte. Das kluge Tier lauschte angestrengt über die Uferböschung hin nach Süden.
Mit einem leisen Pfiff lockte der Marshal den Falben zu sich heran und ließ ihn bei den Büschen stehen. Er selbst ging weiter, vorsichtig die Deckung des nächsten Busches gegen das Wasser hin ausnutzend, hielt auf ein breites, durchsichtiges Mesquitegestrüpp zu, ging geduckt daran entlang, die Spuren der fünf Reiter nicht aus den Augen lassend. Das nächste Gestrüpp war so weit von ihm entfernt, daß er sich tief an den Boden ducken mußte, um es ungesehen erreichen zu können.
Es war ein Tecarillabusch, der sehr dicke Wurzeln und Blätter hatte und ihm eine gute Deckung bot.
Da schnaubte der Falbe so sehr, daß der Marshal herumfuhr. Er sah, wie ein Mann auf den Busch zulief, hinter dem das Tier stand.
Er mußte zurück! Dennoch lief er nicht aufrecht, sondern geduckt wieder hinter den Sträuchern, und als er den Busch erreichte, hinter dem der Falbe stand, hörte er, wie das Pferd aufstieg und schnaubte.
Da war er heran und sah einen Mann vor sich, der das Tier beim Zügel gepackt hatte und es mit sich fortzerren wollte.
»Augenblick noch, Mister, wenn Sie gestatten!«
Der Mann wirbelte herum und stieß die Hand zum Revolver.
Aber zu seiner Verblüffung sah er in der linken Faust des Marshals schon einen großen sechskantigen Revolver blinken.
Wyatt blickte den Mann forschend an.
»Ich hatte die Absicht, noch eine Weile auf dem Hengst zu reiten, Mister. Anscheinend haben Sie etwas dagegen?«
Der andere Mann hatte Mund und Augen weit aufgerissen. Er war ein Mann von vielleicht fünfunddreißig Jahren, groß, breitschultrig, beleibt, mit einem schwammigen Gesicht und einem ungepflegten Schnurrbart. Auch das Haar wuchs ihm hinten über den Kragen und neben den Ohren weit bis zu den Kinnladen hinunter. Er trug einen breiten Sombrerohut und die Kleidung eines mexikanischen Peons.
»Machen Sie Ihren Mund wieder zu, Mister, sonst fliegen Ihnen noch ein paar Fische hinein.«
Doch der Mann verharrte in seiner Stellung und stierte den Missourier unverwandt an.
»Ich wollte… mir den Gaul nur ansehen. Ich wollte sehen…«
»Jetzt erzählen Sie mir nur noch, daß Sie nachsehen wollten, ob er ein paar Goldzähne hat, Mann!« unterbrach ihn der Marshal schroff.
»Nein, das nicht, aber…«
Wyatt hatte an dem gespannten Gesichtsausdruck des Peons sofort gesehen, daß er mit dem Gedanken spielte, einen schnellen Schuß zu riskieren.
Und da geschah es auch schon. Blitzschnell stieß der Peon die rechte Hand nach unten, um den Revolverlauf so rasch nach vorn zu bringen, daß er durch den Halfterboden schießen konnte.
Aber ein blitzschneller Fußtritt des Missouriers stieß ihm die Hand von der Waffe.
Wyatt riß ihm die Waffe aus dem Halfter und schleuderte sie zum Bach hinüber.
»Eine Art haben Sie am Leib, sich anderer Leute Pferde anzusehen, Mister.«
Da senkte der Bandit plötzlich den Kopf und suchte den Gegner im Rammstoß niederzurennen.
Der Marshal wich in einer einzigen Körperbewegung zur Seite, ließ den Mann passieren und riß dem Vorbeihechtenden einen hämmernden Faustschlag gegen den Schädel.
Betäubt fiel der Bandit in den Sand.
Wyatt knebelte ihn mit dessen eigenem Taschentuch, nahm ihm das verblichene Halstuch ab und sicherte damit den Knebel. Dann fesselte er ihn an Händen und Füßen mit den eigenen Gurten, die er um den Leib trug.
Darauf nahm er den Hengst und führte ihn ein Stück weit vom Flußufer fort, um ihn hinter einem Gesträuch stehenzulassen.
Vorsichtig sondierte er das Gelände.
Er hielt sich jetzt weiter von der Fährte entfernt, als er es vorhin getan hatte, und als er einen langgestreckten Tecarillabusch hinter sich hatte, zuckte er jäh zusammen.
Vorn rechts am Flußufer saßen drei Männer.
Und links hinter ihnen, unweit der Uferböschung, standen fünf Pferde.
Drei Männer und fünf Pferde!
Den vierten Mann hatte er erwischt.
Aber wo war der fünfte? Diese Frage machte ihm zu schaffen. Denn zu gern hätte er sich an die Männer herangeschlichen, die vor einem Busch am Ufer saßen und sich angeregt miteinander unterhielten. Es wäre nicht einmal allzuschwer gewesen, in ihre Nähe zu gelangen, aber die Tatsache, daß einer von ihnen hier irgendwo steckte und vielleicht das Gelände beobachtete, hinderte den Marshal daran.
Er wartete einige Minuten und blickte zu einer breiten, niedrigen Kaktee hinüber, die etwa zehn oder zwölf Yard von ihm entfernt stand und ihm, wenn er sie hätte erreichen können, auf Hörnähe an die drei Männer herangebracht hätte.
Tief an den Boden gedrückt schob er sich auf Finger- und Zehenspitzen vorwärts, wie er es von den gefährlichsten aller Indianer Nordamerikas, den Pineridges, schon in seinen Jugendjahren gelernt hatte. Die zwölf Yard hinüber zu der Kaktee waren ein Geländestück, das jederzeit von den Männern eingesehen werden konnte, wenn sie sich nur umgedreht hätten.
Wyatt hatte fast die Hälfte der Distanz hinter sich gebracht, als einer der Männer – der Marshal hatte sie ständig im Auge behalten – den Kopf zur Seite wandte.
Wyatt lag wie ein Stein am Boden. Den Kopf hatte er mit dem linken Ohr gegen den Boden gepreßt, um die Männer nicht eine Sekunde aus den Augen zu verlieren.
Der Mann, der jetzt den Kopf gewandt hatte, blickte jedoch an den Kakteen vorbei nach Südosten. Und jetzt wandte er den Kopf zurück und unterhielt sich wieder mit den anderen.
Wyatt robbte wie ein Indianer weiter durch den sandigen Boden auf die Kaktee zu.
Zwei Yard befand er sich von der mächtigen Staude entfernt, als er plötzlich vor sich im Sand am Fuße des Stachelgewächses eine Schlange sah, die zischend am Boden hochschnellte. Ein böses Funkeln stand in den Augen des Reptils.
Blitzschnell hatte der Marshal seinen Revolver gezogen.
Die Männer! Er mußte sie im Auge behalten.
Wie ein hochragender Wurzelstock verharrte das Tier vor ihm, rührte sich nicht.
Wyatt spannte geräuschlos den Revolverhahn.
Plötzlich merkte er, daß das Reptil es gar nicht auf ihn abgesehen hatte. Er zog sich rasch einige Inches weiter nach links hinüber und sah den Rücken eines Mannes, der auf der linken Seite der Kaktee am Boden saß und in das von der Abendsonne vergoldete Land im Süden blickte.
Nur eine knappe Armeslänge trennte die Giftschlange noch von dem Mann.
Der Marshal hatte keine Wahl. Er stieß den Revolver vor, und schon brüllte der Schuß auf, der den Schädel des Tieres zerschmetterte.
Die Männer drüben am Flußufer waren aufgesprungen, und einer von ihnen riß in einer Reflexbewegung den Revolver nach vorn und gab einen Schuß auf den Marshal ab.
Die Kugel streifte nur die Jacke des Missouriers und stob zischend in den Sand.
Wyatt federte hoch. Ein fauchender Schuß brüllte dem Mann entgegen, der auf ihn geschossen hatte und stieß ihm den Revolver aus der Hand.
Der Mann hinter der Kaktee war herumgefahren und starrte wie versteinert auf die Schlange. Er hatte die Situation sofort begriffen. »Die Schlange!« rief er. »Hier! Er hat ihr den Kopf zerschossen. Nur einen Schritt hinter mir hat sie gelegen!«
Langsam kamen die anderen heran, auch der, dem Wyatt den Revolver aus der Hand geschossen hatte.
Verblüfft starrten sie auf den Schlangenrumpf, dann auf den Fremden und schließlich auf ihren Kameraden. Es waren alles Männer Mitte der Dreißig, mit wenig vertrauenerweckenden Gesichtern.
»Wie kommen Sie hierher?« fragte einer von ihnen, der ein olivfarbenes Gesicht und öliges schwarzes Haar hatte, seinen Hut an einer Schnur auf dem Rücken trug und in mexikanischer Tracht steckte.
»Von der Grenze«, entgegnete der Missourier ausweichend.
»Von der Grenze?« wiederholte der Mann mißtrauisch und deutete auf die Spur, die der Marshal auf seinem Weg zu der Kaktusstaude im Sand hinterlassen hatte. »Einen ziemlich mühseligen Weg haben Sie sich da gemacht, Mister.« Argwohn klang in seinen Worten mit.
»Zu derartigen Wegen wird man hier gezwungen«, entgegnete der Marshal.
»Wie kommen Sie denn darauf?«
»Vielleicht fragen Sie das besser Ihren Kameraden, der mir mein Pferd stehlen wollte.«
»Was denn, Sie haben Rodrigo erwischt?«
»Ich weiß nicht, wie der Mann heißt.«
»Wo ist er?«
»Ich habe ihn da vorn an die Erde gelegt und vorsichtshalber mit ein paar Riemen gesichert.«
Der Olivgesichtige steckte seine Hände hinter den Waffengurt und zog die linke Braue auf eine Weise in die Höhe, die den Missourier unangenehm an Kirk McLowery erinnerte.
»Mein Name ist Enrique!« schnarrte er.
»Ein schöner Name«, entgegnete der Missourier.
»Und wie heißen Sie?«
»Berry«, entgegnete Wyatt und es war nicht einmal eine Lüge, denn mit vollem Namen hieß er ja Wyatt Berry Stapp Earp.
»Berry? Auch kein schlechter Name«, entgegnete Enrique und wippte auf den Zehenspitzen auf und ab.
Der Mann, den der Missourier vor der Schlange gerettet hatte, trat auf Wyatt zu und reichte ihm die Hand.
»Auf jeden Fall danke ich dir, Berry, das war ein sauberer Schuß. Das Vieh hätte mir garantiert den Garaus gemacht.«
»Das glaube ich auch.«
»Ich heiße übrigens Manuelo.«
Enrique gab Manuelo einen Wink.
»Los, sieh nach Rodrigo!«
Als er mit dem Befreiten zurückkam, stierte der den Marshal böse an.
»Was ist los, Enrique. Warum macht ihr den Kerl nicht fertig. Er hat mich überfallen und niedergeschlagen.«
»Das stimmt nicht ganz«, entgegnete der Marshal. »Und ich habe es deinen Freunden schon gesagt.«
Plötzlich fuhr Enrique den Marshal an: »Halt’s Maul, Mensch.«
Wyatt wußte genau, daß er gegen die fünf Männer keine Chance hatte, wenn er nicht sofort handelte. Ein krachender Faustschlag warf Enrique von den Beinen. Noch ehe die anderen zur Besinnung kamen, federte der Marshal zurück und hatte seine beiden Revolver gezogen.
»Hände hoch!«
»He, das ist ein ganz raffinierter Hund!« meinte Rodrigo. »Er hat uns überrumpelt.«
»Hände hoch, habe ich gesagt!« gebot der Marshal.
»Manuelo, komm her!«
Der kam auf den Marshal zu, und Wyatt zog ihm den Revolver aus dem Gurt. »Los, du entwaffnest die anderen!«
Der Tramp gehorchte mürrisch.
Als die fünf Männer entwaffnet waren, dirigierte der Marshal sie weiter zum Flußufer hinunter.
Enrique war inzwischen zu sich gekommen. Er hockte benommen neben den anderen am Boden.
Wyatt fixierte ihn forschend.
»Ziemlich merkwürdiges Benehmen habt ihr am Leib, Leute.«
»Von dir kann man kaum etwas anderes behaupten«, entgegnete Enrique frech.
»Du hältst jetzt den Mund!« gebot Wyatt dem Banditen. »Und jetzt sagt ihr mir, auf wen ihr hier gewartet habt.«
»Das möchtest du wohl wissen, was?« feixte Enrique.
»Manuelo!« Wyatt zog den Revolver.
Manuelo wurde weiß wie die gekalkte Wand.
»Was wollen Sie von mir, Señor? Ich habe nichts mit der Sache zu tun.«
»Auf wen habt ihr hier gewartet?«
»Eins steht fest«, entgegnete Enrique, »auf dich bestimmt nicht.«
»Nein, der Alte war nur dumm genug, mich zu euch zu schicken.«
»Was denn, Bernardo? Dieser Idiot hat dich hierhergeschickt?« fluchte Enrique.
Es stand für Wyatt fest, daß er hier an eine Wegelagerer-Crew geraten war, die den Reisenden auf dem Weg von Nogales nach Martini auflauerte.
Es hatte für ihn keinen Sinn, sich mit diesen Männern länger aufzuhalten, denn er mußte ja weiter.
Plötzlich machte er eine sonderbare Feststellung.
Enrique hatte sein Taschentuch hervorgeholt, um sich die Nase zu putzen. Dabei hatte er unbeabsichtigt ein anderes Tuch hervorgezogen, das jetzt mit einem Zipfel aus seiner Tasche lugte.
Ein graues Tuch! Und zwar von einem Grau, das der Missourier nur zu genau kannte. Es war ein Gesichtstuch der Galgenmänner. Da kam dem Marshal ein Gedanke. Er griff in die Tasche, nahm das graue noch geknotete Tuch, das er kürzlich einem der Galgenmänner in Tombstone abgenommen hatte, und schob es sich rasch unter die untere Hälfte des Gesichts.
Die fünf Banditen starrten ihn fassungslos an.
Enriques Unterkiefer war heruntergefallen. Mit vorgeschobenem Schädel stand er da und keuchte: »Nein…, das kann doch nicht wahr sein! Er ist doch nicht…«
»Doch!« entgegnete der Marshal. »Ihr seid an den Falschen geraten, Boys! Los, stellt euch nebeneinander!«
»Du… Sie verkennen uns, Señor«, sagte Enrique, »Sie verkennen uns…«
»Ganz sicher nicht, Enrique!«
Manuelo keuchte, ohne den Blick von Wyatt zu nehmen: »Enrique, jetzt weiß ich es. Das ist er…«
»Wer?« fragte Wyatt schnell.
Die fünf Galgenmänner blickten ihn unsicher an.
»Sie sind von drüben?« forschte Enrique vorsichtig.
»Wie komme ich dazu, euch zu antworten!«
»Warten Sie, Señor«, stotterte Enrique. »Sie können uns doch nicht einfach niederknallen.«
»Ihr hattet mit mir doch auch nichts anderes vor.«
»Aber das war doch ein Irrtum. Wir wußten doch nicht, wer Sie… wer Sie sind.«
»Und jetzt wißt ihr es?« forschte der Marshal.
Enrique ließ die Hände sinken und kam auf den Marshal zu.
Wyatt spannte sofort die Hähne seiner Revolver.
»Bleib stehen, Mensch!«
»Aber ich bitte Sie, wir gehören doch zueinander!«
»Ihr zu mir? Daß ich nicht lache!«
»Aber, Señor!« Er hob beide Hände und formte aus Daumen und Zeigefingern ein Dreieck.
Wyatt fragte ihn sofort: »Kennst du – Kilby?«
Enrique schüttelte den Kopf. »Soll er bei uns in Martini sein?«
Wyatt wich mit einer Gegenfrage aus: »Gehört ihr alle zu den Leuten aus Martini?«
Enrique nickte. »Ja, die hier sind unter mir.«
Unter mir! dachte der Marshal. Also eine regelrechte Organisation. Graugesichter bis weit nach Mexiko hinein.
»Kennt ihr den Gold Dollar Saloon in Nogales?«
Enrique schüttelte den Kopf. »Nein.«
»Und Madock kennt ihr auch nicht?«
»Nein!«
»Dann gehört ihr auch nicht zu uns!«
Manuelo warf hastig ein: »Vielleicht sollten wir überlegen, Enrique, vielleicht kennen wir doch den einen oder anderen.«
»Unsinn. Der will uns doch nur auf die Probe stellen!« herrschte Enrique, der nun glaubte klarzusehen.
Der Marshal forderte ihn mit einer Kopfbewegung auf, wieder in die Reihe der anderen zurückzutreten.
»Und mich?« fragte er mit geheimnisvoller Stimme, »kennt ihr mich auch nicht?«
Enrique nickte sofort. »Doch, Boß. Wir kennen Sie!«
»Gut.« Wyatt ließ die Revolver mit zwei blitzschnellen Handsaltos, die den Banditen einen Ruf der Verwunderung entlockten, in die Halfter zurückfliegen und verschränkte die Arme vor der Brust, ohne das Tuch vom Gesicht zu nehmen.
»Du bist ein Dummkopf, Enrique.«
Der Bandit starrte ihn unsicher an. »Wie meinen Sie das?« stammelte er.
»Da aus deiner rechten Tasche guckt ein Zipfel, der bestimmt nicht zu deinem Taschentuch gehört, Mensch!«
Enrique senkte den Kopf und sah zu seinem Schrecken den grauen Tuchzipfel aus der Tasche hervorlugen.
Er stopfte ihn sofort zurück. Als er den Kopf hob, war sein Gesicht kreidebleich.
»Das passiert nicht wieder – Boß.«
»Davon bin ich nicht ganz überzeugt, Enrique.«
Der Galgenmann hatte das Gefühl, daß er das Gespräch jetzt rasch auf ein anderes Thema lenken müßte.
»Wir hatten Sie noch nicht so bald erwartet, Boß.«
»So, wann hattet ihr mich denn erwartet?«
»Erst nach Einbruch der Dunkelheit.«
»Und wo, ihr Idioten?« rief Wyatt und tat empört.
»Eine halbe Meile flußaufwärts.«
»Aha! Und was macht ihr hier?«
»Wir wollten uns die Zeit bis zur Dunkelheit hier an der Furt vertreiben.«
»Und fallt andere Leute an, statt eurer Aufgabe nachzukommen.«
Die Gesichter der fünf Banditen wurden länger und länger.
»Hört zu«, begann Wyatt jetzt wieder, »ihr sollt noch eine Chance haben. Ich habe eine wichtige Aufgabe für euch. Ihr kommt jetzt sofort mit nach Martini.«
»All right, Boß«, entgegnete Enrique aufatmend, in unterwürfigem Ton.
»Ich habe dort etwas zu erledigen.«
»In Ordnung, Boß.«
»Bis wir in die Nähe der Stadt kommen, reitet ihr vor mir her. Und dann bleibt ihr in meinem Rücken. Es hält sich ein Mann in Martini auf, der unser Feind ist.«
Der Bluff war hundertprozentig geglückt.
Sofort stiegen die fünf Bandideros auf ihre Gäule und trabten vor dem Marshal her nach Süden.
Wyatt blieb einige Pferdelängen hinter ihnen, so daß er sie gut im Auge behalten konnte.
Es gab keinen Zweifel darüber, daß er hier an eine Gruppe von mexikanischen Galgenmännern geraten war, die höchstwahrscheinlich auf irgendeinen Boten oder gar auf einen Anführer gewartet hatten, der von der Grenze kommen sollte. Es gehörte ja zu den Praktiken dieser Bande, die einzelnen Mitglieder nur soweit über ihre Aufgabe zu instruieren, wie unbedingt erforderlich war. Offensichtlich wußten diese fünf Banditen nicht, wer der Mann war, den sie zu erwarten hatten.
Wer mochte dieser Mann sein?
Wyatt mußte sie zunächst hier wegbekommen, um allein zurückzukehren. Denn diesen Reiter würde er selbst empfangen. Zuvor aber wollte er im Schutz dieser fünf »Freunde« versuchen, Kilby in Martini aufzuspüren.
Der Gedanke an den geheimnisvollen Reiter, der aus den Staaten kommen wollte, und den die Galgenmänner offensichtlich fürchteten, beschäftigte den Marshal so sehr, daß ihm der Ritt nach Martini wie im Fluge verging.
Es war dunkel geworden, als Enrique auf einmal sein Pferd anhielt und sich umwandte.
»Da drüben ist die Stadt, Boß!«
»Ja, ich weiß, ihr bleibt jetzt hinter mir, klar?«
»All right, Boß!«
Sie trabten der Stadt entgegen.
Die Hauptstraße war breiter noch als drüben in einer der Westernstädte und von weißgekalkten meist eingeschossigen Häusern flankiert.
Nicht weit vom Stadteingang entfernt, auf der linken Straßenseite, sah der Marshal aus einem Haus hellen Lichtschein bis weit über die Straße fallen.
Das mußte eine Cantina sein.
Er hielt kurz davor sein Tier an und sprang aus dem Sattel.
Enrique war sofort bei ihm. Wyatt warf ihm die Zügelleinen zu.
»Ihr wartet draußen vor der Tür!«
Der Galgenmann nickte.
Wyatt trat im Schlagschatten des fahlen Mondlichts auf die Cantina zu und blickte in eines der Fenster.
Sofort zuckte er zurück.
Drüben in einer Grotta saßen drei Männer an einem kleinen Tisch.
Zwei hatten ihm den Rücken zugekehrt, das Gesicht des dritten aber konnte er deutlich sehen und hatte es sofort erkannt.
Phineas Clanton!
Wyatt stand zwischen Fenster und Hausecke an die Wand gepreßt, und das Blut hämmerte ihm bis in die Schläfen.
Phin! Also auch hier stieß er wieder auf diesen Mann!
Wyatt trat etwas aus dem Schlagschatten des Hauses heraus und winkte Enrique heran.
»Komm her, Enrique! Da drüben in der Grotta sitzen drei Männer. Sieh dir den an, der uns das Gesicht zukehrt, und sag mir, ob du ihn kennst.«
Enrique nickte, trat lautlos an die Adobewand heran und schob sich dann langsam bis zum Fenster vor. Kaum hatte er einen Blick hineingeworfen, als er zurückzuckte.
»Natürlich kenne ich ihn, Boß.«
»Wer ist es?«
Da bleckte der Bandit seine überlangen gelben Zähne und grinste. »Sie wollen mich auf die Probe stellen, Boß.«
»Wer ist es?«
»Wer soll es schon sein? Sie kennen ihn so gut wie ich. Und wir nennen doch keine Namen.«
»Ich habe dich gefragt, wer er ist!«
»Well, es ist der Boß… von der Cantina da.«
Sollte Enrique den Desperado nicht erkannt haben? Sollte er einen anderen Mann meinen?
Wyatt brachte ihn noch einmal ans Fenster und wies jetzt mit dem Finger auf Phin.
»Well, Boß, er ist der Besitzer dieser Cantina.«
Sollte das die Möglichkeit sein! Phin als Besitzer einer mexikanischen Cantina. Ausgeschlossen war es nicht. Wyatt traute dem Bruder Ikes alles zu.
»Und die beiden, die neben ihm sitzen?«
»Ich kenne nur einen von ihnen«, entgegnete Enrique.
»Und wer ist das?«
»Gil.«
Gilbert? Da kam dem Marshal ein Gedanke. Sollte es sich bei diesem Burschen um Gilbert Morrison handeln? Den Bruder Judys, den die Banditen damals in Nogales gesucht hatten?
Wyatt beschloß, auf den Busch zu klopfen.
»Kennt ihr hier alle Gilbert Morrison?«
»Ich weiß nicht, ob die anderen ihn kennen. Ich erkenne ihn jedenfalls sogar von hinten«, entgegnete Enrique.
Der Mann, der da bei Phin Clanton am Tisch saß, war also Gilbert Morrison, der Sohn der Wäscherin aus Nogales.
»Alles unsere Freunde?« sagte Wyatt leise, wobei er in das Gesicht Enriques sah. Er glaubte, in dessen Augen plötzlich Argwohn aufflackern zu sehen. Um jeden Verdacht zu zerstreuen, erklärte er: »Ich habe mit Phin nachher noch zu sprechen. Und mit Gil auch. Dazu brauche ich euch nicht. Erst aber muß ich noch den anderen Mann suchen.«
Der Argwohn verflog sofort wieder aus dem Gesicht des Banditen.
Es schien also nun mit großer Sicherheit festzustehen, daß Phineas Clanton zu den Galgenmännern gehörte! Eine Feststellung, die den Marshal zwar nicht allzusehr überraschte, aber doch sehr bedrückte. Und er hätte nicht einmal sagen können, warum. Hatte er doch schon immer angenommen, daß die Clantons zu den Galgenmännern gehörten, ja, daß sie diese anführten, denn daß Phin – wenn überhaupt – keine untergeordnete Rolle bei dieser Banditenorganisation spielen würde, war klar.
Ebenso schlimm war die Feststellung, daß dieses Martini ein zumindest genauso gefährliches Bandennest war wie Costa Rica, das der Marshal erst vor kurzer Zeit ausgehoben hatte.
Die gutgläubige Conchita aus dem Gold Dollar Saloon in Nogales hatte ihm wirklich einen goldenen Fingerzeig gegeben. Und selbst wenn er Kilby hier nicht fassen konnte, so hatte er durch diesen Hinweis doch von einem gefährlichen Schlupfwinkel der Galgenmänner erfahren. Denn wer würde die Graugesichter je hier gesucht haben? Sie wußte genau, daß niemand so leicht auf den Gedanken kommen konnte, sie in diesem mexikanischen Nest, nicht einmal allzuweit von der mexikanischen Grenze entfernt, zu suchen.
Da stand er nun unter dem sternbesäten Himmel Mexikos im fahlen Mondlicht an der Wand einer Cantina in Martini. Phin Clanton war da, und den von Mutter und Schwester vermißten Gilbert Morrisson hatte er auch entdeckt.
Vielleicht waren noch andere Männer hier, die er kannte und niemals hier vermutet hätte? Wyatt wandte sich an Enrique.
»Wo ist der nächste Mietstall?«
Der deutete auf den Hof nebenan: »Gleich hier. Er gehört Pedro Piola.«
Wyatt flüsterte: »Komm!«
Sie zogen sich in die Sättel und ritten zum Mietstall. Mitten im Hof hielten sie.
Wieder warf der Marshal dem Banditen seine Zügelleinen zu und ging zum Stall hinüber, durch dessen offene Tür ein Lichtschein fiel.
Links in einer der Boxen arbeitete ein kleiner Mann mit glattem schwarzem, in der Mitte gescheiteltem Haar, grauem Hemd und schwarzer Boleroweste. Er trug schwarze enganliegende Hosen, die in halbhohen Schaftstiefeln steckten.
Eine Waffe trug er nicht.
»Señor Piola!« rief Wyatt ihn an.
Der Mann wirbelte herum und spannte die Hände um die angehobene Mistgabel.
Wyatt schüttelte lächelnd den Kopf.
»Keine Aufregung, Señor. Ich möchte nur ein Pferd kaufen.«
»Ein Pferd?« Über das Gesicht des Mietstallinhabers flog ein freundliches Lächeln. »Ein Pferd? Natürlich! Señor, kommen Sie nur herein. Ich habe eine ganze Menge Pferde zu verkaufen, die besten, die es weit und breit gibt. Sie müßten sehr weit reiten, wenn Sie auch nur ein annähernd so gutes Tier…«
Wyatt hob abwehrend die Hand: »Lassen Sie mich nur sehen. Sind die alle zu verkaufen?«
»Nein, nicht alle.«
»Sagen Sie mir doch einfach, welche nicht zu verkaufen sind«, forderte Wyatt ihn auf.
»Ja.« Der Mexikaner deutete mit dem anderen Ende der Mistgabel auf das Pferd, in dessen Box er gerade gearbeitet hatte. »Hier, der Hengst nicht. Der gehört mir.«
»Und, weiter?«
»Da, der dritte, der Rotfuchs, der ist auch nicht zu verkaufen. Der gehört einem Mann von Primavera.«
Wyatt war mit ihm an den Boxen entlanggegangen und blieb plötzlich hinter einem braunen Wallach stehen.
»Und der hier, ist der verkäuflich?«
Der Mexikaner zog die Schultern hoch und bleckte die Zähne.
»Ich weiß nicht, vielleicht.«
»Gehört er Ihnen?«
»Nein. Aber ich glaube, ich könnte mit dem Besitzer sprechen, wenn Ihnen das Tier gefällt. Schönes Pferd, nicht wahr?« fragte er lauernd.
»Hm«, tat Wyatt nachdenklich, »vielleicht sollte ich besser selbst mit dem Mann sprechen? Sie bekommen zehn Prozent.«
»Zwanzig«, meinte der Händler mit süßlichem Lächeln.
»Gut. Ich will nicht mit Ihnen streiten. Wo finde ich den Mann?«
»Er heißt Cortez und ist im Mexiko-Hotel abgestiegen. Das liegt nur ein paar Häuser weiter auf der linken Seite.«
Wyatt nahm ein Geldstück aus der Tasche und reichte es dem Mietstallinhaber.
Der spuckte darauf und schob es in die Westentasche.
»Vielen Dank, Señor. Ich hoffe, es kommen noch etliche dazu.«
»Möglich.«
Wyatt ging zu den Banditen zurück und zog sich in den Sattel.
Als sie das Tor hinter sich hatten, hielt er an und stieg sofort wieder vom Pferd.
»Hör zu, Enrique, du nimmst meinen Falben mit. Und zwar zum Mexiko-Hotel. Ihr bleibt dort vor der Tür. Wenn ich Ärger bekomme, rufe ich euch. Klar?«
»In Ordnung, Boß.«
Wyatt sah den davontrabenden Tramps nach, wandte sich um und stahl sich in den dunklen Hof zurück.
Was er vermutet hatte, war eingetroffen. Der schleimige Piola hatte den Stall verlassen und war in dem Augenblick, in dem Wyatt den Hof wieder betrat, hinten durch eine kleine Pforte hinausgegangen.
Wyatt folgte ihm sofort. Als er die Pforte hinter sich hatte, befand er sich in einer schmalen Gasse.
Pedro Piola ging vor ihm her und wies ihm genau den Weg. Vor einem ummauerten Hof machte er halt, stieß das nur angelehnte Tor auf und schloß es hinter sich.
Die Mauer war nicht sehr hoch. Wyatt nahm einen kurzen Anlauf und schwang sich hinauf.
Von oben hatte er einen Blick über den ganzen Hof. Er sah drüben in der offenen Hoftür einen Mann stehen, dessen Konturen er deutlich durch das Licht, das aus dem Flur fiel, sehen konnte.
Es war Piola. Er sprach mit einem Mann, dessen Gesicht er aber verdeckte, so daß der Marshal ihn nicht sehen konnte.
Neben der Hoftür wurde jetzt eines der Küchenfenster hochgeschoben. Eine Frau leerte eine Schüssel mit Wasser aus.
Der Missourier hatte sich dieses Geräusch sofort zunutze gemacht, indem er sich von der Mauer herunterließ.
Dicht an die Wand gepreßt blieb er stehen.
Da gingen die beiden Männer weiter in den Flur hinein. Wyatt schlich dicht an der linken Anbaumauer entlang, auf die Rückseite des Hauses zu und erreichte die Steintreppe, die zur offenen Hoftür führte, gerade in dem Augenblick, als die beiden Männer sich anschickten, die Treppe hinaufzugehen. Wyatt folgte ihnen sofort. Daß er dabei über den beleuchteten Flur gehen mußte, war nicht zu vermeiden.
Die beiden waren jetzt im Obergeschoß angelangt, und der Marshal betrat vorsichtig die Treppe. Glücklicherweise waren es Steinstufen, wie sie meist in diesen mexikanischen Häusern, die übrigens nur ein Obergeschoß haben, eingebaut wurden. Auf halber Höhe blieb der Marshal stehen und lauschte.
Oben wurde jetzt an eine Tür geklopft. Bis zur Treppe hin hörte der Marshal, daß »Herein« gerufen wurde.
Dann wurde geöffnet, und die Männer flüsterten etwas miteinander.
Gleich darauf kamen sie zurück.
Wyatt war die Treppe wieder hinuntergegangen und sah sich im Flur um.
Die linke Tür führte in den Schankraum, und rechts die Tür mochte in eine Nebenstube des Hotels führen. Wyatt öffnete sie, schob sich in den dunklen Raum, ließ die Tür einen Spaltbreit offen und blieb lauschend stehen.
Jetzt waren die Schritte der Männer auf der Treppe. Voran kam Pedro Piola. Der Mann, der ihm folgte, hatte eine grüne Schürze um und schien der Wirt des Hotels zu sein.
Und immer noch waren Schritte auf der Treppe zu hören.
Mit äußerster Spannung erwartete der Marshal den Mann, der jetzt gleich auf der letzten Treppenstufe erscheinen mußte.
War es der langgesuchte Mörder des Sheriffs Cornelly? Der gleiche Mann, der die Spielerin Laura Higgins vor dem Tombstoner Crystal Palace niedergeschossen hatte? Der Mann, der ihn in der vergangenen Nacht oben in Nogales um ein Haar mit einem Gewehrschuß getötet hätte? War es der Mörder Kilby?
War der Marshal endlich am Ziel?
Das erste, was er von dem Mann sah, war eine braune Faust, die ein Gewehr hielt! Und dann sah er den ganzen Mann. Er war mittelgroß, kräftig, breit, untersetzt, hatte einen vierkantigen Schädel und einen martialischen, ungepflegten Schnurrbart. Der Melbahut saß ihm weit im Genick, und seine Jacke war ebenso ausgefranst und fadenscheinig wie seine Hose.
Das war der Mann, den der Minenarbeiter Duffy und den auch Laura Higgins beschrieben hatte! Es war der Mörder Kilby!
»Wir gehen am besten dort hinaus, Jack.«
Und jetzt hörte der Marshal zum erstenmal die Stimme Kilbys. Sie klang rauh, spröde und hohl.
»Wie sah der Mann aus?« forschte er.
Piola zog die Schultern hoch und hob die Hände. »Ich kann es nicht genau sagen. Es war ziemlich dunkel im Stall.«
»War er groß?«
»Sehr groß. Er mußte sich bücken, als er durch die Stalltür ging.«
»Und weiter?« forschte Kilby ungeduldig.
»Was weiter? Ich dachte ja im Augenblick noch nicht daran, daß ich ihn beobachten müßte.«
»Was trug er für Waffen?«
»Das kann ich nicht sagen.«
»Seine Kleidung, wie sah die aus? Trug er einen Anzug oder trug er nur Weste und Hemd?«
»Er trug einen schwarzen Anzug.«
»Einen schwarzen Anzug also. Und seinen Waffengurt hast du nicht gesehen?«
»Nein.«
»Sein Gesicht?«
»Er sah gut aus. Braun und… es tut mir leid, Jack, aber ich kann mich wirklich nicht an Einzelheiten erinnern.«
Wyatt konnte Kilbys Gesicht genau beobachten. Es war hart, wie aus Granitstein geschlagen. Nichts von dem, was er jetzt dachte, war in ihm zu sehen.
Da meinte der Hotelinhaber: »Aber, wenn doch Enrique und die anderen bei ihm waren, Jack! Pedro kann sich doch geirrt haben!«
»Nein, ich habe mich nicht geirrt«, beteuerte der Mietstallbesitzer. »Enrique war bestimmt dabei. Manuelo habe ich auch erkannt. Diese Hunde sind Verräter!«
»Wer soll denn der Freund sein?« fragte der Wirt.
Jackson Kilby sprach den Verdacht, der hinter seiner breiten niedrigen Stirn nistete, nicht aus.
Wyatt wartete, weil er hoffte, noch irgend etwas erfahren zu können.
Aber da hatte der Mörder sich offenbar schon entschlossen.
»Ich gehe durch den Hof!«
Das war der Augenblick, in dem der Missourier handeln mußte. Er schob die Tür auf und trat auf den Gang.
»Kilby!« Metallisch drang der Ruf durch den Korridor.
Der Mörder stand wie versteinert da.
Pedro Piola war herumgefahren, starrte den Marshal fassungslos an.
Der Hotelinhaber brauchte mehrere Sekunden, ehe er verstand.
Ganz langsam wandte Kilby sich jetzt um. Der Blick seiner farblosen leeren Augen flog zu dem Marshal hinüber und blieb an dessen linken Hand haften.
Wyatt behielt den Verbrecher scharf im Auge. Vor allem die Hand, die das Gewehr hielt.
Plötzlich hob Kilby den Blick.
Um seinen kalten, grausamen Mund zuckte ein dünnes Lächeln.
»Gratuliere, Marshal«, stieß er heiser durch die Zähne. »Ich hätte nicht gedacht, daß Sie nach dem bleiernen Gruß, den ich Ihnen heute nacht schickte, noch einmal aufstehen würden.«
»Sie haben eben nicht weit genug gedacht, Kilby«, entgegnete der Marshal sehr schroff.
Die Anspannung, die eben noch auf Kilby gelegen hatte, fiel plötzlich von ihm ab.
Er gab auf. Weil er wußte, daß er im offenen Kampf gegen diesen Mann, der ihm da gegenüberstand, nichts zu bestellen hatte.
»Lassen Sie die Flinte fallen, Kilby, die brauchen Sie nicht mehr.«
Die Hand des Mörders öffnete sich, und das Sharpsgewehr des kleinen Tombstoner Mietstallinhabers Carlo fiel krachend auf die steinernen Fliesen.
Der Marshal ging mit sporenklirrenden Schritten auf den Verbrecher zu.
In diesem Augenblick versuchte Piola rasch durch die Hoftür zu verschwinden.
Klick! Das harte Knacken eines gespannten Revolverhahns drang durch den Korridor.
Der Pferdehändler blieb stehen.
»Nur nicht so eilig, Mister. Ich habe noch etwas mit Ihnen zu besprechen. Schließlich hatten wir doch einen Handel vereinbart.«
Wyatt hatte den Buntline Special in der Linken und tastete mit der Rechten Kilby nach weiteren Waffen ab. Er fand nur das Bowiemesser, das er in seinen eigenen Gurt schob. Das Sharpsgewehr nahm er in die Rechte.
»Los, auf die Straße! Alle drei. Der Hotelboß geht voraus. Dann kommt der Roßtäuscher. Kilby macht den Schluß.«
Der Wirt und Piola waren zu eingeschüchtert, als daß sie es gewagt hätten, gegen den Marshal aufzumucken.
Wyatt hatte vorhin überlegt, ob er abwarten sollte, bis Kilby das Hotel verlassen hatte, um ihn dann draußen zu stellen, hatte den Gedanken aber wieder fallen lassen, da er den Banditen in der Dunkelheit doch nicht so gut hätte beobachten können. Dafür mußte er aber nun diese beiden Männer mit in Kauf nehmen, mit denen er nicht gerechnet hatte. Konnte er es wagen, die drei hinaus auf die Straße zu bringen? Er mußte immerhin damit rechnen, daß sie zu den Galgenmännern gehörten! Zumindest aber Enrique, Manuelo und den anderen bekannt waren. Konnte er es riskieren, sich noch einmal – wie schon damals drüben in Costa Rica – mit einer ganzen Stadt von Banditen anzulegen?
Die Absicht hatte er nicht… aber er hatte auch keine andere Wahl.
Enrique und die vier Tramps hatte er mit in die Stadt nehmen müssen, um sie erst einmal oben vom Fluß wegzubekommen, weil er selbst den großen Boß von drüben abzufangen gedachte, und weil die Männer ihn auf kürzestem Weg zur Stadt führen konnten, wo er ihre Hilfe zu nutzen gedachte.
Über die Gefahr, in die er sich begeben hatte, war er sich durchaus im klaren.
Wenn er jetzt mit den dreien auf die Straße trat, brauchte Kilby nur zu rufen: Das ist Wyatt Earp! Dann war draußen der Teufel los.
Wyatt konnte sich des Gefühls nicht erwehren, daß jetzt etwas Fatales geschehen würde. Aber er konnte nicht länger warten.
Kaum hatten die beiden Vorangehenden die Haustür verlassen, als von der Straße her Schüsse auf die Tür zupeitschten.
Kilby wurde zurückgeschleudert, und er prallte gegen die Flurwand.
Wyatt packte ihn, zerrte ihn zurück und stieß die Tür zu.
Auf der Straße waren wüste Schreie laut geworden, und mit klatschendem Geräusch schlugen immer neue Geschosse in das Holz der Tür.
Wyatt hatte sich tief auf den Boden geduckt und zerrte Kilby durch den Flur zur Hoftür. Vorn auf der Straße wurde weitergeschossen.
Der Marshal hatte den ächzenden Mann auf die Arme genommen und schleppte ihn über den Hof.
Das Tor war verschlossen.
Er trat mit dem Stiefel den hölzernen Riegel zurück und tat einen Schritt auf die Gasse hinaus.
Hier war alles dunkel.
Die Schlagschatten der gegenüberliegenden Häuser fielen bis an die Hofmauer.
Der Marshal überquerte die Gasse und blieb in einer engen Häuserrinne stehen, wo er Kilby auf den Boden niederließ.
Dann rannte er zurück und zog das Tor von der Innenseite des Hofes aus zu, schwang sich über die Mauer und lief zu Kilby zurück.
Schwer atmend lag der Mörder am Boden.
Wyatt kniete neben ihm und lauschte in die Gasse.
Da, jetzt kamen sie drüben aus der Tür des Mexiko-Hotels und stürmten in den Hof.
Und dann hörte er Enriques heisere Stimme: »Er muß doch hier sein!«
»Nein«, rief eine andere vom Tor her. »Das Tor ist verschlossen!«
»Na und?«
»Er kann doch nicht über die Mauer geflohen sein! Das Tor ist von innen verschlossen!«
»Also, dann durchsucht den Stall und den Schuppen drüben!«
Wyatt wollte Kilby wieder aufnehmen, aber der keuchte: »Lassen Sie mich liegen…«
»Ich muß Sie zu einem Arzt bringen.«
»Zwecklos, ich habe zwei Kugeln im Leib. Mich rettet wohl kein Teufel mehr.«
»Schweigen Sie!«
Wyatt hob ihn auf und schleppte ihn durch die Häuserrinne auf einen freien Platz, der im Hintergrund von einem flachen Bau abgeschlossen wurde. Scharfer Schafgeruch drang dem Marshal entgegen.
Er eilte im Schatten der Anbauten auf den Schafstall zu und schob mit der Schulter die Tür auf.
Der Stall war anscheinend leer. Wyatt ließ Kilby auf den Boden nieder, riß für einen Moment ein Zündholz an, sah links einen Strohhaufen liegen, den er heranzog und zu einem Lager für den Verwundeten herrichtete.
Kilby schien immer noch bei Besinnung zu sein.
»Wissen Sie, wo ich hier einen Arzt finde?« erkundigte sich der Marshal.
»Ich habe Ihnen… gesagt…, daß ich keinen Arzt mehr brauch…«
»Well, ich hole trotzdem einen Arzt.«
Als der Missourier den Stall verlassen wollte, sah er zwei Männer drüben von der Gasse her in den breiten Hof kommen.
Er kniete am Boden nieder, zog die Stalltür etwas heran und schob den Revolverlauf zwischen den Spalt.
Kilby röchelte neben ihm auf seinem Strohlager.
Wenn die beiden Männer nahe genug herankamen, mußten sie das Röcheln hören.
Sie hatten jetzt die Mitte des Hofes erreicht, blieben stehen, sahen sich nach allen Seiten um, und dann lief einer von ihnen auf die Anbauten zu, während der andere den niedrigen Schafstall musterte, ohne jedoch näherzukommen.
Wyatt hatte die Zähne fest aufeinander gepreßt und fixierte den Mann scharf.
In welch höllische Lage war er da geraten! Er hatte ein Rudel von Banditen hinter sich – und neben ihm lag sterbend der Mörder Kilby.
Ich muß einen Arzt suchen, hämmerte es in seinem Hirn.
Da kam der andere Mann von den Anbauten zurück, und zusammen verließen die beiden den Hof.
Wyatt wandte sich nach Kilby um und fragte, während er den Colt wegsteckte: »Wissen Sie wirklich nicht, wo ein Arzt wohnt?«
»Ich weiß es schon, aber ich brauche keinen! Ich will keinen! Ich…?ich… ich…« Seine Stimme wurde plötzlich schwächer und erstarb in einem Wimmern.
Wyatt hielt die Fäuste zusammengepreßt und starrte auf den dunklen Körper, der auf dem hellen Stroh lag.
Da war Kilbys Stimme wieder da. »Ich… will… nicht sterben…«, röchelte er auf einmal in völlig verändertem Ton. Plötzlich also schien ihn die Todesangst gepackt zu haben. Er hob seine Hände und krallte sie um den rechten Unterarm des Marshals!
»Earp! Sie können mich hier nicht verrecken lassen, Mensch!«
Wyatt schob die Arme unter den schweren Körper des Verwundeten und hob ihn auf.
Einen Augenblick stand er gebückt in der Tür des Schafstalles und beobachtete den Hof.
»Wo wohnt der Arzt?« flüsterte er wieder.
»Oben an der Hauptstraße, schräg gegenüber vom Hotel!« ächzte Kilby.
Wie sollte er da hinkommen? fragte sich Earp.
Wenn er den Hof verließ, lief er Gefahr, von einem Späher der Galgenmänner gesichtet und augenblicklich niedergeschossen zu werden. Mit dem Verwundeten auf den Armen war er nämlich kaum zu einer Gegenwehr fähig.
Aber er hatte keine Wahl! Er mußte dem schwerverwundeten Mann um jeden Preis Hilfe bringen.
Mit zusammengepreßten Zähnen verließ er die Tür und ging mit eiligen Schritten auf den tiefen Schatten des Anbaus zu.
Da öffnete sich am Haus eine Tür, und ein Mann trat heraus. Er hatte ein Gewehr in der Hand.
Wie angewachsen blieb der Missourier stehen.
»Warum gehen Sie nicht weiter!« krächzte Kilby, der mit stieren Augen in den Himmel blickte.
»Scht!«
»Was ist los?«
»Sie sollen leise sein«, flüsterte der Marshal und versuchte sich noch tiefer in die dunkle Nische einer Tür zu schieben.
Jetzt ging der Mann mit dem Gewehr quer über den Hof auf den Schafstall zu, stieß die Tür mit dem Fuß auf und schob das Gewehr voran.
Wyatt wartete.
Da kam der Mann zurück. Langsam ging er über den Hof, blieb in dessen Mitte stehen und sah sich um.
Jetzt! Jetzt muß er mich sehen!
Wyatt hatte den Kopf tief gesenkt, und Kilby verhielt sich im Augenblick ruhig.
Da hob der Mann das Gewehr und machte zwei Schritte vorwärts auf den Anbau zu.
Wyatt hatte die linke Hand unter Kilbys Körper weggezogen und sie auf den Revolverkolben gestützt.
Da blieb der Mann stehen, wandte sich um und ging zum Haus zurück. Die Tür fiel hinter ihm ins Schloß.
Auf der Stirn des Missouriers standen kleine Schweißperlen. Er verließ die Türnische und den Hausschatten, überquerte den Hofplatz und stand wieder in der Häuserrinne, durch die er vorhin gekommen war.
Lauschend verharrte er vorn an der Mündung der schmalen Gasse.
Drüben im Hof des Hotels wurde offenbar noch immer nach ihm gesucht. Türen flogen zu, Männer stießen Flüche aus, hölzerne Gegenstände wurden hin und her geschoben, und ein Hund jaulte kläglich.
Wyatt hatte etwas weiter links vom Hotel einen Zaun entdeckt, den er vielleicht übersteigen konnte. Er überlegte nicht lange, verließ die Häuserrinne und überquerte die Gasse.
Es war ein höllischer Augenblick, als er mit dem Mann auf den Armen in die Gasse trat. Wenn jetzt einer drüben neben dem Hoftor des Hotels gestanden hätte, wäre er dessen Kugeln ausgesetzt gewesen. Darum schob er sich mit dem Rücken an der Häuserfront entlang, bis er den niedrigen Zaun drüben vor sich hatte. Mit vier raschen Schritten überquerte er die Gasse, stieg mit dem Verwundeten in den Garten, eilte auf das Haus zu und bemerkte zu seiner Freude, daß links davon der Garten bis zur Straße hinaufführte.
Vorsichtig bewegte er sich an der Front des Hauses entlang, plötzlich stockte sein Fuß.
Vorn auf der Straße herrschte lebhaftes Hin und Her. Männer liefen über den Fahrdamm, stießen Haustüren auf, blickten in die Flure, kamen wieder heraus und rannten zurück.
Einer, der vorn am Garten vorbeihastete, hatte einen Revolver in der Hand.
Da röchelte Kilby: »Ich… will… nicht sterben!«
»Sie sollen still sein«, zischte ihm der Marshal zu.
»Ich will nicht… Ich will nicht…«
Schreckgeweitet waren die Augen des sterbenden Mörders.
Wyatt wußte, daß er sich in äußerste Gefahr begab, wenn er jetzt auf die Hauptstraße hinaustrat.
War der Mörder, den er da mit sich schleppte, es wert, daß er sein Leben für ihn in die Schanze schlug? Ganz sicher nicht. Aber das Mitleid mit dem schwerverwundeten Mann trieb den Missourier vorwärts.
Geduckt unter der schweren Last stand er an der Hausecke und lugte auf die Straße.
Im Augenblick war es ruhiger geworden.
Aber rechts vor dem Hof standen mehrere Männer. Das Licht, das aus den Fenstern drang, fiel bis weit über die Straße. Und zu allem Überfluß hatte einer von ihnen noch eine Fackel in der Hand, die ihren tanzenden gelbroten Lichtschein bis auf die gegenüberliegende Häuserwand warf.
In einem dieser Häuser also mußte der Arzt wohnen.
Kilbys Kopf sank über den rechten Ellbogen des Marshals zurück, leise röchelnd drang es nun aus seiner Kehle: »Schnell, Earp…«
»Wo wohnt der Arzt?« flüsterte Wyatt dicht an seinem Ohr.
»Drüben!«
»Wenn ich vor dem Hotel stehe, ist es rechts oder links gegenüber?«
»Rechts«, ächzte der Verletzte.
Auch das noch!
Dann mußte er also quer über die Straße und somit den Lichtschein vor dem Hoteleingang passieren.
Das wäre Selbstmord gewesen!
Wyatt überlegte, ob er den Mann hier nicht niederlegen sollte, um allein zu versuchen, auf einem Umweg den Arzt zu erreichen und ihn dann herzuschicken.
Aber bis dahin verging zu viel Zeit, eine halbe Stunde vielleicht!
Schon hatte er sich entschlossen, mit dem Mann über die Straße zu laufen, um drüben in eines der gegenüberliegenden Häuser zu gelangen, als mehrere Männer vom Hoteleingang her auf die Straße kamen und langsam vorwärtsschritten.
Er erkannte sie sofort: Es waren Enrique und seine Leute.
Zurück konnte er nicht, denn auch hinten in der Gasse hörte er jetzt Schritte. Und hier im Garten gab es kein Versteck. Der Zaun war zu niedrig, nirgends gab es eine Deckung.
Nur noch Sekunden konnten vergehen, bis sie ihn hier gestellt hatten.
Die Banditen waren jetzt bis auf zwanzig Yard herangekommen.
Da ächzte der Verwundete schwer, röchelte und stieß heiser hervor: »Ich will… nicht sterben…«
Die Outlaws waren stehengeblieben, ihre Hände zuckten zu den Waffen.
Wyatt ließ den Verwundeten niedergleiten, riß beide Revolver aus den Halftern und schnellte hinter der Hausecke hervor.
Sofort peitschte ihm ein Schuß entgegen. Manuelo hatte ihn abgegeben.
Wyatt feuerte zurück. Der Mann, den er vor der Schlange gerettet hatte, brach in die Schulter getroffen an der Hauswand zusammen.
Dann tauchte Enrique wie aus dem Boden gewachsen vor Wyatt auf, stieß ihm den Colt entgegen und geiferte: »Stirb, Gringo!«
Wyatt riß den Stecher durch.
Der Galgenmann wurde von dem Geschoß herumgewirbelt, schwankte zurück gegen eine Tür, an der er niederrutschte.
Rodrigo hatte sich entsetzt abgewandt und flüchtete auf die andere Straßenseite zu, plötzlich aber warf er sich herum und feuerte auf den Missourier. Seine Kugel verfehlte ihr Ziel. Dafür aber warf ihn das blitzschnell abgefeuerte Geschoß des Marshals sofort nieder.
Die beiden anderen rannten zurück und machten Halt, als sie zwei Männer aus der Cantina kommen sahen.
Einer von ihnen war Phin Clanton. Wyatt erkannte ihn sofort.
Nur etwa vier Yard stand der Marshal von der Hausecke entfernt: mit gespreizten Beinen, vorgestreckten Revolvern und zusammengebissenen Zähnen.
Wenige Sekunden waren erst seit Beginn des Gunfights vergangen.
Die vier Banditen blieben stehen.
Auch Phin hatte den Marshal erkannt. »Das ist ja eine Überraschung!« blecherte er ihm höhnisch entgegen. Er hatte keine Waffe in der Hand und hakte die Daumen jetzt hinter den Waffengurt. Im verlöschenden Fackelschein konnte Wyatt sein Gesicht deutlich erkennen.
»Rechnen Sie sich noch eine Chance aus, Earp?« bellte er über die Straße.
Wyatt spannte knackend die Hähne.
»Ja, Phin. Und du bist der erste, den ich treffen werde!«
»Sie haben Nerven, Mensch. Allein, von einem Dutzend Leuten umzingelt!«
Da rief Piola, der neben Phin stand: »Geben Sie auf, Earp! Verdammt noch mal, Sie haben eben Pech gehabt! Ihr Weg ist zu Ende.«
Wyatt spürte, wie der Schweiß ihm durch die Brauen in die Augen zu rinnen begann.
Wenn jetzt einer von der Bande hinter ihm auftauchte, war alles zu Ende.
Und drüben an der Hausecke lag der sterbende Mann!
Genau in dieser mörderischen Minute geschah es: hinter den Banditen hallte plötzlich eine schneidende Stimme über die Straße, die klirrend an die Ohren der Desperados drang: »Wo willst du liegen, Phin?«
Die Desperados standen wie angewachsen da. Und Phin zuckte zusammen. Zu genau kannte er die Stimme des Georgiers Holliday, als daß er jetzt hätte überlegen müssen, wer da hinter ihm stand.
»Hell and devils!« entfuhr es ihm.
Der Mann rechts vorm Hoteleingang hatte die Fackel fallen lassen. Auch er schien die Stimme des Georgiers zu kennen.
Doc Holliday! Wie kam er hierher? Ausgerechnet in dieser Minute!
Wilde Freude loderte im Herzen des Marshals auf.
»Doc!« rief er.
»All right, Marshal! Wir sind hier!« rief der Georgier zurück.
Wir? Hatte er etwa Luke Short mitgebracht?
Da brüllte einer der Banditen, der rechts neben Phin stand: »Alles Bluff, Leute!«
»Halts Maul!« herrschte Phin ihn an, »und nimm deine Pfoten hoch. Hinter dir steht Doc Holliday!«
Da fiel dem Outlaw der Revolver aus der Hand. Langsam hob einer nach dem anderen die Hände.
Nur Phin nicht. Er stand breitbeinig da und starrte dem Marshal finster entgegen.
Wyatt ging mit schnellen Schritten auf ihn zu. Einen Yard vor ihm blieb er stehen und funkelte ihn aus harten Augen an.
»Du gehörst also zu der Bande?«
»Ich weiß nicht, von welcher Bande Sie sprechen, Marshal!«
»Was suchst du denn hier?«
»Da drüben ist meine Schenke.«
»Deine Schenke?«
»Ja, ich habe sie vor ein paar Wochen im Spiel gewonnen.«
»So?«
Wyatt entwaffnete die Outlaws, die vor ihm standen, und schleuderte ihre Revolver weit hinter sich.
»Los, da drüben an die Hauswand, wo ich euch sehen kann!«
Seine Augen suchten im Dunkel hinter dem Saloon die Spieler.
»Señor Earp! Das geht nicht gut aus. Wir haben hier in der Stadt sehr viele Freunde.«
Klick! machte es da hinter ihm. Und jetzt tauchte der Spieler im zuckenden Licht der am Boden verlöschenden Fackel auf. Er trug wie immer seinen schwarzen Anzug, ein weißes Rüschenhemd, eine schwarze Krawatte und seinen schwarzen Kaliforniahut. Breitbeinig stand er da, in jeder seiner vorgestreckten Fäuste einen seiner vernickelten Frontier Revolver vom Kaliber 45.
»Das haben wir gern, Geronimo, wenn du von Freunden sprichst! Stell dich da hinüber, sonst bist du gleich bei deinen Freunden in der Hölle!«
Der Hotelwirt trottete über die Straße und blieb drüben bei den Männern stehen, die mit erhobenen Händen an der weißgekalkten Hauswand verharrten.
Es war jetzt still geworden auf der breiten Hauptstraße von Martini.
Wyatt rechnete damit, daß jeden Augenblick aus irgendeinem Rattenloch weitere Bandenmitglieder auf die Straße stürzen würden, um ihre Kumpane zu befreien. Sie rechneten höchstwahrscheinlich damit, daß noch eine Reihe Helfer des Marshals im Dunkel verborgen sein könnten.
Wyatt winkte dem Spieler.
Holliday kam heran und nickte dem Freund zu.
Wyatt sagte: »Hinter der Hausecke liegt Kilby. Er ist schwer verwundet.«
»Ich werde nach ihm sehen.« Sich umwendend rief der Spieler laut: »Luke, Sie bleiben mit Ihren Leuten noch auf den Plätzen!«
Er schob die Revolver in die Halfter zurück und ging auf die Hausecke zu, hinter der der sterbende Mörder lag. Er schleppte ihn zum Hotel, wo er ihn in einem Hinterzimmer auf einen Tisch legte und nach seinen Verletzungen sah.
Ein einäugiger Bursche, der aus einem der Häuser gekommen war, trat auf den Marshal zu.
»Hier nebenan gleich ist das Gefängnis, Mr. Earp. Es ist gut, daß Sie mit der Bande aufräumen. Ich bin überzeugt davon, daß die meisten sich schon davongemacht haben…«
Wenige Minuten später waren Phineas Clanton und seine »Freunde« im Jail eingesperrt. Auch die Verwundeten waren ins Gefängnis gebracht worden, wo sie jetzt von dem alten Dr. Fernandez behandelt wurden. Tote hatte der Kampf nicht gefordert.
Wyatt fand den Georgier im Hinterzimmer des Hotels. Der Spieler hatte beide Hände auf die Tischplatte gestützt und blickte in das eingefallene Gesicht des Mörders.
Als Wyatt neben ihn trat, sagte er leise: »Er stirbt. Ich kann ihm nicht mehr helfen. Die Kugeln waren beide tödlich.«
Es dauerte noch fast eine Viertelstunde, bis der Sheriffsmörder sein Leben ausgehaucht hatte.
Der Spieler ging hinaus.
Wyatt folgte ihm und reichte ihm draußen auf dem Gang die Hand.
»Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Doc.«
»Am besten gar nichts«, erwiderte der Spieler und schob sich eine seiner langen russischen Zigaretten zwischen die Lippen.
»Wie haben Sie mich so schnell gefunden?«
Durch eine Tabakwolke hindurch entgegnete der Georgier: »Da oben in Nogales gibt es ein hübsches Mädchen namens Conchita…«
»Und Luke Short, wo ist der?«
Der Spieler lächelte hintergründig. »Luke? Der ist da, wo er hingehört. Sie selbst haben doch dafür gesorgt, daß er Sheriff von Tombstone geworden ist.«
Obgleich der Marshal keineswegs davon überzeugt war, daß Phin im Jail von Martini sicher untergebracht war, verließ er mit Doc Holliday kurz darauf die Stadt, um den geheimnisvollen Reiter der Galgenmänner am Lue Lon River abzufangen.