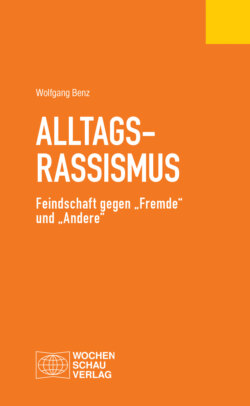Читать книгу Alltagsrassismus - Wolfgang Benz - Страница 11
Integration statt Ausgrenzung
ОглавлениеDeutschland ist de facto seit 1945 ein Einwanderungsland, das als Territorium unter alliierter Besatzung in den vier Zonen, die von den USA, Großbritannien, der Sowjetunion und Frankreich regiert und verwaltet wurden, etwa zwölf Millionen Heimatvertriebene und Flüchtlinge aus den verlorenen Ostgebieten aufnehmen musste. Auf Beschluss der Alliierten mussten die unfreiwilligen Zuwanderer aus Ostpreußen, Schlesien, Pommern sowie anderen ehemals deutschen Gebieten östlich der Oder und Neiße, aus der Tschechoslowakei, Ungarn und weiteren Territorien, in denen ihre Vorfahren als „Volksdeutsche“ seit Jahrhunderten gelebt hatten, in die deutsche Nachkriegsgesellschaft eingegliedert werden. Dieser Integrationsprozess gelang trotz erheblicher kulturell und emotional bedingter Reibungen zwischen Eingesessenen und Ankommenden in erstaunlich kurzer Zeit innerhalb von zehn bis fünfzehn Jahren. Die ankommenden Flüchtlinge und Heimatvertriebene galten nicht als Immigranten. Sie waren zwar Deutsche, wurden aber als unerwünschte Fremde wahrgenommen. Druck der Besatzungsmächte, nicht Solidarität mit den Opfern des Hitlerkrieges, war der Motor der Integration.
Die Teilung Deutschlands ab 1949 führte dann zu einem Flüchtlingsstrom aus der DDR, der bis zum Bau der Mauer 1961 auf 4,3 Millionen anstieg und erhebliche Integrationsleistungen der Bundesrepublik erforderte. DDR-Flüchtlinge erhielten sofort die BRD-Staatsbürgerschaft, waren auf dem Arbeitsmarkt willkommen und genossen soziale Eingliederungshilfen. Mit der Anwerbung von „Gastarbeitern“ wurde seit Ende der 1950er Jahre dem Arbeitskräftemangel entgegengesteuert, nach Italienern, Spaniern, Portugiesen, Griechen kamen als letzte große Gruppe Türken. Die Annahme, Gastarbeiter würden wie anfangs die Italiener nur auf Zeit und ohne Familien nach Deutschland kommen und dann in die Heimat zurückkehren, erwies sich als irrig. Aus der befristeten Arbeitsmigration wurde Zuwanderung auf Dauer, insbesondere Türken bildeten eine neue Kategorie von Bürgern der Bundesrepublik. Die DDR vermied durch Ghettoisierung und Befristung des Aufenthalts der „Vertragsarbeiter“ aus Vietnam, Mozambique oder Angola, dass aus dem Arbeitsmarktproblem ein Einwanderungsprojekt entstand. Die wirtschaftliche Rezession in der Bundesrepublik wurde 1973 mit einem Anwerbestopp für Gastarbeiter und Rückkehrprämien beantwortet.
Zuwanderer in der Größenordnung von ca. zwei Millionen Menschen waren die Russlanddeutschen, die seit den 1990er Jahren als „Spätaussiedler“ aus der Sowjetunion aufgrund ihrer Abstammung in der Bundesrepublik Aufnahme fanden, ebenso wie Juden aus der Sowjetunion aufgrund eines der letzten Gesetze der Volkskammer der DDR, die 1990 als Geste der Wiedergutmachung eingeladen waren, nach Deutschland zu kommen. Jüdische Kontingentflüchtlinge wanderten daraufhin von 1991 bis 2004 in das vereinigte Deutschland ein.
Als politisches Asyl war die Bundesrepublik aufgrund des großzügigen Verfassungsartikels und der ökonomischen Perspektiven so attraktiv, dass Möglichkeiten des Zugangs auf Betreiben konservativer Politiker durch Grundgesetz-Änderungen sukzessive erschwert wurden. Der Slogan „Deutschland ist kein Einwanderungsland“ sorgte für Wählerstimmen, das Fehlen eines Einwanderungsgesetzes und mangelnde Anstrengungen zur Eingliederung von Migranten in die deutsche Gesellschaft erwiesen sich gegenüber türkischen Arbeitsmigranten in den 1980er Jahren ebenso wie gegenüber Bürgerkriegsflüchtlingen aus Jugoslawien in den 1990er Jahren als folgenreich: Bei vielen Deutschtürken ist das Bewusstsein gespalten in Zugehörigkeitsgefühle einerseits und Empfindungen der Unerwünschtheit andererseits. Mangelnder Bildungserfolg bei Jugendlichen bedeutet vielfach deren soziale und ökonomische Perspektivlosigkeit. Humanitäre Hilfe für bosnische Bürgerkriegsopfer mündete, nach Jahren des Aufenthalts oft in Abschiebung in eine „Heimat“, in der die Flüchtlinge fremd und unerwünscht waren, in der aber kein Krieg mehr herrschte. Die juristische Begründung der Verweigerung weiteren Aufenthalts in Deutschland war unanfechtbar, bedeutete aber für die inzwischen heranwachsende zweite Generation mit Deutsch als Muttersprache, entsprechender Sozialisation und keinerlei Bindung an die Herkunftsnation der Eltern eine Katastrophe. Die ganze Zwiespältigkeit politischen Handelns wurde im Schicksal Jugendlicher deutlich, die aus der Schule heraus in ihre „Heimat“ deportiert wurden. Viele sahen in der illegalen Rückkehr nach Deutschland den einzigen Ausweg, machten sich dadurch aber strafbar und nährten das politische Ressentiment der „Ausländerkriminalität“.
In dieser Situation, in der politische Konzepte und Perspektiven angesichts tatsächlicher Einwanderung fehlten, Parolen wie „das Boot ist voll“ oder der traditionelle rechte Schlachtruf, Deutschland sei kein Einwanderungsland, die Angst vieler Bürger vor „Überfremdung“ angesichts tatsächlicher sozialer Probleme, vor allem aber Gefühle der Unsicherheit steigerten, und verbreitetes – von Demagogen geschürtes – Unbehagen nach dem Terroranschlag des 11. September 2011 in den USA herrschte, das von interessierter Seite als bedrohliches Szenario beschworen wurde, ergab sich 2014 die humanitäre Notwendigkeit, einer Million Menschen, vor allem Bürgerkriegsflüchtlingen aus Syrien, die deutschen Grenzen zu öffnen. Das Vertrauen der deutschen Kanzlerin auf die solidarische Mitwirkung der europäischen Nationen bei der Lösung des Problems – das die über das Mittelmeer drängenden Flüchtlinge aus Afrika steigerten – wurde getäuscht. Die Notwendigkeit der Integration der Immigranten wurde umso dramatischer deutlich, als gleichzeitig reaktionäre Kräfte mit der ausländerfeindlichen Bewegung „Alternative für Deutschland“ sensationell erfolgreich waren.
Die Autoritarismus-Studie von Sozialwissenschaftlern der Universität Leipzig aus dem Jahr 2018 macht die Perspektive der Mehrheitsgesellschaft auf Zuwanderer deutlich: 35 % der Deutschen glauben, es sei das Motiv der Immigranten, den Sozialstaat auszunützen. Etwa gleich viele lehnen diese These ab, 30 % haben keine eindeutige Meinung zum Problem. Daraus folgt, dass zwei Ansätze zur Lösung erforderlich sind: Der eine muss auf die Aufklärung der einheimischen Bevölkerung zielen, über Motive der Zuwanderer und die rechtlichen, politischen und sozialen Strukturen informieren, innerhalb derer Einwanderung in Deutschland möglich ist. Der andere Ansatz verfolgt die Integration der Ankommenden (sofern die Voraussetzungen für ihren dauernden Aufenthalt gegeben sind).
Integration bedeutet generell die Eingliederung von Zuwanderern in die Gesellschaft des Aufnahmelandes, d.h. Spracherwerb, Akzeptanz der Kultur, soziale und politische Partizipation, Teilhabe am Bildungssystem und Zugang zum Arbeitsmarkt. Sozialwissenschaftler unterscheiden vier Dimensionen der Integration: erstens die Kulturation im Sinne von Sprach- und Wissenserwerb, zweitens die Platzierung in der Aufnahmegesellschaft im Bildungssystem und auf dem Arbeitsmarkt, drittens die Interaktion, d.h. die Teilnahme am sozialen Leben im Alltag und viertens die Identifikation als Gefühl der Zugehörigkeit als Individuum zur Aufnahmegesellschaft.
Ziel und Erfolg der Integration einer Person besteht darin, dass diese nicht nur handlungsfähig und teilhabeberechtigt ist, sondern sich auch als anerkannt und wertgeschätzt fühlt. Integration als Akkulturationsstrategie besteht im Erfolg der Anstrengung beider Seiten, der aufnehmenden Gesellschaft ebenso wie des Strebens nach Zugehörigkeit der Ankommenden. Integration ist nicht zu verwechseln mit Assimilation, d.h. vollkommener Preisgabe eigener kultureller Werte. Zur Integration gehört einerseits die Wertschätzung der Herkunftskultur durch die Aufnahmegesellschaft, andererseits jedoch die Anerkennung deren Werte und Normen durch Zuwanderer wie Gleichberechtigung der Geschlechter, unbedingter Vorrang der Verfassung und der Gesetze vor religiösen, sozialen, kulturellen Praktiken der individuellen oder familiären Sozialisation.