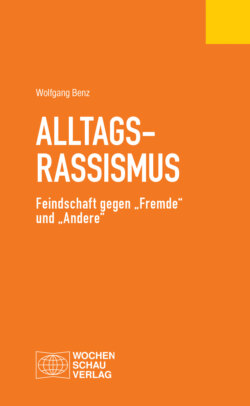Читать книгу Alltagsrassismus - Wolfgang Benz - Страница 9
Rechtsextremismus als Gesinnung
ОглавлениеDie theoretisch-exakte Definition sowohl des Begriffs Rechtsextremismus als auch seiner Inhalte stößt auf erhebliche Schwierigkeiten. Rechtsextreme Gesinnung und daraus entspringende Bestrebungen – Organisationen, Publikationen, Aktionen – können als politische Erscheinung immer nur annähernd bestimmt werden, da ihr keine allgemein verbindliche, wissenschaftlich entwickelte und systematisch fassbare Ideologie zugrunde liegt. Es gibt nicht einmal eine Übereinkunft, ob „Extremismus“ oder „Radikalismus“ die richtige semantische Kategorie ist, unter der Gesinnung und Aktivitäten der äußersten Rechten einzuordnen wären. Ebenso wenig ist festgelegt, wo rechtspopulistische und demagogische Strömungen in Rechtsextremismus übergehen.
Aber gerade hier ist die Nahtstelle, wie schon das Beispiel des brandenburgischen Dorfes Dolgenbrodt lehrt. Die Dorfbewohner, die am 1. November 1992 das Ausländerheim abfackeln ließen, haben das, was als Ausfluss rechtsextremer Gesinnung geschah, ja nicht selbst erfunden, das Motiv nicht entwickelt, sondern sie sind Appellen und Vorbildern gefolgt. Nicht anders verhält es sich auch mit der Vorgeschichte des Pogroms von Rostock-Lichtenhagen im Sommer 1992. Dolgenbrodt war kein Einzelfall und Rostock-Lichtenhagen, wo unter dem anfeuernden Beifall von Gaffern und Sympathisanten hunderte von Gewalttätern mit Molotowcocktails eine Unterkunft von Ausländern und Asylbewerbern angriffen, war nur trauriger Höhepunkt einer ersten Welle rechter Gewalt in den 1990er Jahren. Im November 1990 traten Skinheads in Eberswalde bei Berlin den Angolaner Amadeu Antonio zu Tode. Im April 1991 starb ein Afrikaner in Dresden, nachdem ihn Skinheads aus einer Straßenbahn geworfen hatten. Im September 1991 spendeten Anwohner Beifall, als Rechtsextreme ein Ausländerwohnheim angriffen. Ein halbes Jahr nach dem Mordanschlag in Mölln (Schleswig-Holstein) gegen eine türkische Familie starben im Juni 1993 bei einem nächtlichen Attentat in Solingen (Nordrhein-Westfalen) fünf Menschen türkischer Herkunft in einem brennenden Zweifamilienhaus, 17 weitere wurden schwer verletzt. In Magdeburg hetzten junge Rechtsradikale im Mai 1994 am „Vatertag“ Ausländer durch die Stadt. Im Juni 2000 trampelten in Dessau rechtsextreme jugendliche Gewalttäter einen Mann zu Tode, weil er Ausländer war.
Ohne die von Politikern verkündeten Parolen, das Boot sei voll, es strömten zu viele Ausländer ins Land, Deutschland sei kein Einwanderungsland, man müsse den Zuzug der Asylbewerber irgendwie begrenzen, ohne solche Mutmaßungen mit Aufforderungscharakter wären die Gewaltakte gegen Ausländer kaum so verlaufen. Die Wechselwirkung von Ideologie und Gewalt, die Arbeitsteilung zwischen Ideologen und Tätern zeigt sich daher so deutlich wie die Instrumentalisierung der Dümmeren, der Gewalt agierenden, durch die Klügeren, als den zur Gewalt Appellierenden. Die letzteren müssen nicht einmal das Odium rechtsextremer Gesinnung auf sich nehmen, denn mit wenig Geschick lässt sich der Zusammenhang verwischen und dementieren, der Zusammenhang zwischen dem Appell – im Parlament, vor der Fernsehkamera, im Wahlkampfgetümmel und vor allem in den „sozialen Medien“, – und den Tätern, die die Aufforderung verstehen und in gewaltsame Aktionen umsetzen.
Im günstigen Fall verhaftet die Polizei nach einem Anschlag ein paar Täter, während die Anstifter sich mit staatsmännischen Kommentaren erfolgreich zurückziehen. In der Maske des Biedermanns sind die Brandstifter, die, wenn es dann brennt, nur einer Sorge Ausdruck verliehen haben wollen oder nur das gesagt haben, was das Volk angeblich empfindet und will. Nicht nur Fanatiker verstehen das direkt als Handlungsanweisung. Die Zügellosigkeit des Demagogen ist schon ein Stück Rechtsextremismus, auch wenn der äußere Anschein dagegen spricht.
Als brauchbare Kriterien zur Einordnung politischen Verhaltens kann man die gedanklichen Inhalte, die angestrebten Ziele und die zu deren Erreichen angewandten Methoden benützen. Die drei Kategorien Gesinnung, Zielsetzung, Methoden liefern einigermaßen sichere Indizien für rechtsextremes Denken und Verhalten. Wichtige Kriterien für die Definition von Rechtsextremismus sind:
Nationalismus in aggressiver Form, verbunden mit Feindschaft gegen Ausländer, Hass gegen Minderheiten, fremde Völker und Staaten; militant-deutschnationales, deutschvölkisches oder alldeutsches Gedankengut,
Antisemitismus und Rassismus, biologistische und sozialdarwinistische Theorien und Überzeugungen,
Intoleranz, Unfähigkeit und Unwille zum Kompromiss in der politischen Auseinandersetzung, elitär-unduldsames Sendungsbewusstsein und Diffamierung Andersdenkender,
der Glaube an ein „Recht durch Stärke“,
Militarismus, das Streben nach einem System von „Führertum“ und bedingungsloser Unterordnung und nach einer entsprechenden autoritären oder diktatorischen Staatsform,
Verherrlichung des NS-Staats als Vorbild und Negierung oder Verharmlosung der unter nationalsozialistischer Ideologie begangenen Verbrechen,
Neigung zu Verschwörungstheorien (z. B. die Annahme, Regierung, Wirtschaft, Gesellschaft usw. seien durch irgendwelche bösartigen Minderheiten korrumpiert),
Verweigerung historischer, politischer, sozialer Realität,
latente Bereitschaft zur gewaltsamen Propagierung und Durchsetzung der erstrebten Ziele,
Anwendung der Methode des populistischen Appells an ein Publikum, dem das Bewusstsein der Mehrheit und der richtigen Gesinnung vermittelt wird, bei gleichzeitiger Stigmatisierung von „Feinden“,
Ungezügelter Drang nach Macht und Geltung, der verantwortungslos ausgelebt wird.
Monokausale Welterklärungen und Problemlösungsangebote, die Ablehnung pluralistischer Gesellschaftsmodelle, klare Feindbilder und das dadurch vermittelte Gemeinschaftsgefühl machen rechtsextremes Denken zur Artikulation von Protestverhalten attraktiv.
Zum geschlossenen Weltbild verdichtete sich rechtsextremes Denken in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg. Strömungen wie Sozialdarwinismus, völkischer Rassismus, Antisemitismus flossen mit aktuellen politischen Feindbildern, mit Verlustängsten und auf Revision und Revanche zielendem Nationalismus zusammen und bildeten eine antidemokratische und antiliberale neue Weltanschauung, die sich erst deutsch-völkisch nannte und dann den Begriff Nationalsozialismus übernahm. Die äußeren sozialen, ökonomischen und politischen Umstände begünstigten die Entwicklung der Ideologie, zu deren Durchsetzung Gewalt ausdrücklich propagiert und angewandt wurde.
Die rechte Ideologie, der Glaube an die eigene Überlegenheit, an das Herrenmenschentum, an die Ungleichheit der Menschen ist also nicht neu. Diese Überzeugungen haben den Hitlerstaat überlebt, sie sind scheinbar bestätigt und ermuntert durch soziale Spannungen, durch Unsicherheit und existentielle Ängste. Dazu gehört die Gewalt auf den Straßen, die gegen Minderheiten, Ausländer und Andersdenkende gerichtet ist, die medienwirksame Selbstinszenierung von Neonazi-, Skinhead- und Faschogruppen, und die politische und soziale Situation, in der Rechtsextreme agieren und Sympathisanten rekrutieren. Dazu gehören Populismus und Demagogie.
Die Angebote von Organisationen und Ideologen entsprechen verbreiteten Stimmungen. In Parteiprogrammen, Zeitungen, Reden und im Internet wird das Verlangen nach der heilen Welt verkündet. Als politischer Kraftquell werden dazu irrationale Sehnsüchte und romantische Illusionen benutzt. Empfindungen haben den Vorrang vor rationaler Weltsicht, Affekte sind den Demagogen wichtiger als Argumente. Die Angst vor intellektuell nicht erfassbaren Bedrohungen durch nicht begreifbare Strukturen der politischen, ökonomischen und sozialen Realität der modernen Informationsgesellschaft wird durch schlichte Rezepte und Schuldzuweisungen genährt.
Mit der Gewalt auf den Straßen, Anschlägen auf Mahnmale und Friedhöfe und auf KZ-Gedenkstätten geht die Verleugnung historischer Realität einher. Das zeigen die Diskurse in den sozialen Medien: Trotzig und zunehmend dreister behaupten die einen, die Schrecken der Verfolgung von Dachau bis Auschwitz hätte es gar nicht gegeben, andere bezweifeln den Umfang der Verbrechen, oder wollen sie mit Grausamkeiten alliierter Kriegsführung gegen Deutschland aufrechnen. Und monoton ertönt seit Jahrzehnten, einst bei der NPD, jetzt bei der „Alternative für Deutschland“ der Ruf nach einem Schlussstrich unter die Erinnerung. Gegen Muslime wird gehetzt, sie werden wie einst die Juden als angeblich feindselige Minderheit diskriminiert und als Sündenböcke in Anspruch genommen.
Feindbilder spielen eine zentrale Rolle bei der Definition rechtsextremer Programme. Mit Feindbildern werden aber auch die Brücken geschlagen vom politischen Extremismus zu den alltäglichen Sorgen der Bürger. Über Feindbilder und Verschwörungsphantasien lassen sich Existenzängste und Furcht vor gesellschaftlicher Deklassierung in Zeiten, die von ökonomischer Unsicherheit und sozialem Stress charakterisiert sind, artikulieren und in politische Aktion umsetzen. Das praktiziert die vulgäre Pegida-Bewegung mit Stimmungsmache gegen Muslime und die „Lügenpresse“, und das propagiert die AfD unter dem Jubel von Gesinnungsgenossen.
Rechtsextremes Denken wird aus vielen Wurzeln gespeist, wobei Realitätsverweigerung gegenüber geschichtlicher Erfahrung und Gewaltlatenz wesentliche Faktoren sind. Rechtsextremes Denken ist bestimmt von aggressiven Phantasien mit rassistischen, nationalistischen und militaristischen Inhalten; rechtsextreme Ideologien propagieren die Ausgrenzung von Minderheiten, den Glauben an Recht durch Stärke, politische und gesellschaftliche Ordnung durch „Führertum“ und „Gefolgschaft“. Zum aktuellen Phänomen des Rechtsextremismus gehört seine Militarisierung durch eine Generation, die keine lebensgeschichtliche Erfahrung mit der Realität des Nationalsozialismus und seinen unmittelbaren Folgen hat, ihn aber als politisches Ideal begreift. Rechtsextremes Denken speist sich aus Angst und Gefühlen des Bedrohtseins: Das Plädoyer für „einfache Lösungen“ angesichts unübersichtlicher Problemzusammenhänge, schwieriger Situationen und ökonomischer und sozialer Krisen gehört zum elementaren Politikverständnis im Rechtsextremismus. Es äußert sich in Intoleranz, Fremdenfeindlichkeit, Ablehnung von Kompromiss und Toleranz und in zunehmender Gewaltbereitschaft.