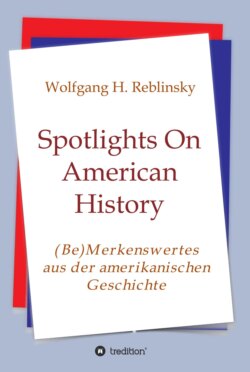Читать книгу Spotlights On American History - Wolfgang Horst Reblinsky - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCandle 6 - The Amish
1736, Regierungszeit von König Georg II von Grossbritannien.
Eine Gruppe Menschen, dunkel gekleidet. Die Männer in hochgeschnittenen weiten Hosen mit angeknöpften Hosenträgern, Hüten mit breiter Krempe und flacher Krone und darunter ein Bart mit ausrasierter Oberlippe. Die Frauen in langen Kleidern mit Kopfhaube. Kinder in der gleichen Bekleidung. Keine Turnschuhe, keine Baseballcaps und keine Smartphones. Das könnten Living History Darsteller sein.
Oder Amish. 4
Wer sind diese Leute, die heute noch ähnlich wirken wie vor knapp 350 Jahren und die schon zu Amerika gehörten, als es noch eine Kolonie des Königs von England war?
Für eine Antwort muss man in der Geschichte zurückgehen zum Jahr 0 unserer Zeitrechnung, zum Beginn des Christentums.
Ungefähr 200 Jahre später hatte sich das gebildet, was wir heute die frühkatholische Kirche oder One Holy Catholic and Apostolic Church nennen. 1054 erfolgte die Aufspaltung in die abendländische, römische katholische Kirche (Papisten) und die morgenländischen christlichen Kirchen, vor allem die unitierte, die orientalische und die orthodoxe Ostkirche.
Ab der sogenannten Reformation 1517 spalteten sich von der römischkatholischen Kirche die protestantischen oder evangelischen Kirchen ab; so auch ein Zweig, den der Züricher Priester Huldrych Zwingli 1522 begründete und der in vielem radikaler als Martin Luther war.
Um 1525 postulierten weitere Reformer, ausgehend von Zürich, dass ihre Kirche eine freiwillige Gemeinschaft sein sollte, die die Lehren Jesu Christi nachlebt. Für sie war die Taufe als Zeichen der Mitgliedschaft in ihrer Kirche nur möglich für Menschen, die verständig genug waren, sich aus eigenem Willen auf diesen Weg zu begeben. Die Taufe von Neugeborenen und kleinen Kindern lehnten sie ab, bereits erfolgte Taufen waren für sie bedeutungslos.
Daher wurden die erwachsenen Mitglieder nochmals getauft. Das führte zu der Bezeichnung Anabaptisten oder Kirche der Wiedertäufer. Sie selbst nannten sich Brethren (Brüder).
Verbreitet waren die Anabaptisten vor allem in der Schweiz, Süddeutschland und Tirol. Ab 1530 entstanden auch grosse Gemeinden in Norddeutschland und den Niederlanden.
Diese wurden sowohl von der katholischen als auch von anderen protestantischen Kirchen -und von diesen dominierten Regierungen- bekämpft. Aus der Zeit stammt die Abneigung der Anabaptisten gegen staatliche Reglementierung des Lebens und gegen Gemeinschaften mit Andersgläubigen.
1536 trat ein niederländischer, ehemals katholischer, Priester den Anabaptisten bei: Menno Simons.
Sein Einfluss prägte die Wiedertäufergemeinschaften erheblich. Ausgehend von den Niederlanden nannten sich viele Gruppe nun Mennoniten. Nach der Entvölkerung am Ende des 30jährigen Krieges 1648 boten Adelige in der Rheinpfalz und im französischen Elsaß den in der Schweiz immer noch unterdrückten Mennoniten religiöse Toleranz und Land zur Bewirtschaftung an.
1680 konvertierte Jakob Ammann aus dem Berner Oberland von der reformierten Zwingli-Kirche zu den Anabaptisten und schloss sich einer Mennonitengemeinde an. 1690 siedelte er mit seiner Familie ins französische Elsaß über, nach Markirch, heute Saint-Marie-aux-Mines.
1696 lösten sich Ammann und einige andere unter Führung von Hans Reist und Peter Giger von den Mennoniten und begründen eine neue Richtung die sich bald nach Ammann die Ammannischen nannte. Die Spur von Jakob Ammann verliert sich ab dem Jahr 1712 als der französiche König Louis XIV alle Anabaptisten aus dem Elsaß ausweisen liess.
Erste Spuren in Pennsylvania:
Der Engländer William Penn bekam 1681 von seinem König Land in der amerikanischen Kolonie zur Verfügung gestellt für ein nobles Experiment: Er wollte dort Sieder aller religiösen Richtungen ansässig machen. Penn selbst war Mitglied der Religious Society of Friends, auch als Quäker bekannt. Sein Land nannte er Penn's Woods, daraus wurde Pennsylvania.
In diese Zeit fällt wohl auch die erste Einwanderung von Mennoniten und Ammannischen, obgleich die frühesten heute erhaltenen Dokumente aus 1736 datieren und die Reise von Gruppen aus der Rheinpfalz über Rotterdam und London belegen.
Mit der Immigration wurde die Bezeichnung zu Amish amerikanisiert.
Aufspaltungen:
Ca. ab 1865 begann die Aufteilung in immer neue Zweige der Amish, z.T. auch wieder ein Zusammengehen mit den Mennoniten. Daher ist die Sammelbezeichnung "the Amish" mit Bedacht zu verwenden.
Ursache dafür waren nicht fundamentale Glaubensansichten als vielmehr unterschiedliche Vorstellungen vom Umgang mit der Umgebung und der sich wandelnden Gegenwart.
Die Grundidee aller Amish bleibt auch nach 340 Jahren die Taufe im Erwachsenenalter. Wie wir später sehen werden, beweisen die Zuwachsstatistiken, dass die Gemeindedistrikte dennoch keine Sorge um ein Aussterben oder Überaltern der Gemeinden haben müssen.
Allen Gruppen gemeinsam ist das aktive er-leben der Gebote Gottes und der Lehren Jesu und der hohe Wert der Familie und der Gemeinschaft der Gläubigen.
Daraus ergibt sich auch das Gebot der Bescheidenheit in Kleidung und Wohnungseinrichtung. Das Streben nach weltlichen Dingen und Vergnügungen ist unerwünscht. Im beruflichen Bereich wird Raffgier geächtet und es wird mehr Wert auf Gemeinsamkeit bei der Arbeit gelegt als auf hohe Rentabilität.
Aus den Zeiten der Unterdrückung in Europa geblieben ist eine hohe Mobilität.
Verfolgt man die Wege der ersten Einwanderer in Pennsyslvania, Ohio und Indiana, so lernt man, dass diese in Familiengruppen sehr häufig ihre gutgehenden Farmen verkauft und anderswo neu angefangen haben. Weiter geblieben sind eine starke Abneigung gegen staatliche Eingriffe in die Lebensweise und ein Misstrauen gegenüber Aussenstehenden.
Da die ursprüngliche Erwerbsquelle der Amish das Farming war und sie die Grundstücke in aller Regel gekauft hatten, waren in der Anfangszeit staatliche Einflüsse gering, steigerten sich jedoch in der Zeit nach dem Bürgerkrieg.
Hauptkonfliktpunkte waren der Militärdienst und die Schulpflicht.
Amish lehnen den Kampf mit der Möglichkeit des Tötens ab, waren jedoch immer bereit, dem Staat (auch beim Militär) auf waffenlose Weise zu dienen.
Aufgrund des Bescheidenheitsgebots sind sie an höherer Schulbildung wenig interessiert, auch stört der Umzug in entfernter gelegene Bildungsanstalten das Familien- und Gemeinschaftsleben. Der Umgang ihrer Kinder mit Andersgläubigen in Schulklassen wird als problematisch gesehen. Konflikte mit staatlichen Behörden wurden oft dadurch gelöst, dass ganze Dorfgemeinschaften in einen anderen Staat umsiedelten. Lokale Autoritäten, die diese fleissigen Mitbürger ungern wegziehen sahen, bemühten sich vielerorts um Kompromisse. Oft, und auf Bundesebene meistens, wurden Gerichtsentscheidungen notwendig. Diese gingen häufig zu Gunsten der Amish aus, da in den USA der Respekt vor religiösen Regeln sehr hoch ist.
Ein weiterhin offener Konfliktpunkt ist, dass die Amish Krankheits- und Altersversorgung als Aufgabe der Kirchengemeinde betrachten. Deshalb wollen sie keine Leistungen von Staat oder Bund und auch keine Beiträge einzahlen.
Mit Fortentwicklung der Technik stellte sich für die Amish stets die Frage, ob sie diese jeweils annehmen oder ablehnen sollten und hier entstanden durch unterschiedliche Ansichten viele Untergruppen.
Bis heute ist in den meisten Gruppen die private Fortbewegung mit dem pferdegezogenen Buggy üblich. In der Farmarbeit wurde das Pferd vielerorts durch Traktoren ersetzt, nicht, um den Menschen die Arbeit zu erleichtern sondern um die Pferde zu entlasten. Die Frage einer höheren Rentabilität oder der Einsparung von Arbeitskräften interessiert die Amish ohnehin nicht.
Da sich seit den 1960er Jahren die Erwerbstätigkeit von der Landwirtschaft weg mehr auf Handwerk (v.a. Holzbearbeitung) verlagert hat, werden Last- und Lieferwagen für die Amish-Betriebe notwendig. Nehmen Amish Jobs in weit entfernten Betrieben an, sind auch Pkws in Gebrauch, meist gemeinschaftlich betrieben oder gemietet.
Unterschiede gibt es z.B. auch in der Nutzung von Telefonen und elektrischer Energie. Während konservative Gruppen den Anschluss an das öffentliche Stromnetz ablehnen (aber batteriebetriebene Geräte nutzen) ist für viele im beruflichen Bereich ein Anschluss notwendig. Oft wird hier auch mit lokalen Solar- oder Windkraftanlagen gearbeitet.
Dabei muss man immer im Sinn behalten, dass die Amish von Anfang an keine strukturierte Kirchenverwaltung mit zentraler Lenkung kennen. Sie sehen sich als eine Gemeinschaft der Menschen Gottes, nicht als Institution. Alle Entscheidungen werden auf regionaler Ebene in den Disktrikten getroffen.
Sehr unterschiedlich gehandhabt wird auch der Ausschluss aus der Gemeinschaft. Üblich ist die Exkommunion. Bei extrem konservativen Gruppen wird das shunning betrieben, das ist die soziale Ächtung und der vollständige Ausschluss aus Gemeinschaft und Familie. Den sozialen Druck auf Aussteiger darf man keineswegs vernachlässigen.
Bedeutend sind heute u.a. die Swartzentruber Amish (gegründet 1913 in Wayne County / Ohio) als extrem konservativ, die Old Order Amish, die New Order Amish und die Beachy Amish Mennonites (begründet 1916 von Bischof Moses Beachy), die als weniger konservativ angesehen werden.
Sehr kleine Gemeinden halten die Gottesdienste noch heute abwechselnd in ihren Häusern ab. Meist treffen sie sich aber in Versammlungshäusern, spezielle Kirchengebäude sind sehr selten. Vielfach werden die Gottesdienste heute auf englisch gehalten, bei den konservativen Gruppen aber noch immer in Pennsylvania Dutch, einem aus dem altschwyzerischen bzw. altpfälzer Deutsch stammenden Dialekt. Lieder werden meist nicht mit Instrumenten begleitet.
In einigen Gruppen wird bis heute The Ausbund verwendet. Dies ist eine Textsammlung, die 1535 von in Passau inhaftierten Anabaptisten verfasst wurde.
Als Beispiel soll das Vaterunser in Pennsylvania Dutch angeführt werden:
Unsah Faddah im Himmel
Dei Nohma loss heilich sei
Dei Reich loss kumma
Dei Villa loss gedu sei
uf die Eaht vi im Himmel.
Unsah tayklich Broht gebb us heit
un fagebb unsah Shulda
vi miah fagevva vo uns shuldich sin.
Un fiah uns naett in die Fasuchung
avva hald uns fu'm Eavila.
Fa Dei is des Reich, die Graft un die Hallichkeit in Ayvichkeit.
Amen.
Zum Verhältnis der Amish zu ihrer Umgebung passen gut zwei Aussprüche aus der amerikanischen Anfangszeit:
"We are in the world, but not of it". "The world is not to be fully trusted". Aber auch das Motto einer Bischofskonferenz der Old Order Amish: "We are not timeless figures, frozen in the past".
Amish und Natives: Über das Verhältnis der Amish zu den Natives gibt es kaum Aufzeichnungen.
Die Amish lehnen Raffgier und Gewalt ab, waren aber Farmer die -vom amerikanischen Staat gekauftes- Land bewirtschaftete haben, das ursprünglich Indianerland war. Man darf also vermuten, dass es durchaus Interessenkonflikte gab die möglicherweise nicht so eskaliert sind wie bei anderen Siedlern.
Interesse von ausserhalb: Es ist bezeichnend für die heutige übervolle und komplexe Lebenswelt, dass die einfache Lebensweise der Amish viele Menschen zu interessieren beginnt. Damit hat ein oberflächlicher Voyeur-Tourismus eingesetzt, der die Amishgemeinden sehr stört. Reiseangebote "zu den Amish" finden sich sogar bei deutschen Veranstaltern. Das Internet, vor allem das deutschsprachige, ist übervoll von Websites, in denen -oft selbsternannte- Experten Klischees und Halbwahrheiten verbreiten.
Tatsächlich leben die Amish in ihrer Welt, die keinesfalls romantisch verklärt heil sein muss. Wie in allen Gemeinschaften, die derart abgeschottet sind, gibt es Fälle von häuslicher Gewalt und sexuellem Missbrauch, oft auch durch Gemeindeälteste.
Zum Abschluss einige Zahlen, entnommen dem Amish Population Profile 2019 des Young Center for Anabaptist and Pietist Studies des Elisabethtown College:
Die Zahl der Amish in den USA wird mit ca. 342.000 Personen angegeben, davon ca. 40 % getaufte Kirchenmitglieder, der Rest sind noch ungetaufte Kinder. Seit 2018 ist dies eine Steigerung von 3,9 %. Amishgemeinden gibt es in 31 Staaten (davon ca. 63 % in Ohio, Pennsylvania und Indiana) und in 4 kanadischen Provinzen. 5
Wie Dietmar Kuegler, der Herausgeber des Magazins für Amerikanistik, in einer Mail an den Autor schreibt, sind "die Amish ein Beweis dafür, dass man in Amerika noch immer als gesellschaftlicher Aussenseiter weitgehend ungestört leben kann".
4 Reblinsky, Wolfgang: Magazin für Amerikanistik 2/2020. S. 46 ff.
5 Nolt, Steven M.: A history of the Amish. 3rd Edition. Good Books by Skyhorse Publishing, Inc. New York /NY. Amish Population Profile 2019. Young Center for Anabaptist and Pietist Studies, Elisabethtown College.