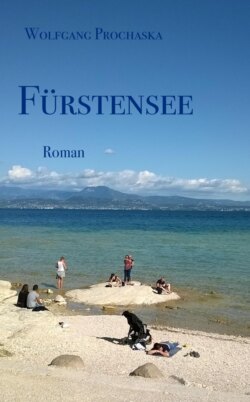Читать книгу Fürstensee - Wolfgang Prochaska - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Wie es begann
ОглавлениеSeit dem Tod meines Vaters waren für mich Friedhöfe die schönsten Orte der Welt. Ihre geraden Grabreihen mit den geputzten Steinplatten, die verschnörkelten Schriften, die geschmückten Holzkreuze, die geharkten Kieswege, die in sich gekehrten Besucher, die hohen Schatten der Bäume: die Auferstehung war ein ruhiges Fest, und ich genoss, in meiner Trauer, diese Ruhe und Schönheit.
Das Leben war so fern wie der Himmel.
An manchen Tagen konnte ich mich nicht trennen, auch aus Abbitte für die, die nicht mehr lebten und diese Schönheit nicht mehr betrachten konnten. Ich zwang mich zu glauben, dass sie in einer Güte und in einem Frieden aufgehoben waren. Die Menschheit in all ihrer Gesamtheit brauchte Zuneigung und Wärme, auch die Toten, und ich wollte meinen Beitrag leisten.
Ich lebte in München, war noch verheiratet und schrieb an einem Roman, dessen Protagonist darunter litt, sich nicht empfinden zu können. Das Leben war ihm abhandengekommen, die Schönheit, die Liebe und die Hoffnung. Und er sehnte sich nach Unglück oder Schmerz, allein, um sich wieder spüren zu können.
Ich war als Schriftsteller noch nicht wirklich bekannt, hatte aber zuvor bei einem ordentlichen Verlag einen Lyrikband veröffentlicht, mehrere Kritiken in überregionalen Zeitungen erhalten und war zu Lesungen in München und Umgebung eingeladen worden. Ich fühlte mich damals, Ende der 1980er-Jahre, jung wie ich war und gestärkt durch die intensive Lektüre von „Stephen Hero“ und den „Dubliners“, reif für eine Schriftstellerkarriere.
Es war mir, als wartete etwas Großes auf mich.
Dann starb mein Vater.
Er hatte mich immer für ein seltsames Kind gehalten, so still verhielt ich mich nach jenem Vorfall, als ich wegen eines Hundes so erschrak, dass kein verständliches Wort mehr meinen Mund für ein halbes Jahr verlassen wollte. Bücher wurden meine Welt.
Er sagte nichts, er war beim Film, er war seltsame Menschen gewohnt, und er zählte sich insgeheim wohl selber dazu.
Auf einer Lesung in München sprach mich in jener Zeit ein Journalist an und fragte, ob ich mir zusätzliches Geld mit Kulturberichten verdienen möchte, er sei dabei, in Starnberg eine täglich erscheinende Kulturseite aufzubauen. Auch er schreibe Gedichte. Er hieß Siegfried.
Sein Angebot reizte mich, zumal meine Trauer einen Ausweg brauchte und mir meine Arbeit als Paketsortierer auf die Nerven ging. Und selbst die literarischen Aussichten schienen mir zu unsicher. Ich dachte: Am Roman könnte ich ja weiter schreiben.
Ich sagte schließlich nach einer kleinen Bedenkzeit zu, weil ich noch meine Frau in die Pläne einweihen wollte. Unsere Ehe war nicht die beste, aber ohne Julia konnte ich mir mein Leben nicht vorstellen.
Als ich auf dem Weg in die Redaktion war, wurde mir erst bewusst, dass ich weder die Stadt noch den See kannte, dies aber nicht als Mangel empfand. Meine Schriftstellerfreunde hatten nur von der Stadt der reichen Säcke gesprochen.
Es war ein Septembertag, die Sommerferien waren noch nicht zu Ende, aber die Luft fühlte sich schon herbstlich an. Als erstes sah ich das Schloss und die alte Kirche, danach erst den See oder vielmehr die Bucht, über der eine dicke Nebeldecke lag, grau und schwer. Das war mir angenehm. Ich vertrug schöne Tage nicht mehr und flüchtete mich stets in die Wohnung. Es war einer der Punkte, der meine Ehe belastete.
Ich sagte laut den Namen der Stadt, als würde mir jemand zuhören, während mein alter VW Bus den kleinen Berg hinunterrollte, um vor einer Ampel zum Stehen zu kommen. „Halte dich nach der dritten Ampel links, dann findest du uns schon”, hatte mir Siegfried eingeschärft.
Die Redaktion war in einem weißgelben Stadthaus untergebracht, hatte Gartenzugang und lag in einer Geschäftsstraße der Innenstadt. Daneben floss ein breiter Bach, eingefasst mit einer hohen, dicken Steinmauer. Es war mir egal. Ich brauchte kein Grün, keinen Garten, keine Obstbäume oder Bachläufe. Ich wollte schreiben und vergessen. Viel schreiben. Wörter pflanzen, wie ich es nannte.
Als Schriftsteller war es für mich ein stetes Wunder, dass abstrakte Zeichen, die in bestimmter Reihenfolge auf Papier standen, ganze Welten aus Geist und Gefühl erschaffen konnten: einen Wald aus Bedeutungen! Aber nun ging es um die direkte Vermittlung von Welt und Wirklichkeit.
82 Pfennig bekam ich pro Zeile. So war es mit dem Redaktionsleiter, einem schon älteren Herrn mit Haarkranz, ausgemacht. Das war mehr, als ich erwartet hatte. Es störte mich deshalb nicht, dass die Zimmer klein waren, dass Klo dünnwandig, der Zigarettenrauch dicht, die Schreibmaschinen laut und der Biergeruch intensiv. Ich nahm auch die klaren Anweisungen hin, den festen Abgabetermin und die vorgegebene Länge der Artikel. Ich nahm es hin wie einen glücklichen Schmerz.
„Am besten, Sie machen sich erst einmal mit der Stadt vertraut. Schauen Sie sich um, und schreiben eine kleine Reportage. Ich bin gespannt.“
Der Redaktionsleiter, den alle nur respektvoll mit seinem Nachnamen ansprachen und der hinter einem großen Schreibtisch mit abgeschabter Holzplatte und aufgeschichteten Mappen saß, sah mich freundlich an. Dass er mich sofort hinausschicken wollte in jene Welt, die mir fremd beziehungsweise fremd geworden war, hielt ich auch für einen Tauglichkeitstest.
Das hätte meinem Vater gefallen, der bei mir doch gewisse Alltagserfahrungen vermisst hatte, trotz meines großen literarischen Ehrgeizes. Immerhin hatte er das Wenige, das ich bis zu seinem Tod veröffentlicht hatte, mit Aufmerksamkeit gelesen. Mag sein, dass es auch daran lag, dass ich in meinen Prosatexten den schwedischen Mystiker und Seher namens Emanuel Swedenborg hin und wieder erwähnt hatte.
Mein Vater, der relativ erfolgreich im Filmgeschäft gearbeitet hatte, war ein Anhänger seiner Vorstellungen. Besonders stolz machte ihn, dass auch Ingmar Bergman zu dieser Religionsgemeinschaft gehörte und Goethe seinen „Faust II” mit einem Swedenborg-Zitat enden ließ: „Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis...”
Ich hatte Schönheit befürchtet: hübsche Villen, gepflegte Gärten, große Parks und war erleichtert, dass nur der See, der sich wie ein schlanker Fjord nach Süden streckte, und die Aussicht auf die Alpen, meiner Befürchtung entsprachen.
Die vorherrschend billige Architektur, die nur von wenigen Häusern aus der Jahrhundertwende unterbrochen wurde, würde mich nicht herausfordern. Selbst der alte Bahnhof direkt am See wirkte ungepflegt.
Ich wunderte mich über diese große Lieblosigkeit, aber ich war auch neu.
Wie diese Stadt, in der es angeblich von reichen und glücklichen Menschen nur so wimmeln sollte, funktionierte, merkte ich, als mich eine neue Erkundungstour in ein großes Blumengeschäft führte, in dem ich etwas für meine Frau kaufen wollte. Sie liebte Überraschungsgeschenke. Ein Mann mittleren Alters (er stieg später in einen Porsche) feilschte gerade um den Preis eines Blumenstraußes, der 35 Mark kosten sollte. Ich bewunderte die Floristin, eine junge Frau in grüner Schürze und hochgebundenen, braunen Haaren, um ihre Hartnäckigkeit, den Preis zu verteidigen. Es war ein großer Strauß, ein buntes, heiteres Etwas.
Es ging hin und her. Am Ende einigte man sich auf 35 Mark, dafür sollte der Strauß noch zwei Rosen hinzubekommen und besonders repräsentativ eingewickelt werden. Aber ohne Aufpreis. Die Floristin sah mich danach an, nicht empört, geradezu emotionslos, und sagte jenen Satz, der hier ein Naturgesetz zu sein schien und mich weiter begleiten sollte: „Von den Reichen das Sparen lernen.”
Ich dachte zuerst, wegen der Feilscherei, ich sei zu empfindlich, zu dünnhäutig, weil ich auch gewisse Aggressionen in mir gespürt hatte, ich war so etwas nicht gewohnt. Aber als ich einige Wochen später in einer Parfümerie ein Geburtstagsgeschenk für Julia auswählte, wurde ich auf andere Weise aufgeklärt: Man deckte mich mit Probepackungen von Aftershaves und Eau de Cologne regelrecht ein, nur weil ich zwei Fläschchen von Givenchy und Clarins gekauft hatte.
Die Verkäuferin, eine sorgfältig geschminkte Frau um die 40, schmal und zierlich, aber mit großen grauen Augen, öffnete die Schubladen in der Ladentheke, und befüllte die Plastiktüte. Als ich aus dem Geschäft trat, fühlte ich mich auf angenehme Art belohnt und auf eine bis dahin unbekannte Weise zufrieden, als könnte es meine Trauer aufwiegen.
Ich blickte noch einmal in die Tüte, in der die Probepäckchen lagen, nur um mich zu vergewissern und merkte, wie ich ihren Wert zu meinen Ausgaben aufrechnete. Was war mit mir in diesem Moment passiert?
In dieser Zeit, in der ich versuchte zu vergessen, nahm ich auch gesellschaftliche Einladungen und Empfänge wahr, zu denen unser Chef keine Lust hatte. „Sie müssen unter die Leut‘, das ist das Beste”, hatte er zu mir gesagt. „Ein ordentliches Jackett haben Sie ja.“
Mein Vater hatte mich immer ermahnt, mich ordentlich anzuziehen, und es war einer der wenigen Ratschläge, die ich von ihm angenommen hatte. Der zweite lautete, und es klang wie eine Mahnung: Verrate nie, woran du glaubst!
Ich lernte tatsächlich Menschen kennen, die reich waren, sei es durch Erbschaft, Erfindung oder Ehrgeiz, und die mir dennoch nicht glücklich schienen.
Immer, wenn ich von solchen Empfängen zurückkehrte, fühlte ich mich angenehm betäubt und leicht, als würde er noch leben. Ich legte mich dann still zu meiner Frau, die tief und fest schlief, und spürte die alte Wärme wieder.
In diesen Anfangsjahren entwickelte ich mich zum Kenner von Dingen, deren Wissen der normale Mensch meist für überflüssig hält: Ich erkannte mit schnellem Blick Accessoires von Luxusmarken wie Prada oder Vuitton, Kostüme der Pariser Modemacher Lagerfeld oder Yves, wie Yves Saint-Laurent damals von den Damen der Stadt genannt wurde, und ich bewunderte an solchen Abenden zusammen mit ihren Männern deren teure Autos oder „Karren”, wie sie in einer seltsamen Verachtung ihre „Lieblinge” bezeichneten.
Ich genoss diese Distanz, die mich von ihren Leben trennte, genoss meine Fremdheit, die immer eine Fremdheit bleiben würde, und meinte, eine gewisse Heilung zu verspüren.
Ich war aber verunsichert, denn das alte Gefühl, jener Hoffnungsglaube, den ich seit meiner Kindheit tief in mir trotz allem bewahrt hatte, wollte sich nicht mehr einstellen. Ich versuchte gesellig zu sein und war nach jedem Fest, nach jeder Feier froh, in meine Stille zurückkehren zu können.
Nicht, dass ich in dieser Zeit nur unglücklich war: Die Redaktion mochte meine Worte und ich konnte viel und ausgiebig schreiben. Ich erfuhr in diesen Jahren unter dem alten Redaktionsleiter wirklich Anerkennung und Respekt. Auch von meiner Frau, obwohl sie einen Schriftsteller geheiratet hatte.
An guten Abenden hatte ich auch die Kraft, an meinem Roman weiter zu arbeiten. Und sie sah es gern, wenn ich daran schrieb.
Sie glaubte an mich, an mein Talent, an meinen Erfolg, ich liebte sie dafür, bis sie eines Tages ihre Sachen packte, enttäuscht und ernüchtert, und wieder zu ihren Eltern zog.
Ich war zu betäubt, um mich verlassen zu fühlen.
Etwas war auch erkaltet in mir, etwas, das ich nicht bestimmen konnte.