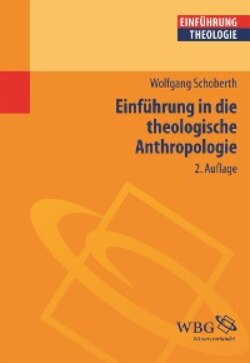Читать книгу Einführung in die theologische Anthropologie - Wolfgang Schoberth - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.1.2 Die öffentliche Debatte um den Menschen und die Theologie: Thesen
ОглавлениеEs geht in dieser Debatte keineswegs darum, daß unsere Gesellschaft gemeinsame und verbindliche Vorstellungen vom Menschsein haben müßte – das wäre nicht nur eine uneinlösbare Fiktion, sondern mit dem Selbstverständnis freiheitlicher Gesellschaften unvereinbar, insofern zu deren Grundlagen ja gerade der Respekt vor divergierenden Überzeugungen auch in grundlegenden Fragen gehört. Der Respekt vor der Differenz wird aber auch dann aufgelöst, wenn der Streit um diese grundlegenden Überzeugungen aus der öffentlichen Diskussion verbannt wird. Liberale Gesellschaften sehen sich vor dem strukturellen Problem, daß sie einerseits um ihrer Liberalität willen keine verbindliche Vorstellung davon, wie ein gutes Leben beschaffen ist, voraussetzen oder erwarten dürfen, andererseits zugleich darauf angewiesen sind, daß ihre Bürger von solchen Überzeugungen geleitet sind, die die Bedingungen des respektvollen Zusammenlebens verschiedenartiger Lebensformen achten. Darum bedürfen solche Gesellschaften der Möglichkeit und Wirklichkeit eines öffentlichen moralischen Diskurses um das gemeinsame Gute und damit auch um die Bestimmung dessen, was Menschsein heißt.
1. Anthropologie liegt der Wissenschaft voraus; sie verweist auf die Sphäre des Philosophischen und des Religiösen und hat gerade darin ihre öffentliche und politische Relevanz.
Die anthropologische Frage ist keine wissenschaftlich beantwortbare, weil mit ihr Vorentscheidungen verbunden sind, die der wissenschaftlichen Arbeit jeweils ihre Richtung gibt. Diese Vorentscheidungen fallen auf dem philosophischen und vor allem auch religiösen Terrain – wobei philosophisch‘ wie ‚religiös‘ zunächst in einem weiten Sinn zu verstehen sind. Damit ist aber zugleich gesagt, daß anthropologische Theorie in mehrfacher Hinsicht nie abgeschlossen sein kann: Nicht nur ist keine Ebene erkennbar, auf der zwischen konkurrierenden anthropologischen Grundüberzeugungen bündig entschieden werden könnte; es gehört auch zu ihrem Sinn, daß sie auf Voraussetzungen beruht, über die sie nicht zu verfügen und die sie selbst nicht einzulösen vermag. Anthropologie weist so immer über sich selbst hinaus.
Aus dem Bewußtsein für die ‚religiöse‘ Basis aller anthropologischen Theorien geht freilich keineswegs hervor, daß hier nicht kritisch zu begründen und abzuwägen wäre. Vielmehr sind damit gerade die Bedingungen einer angemessenen kontroversen Diskussion benannt: Diese kann nur da sinnvoll geschehen, wo diese letzte Unverfügbarkeit der Grundlagen anerkannt und respektiert wird. In der Anerkennung dieser Grenze liegt dann aber auch die Chance zur Artikulation der Differenzen und auch die Herausforderung zum Protest da, wo Behauptungen über die Bestimmung des Menschseins begegnen, die von der jeweiligen Grundüberzeugung her als nicht akzeptabel gelten müssen.
Jede öffentliche Debatte um das Menschsein verweist, wie bereits deutlich wurde, immer auf die grundlegenden moralischen und religiösen Überzeugungen, auf denen die jeweiligen Positionen und Optionen basieren. Darum ist es im Interesse einer demokratischen politischen Kultur unerläßlich, daß in der öffentlichen Auseinandersetzung diese Grundüberzeugungen offengelegt und in der Debatte klar artikuliert werden. Weil die anthropologischen Fundamente ethischer und politischer Positionen notwendig strittig sind, kann niemand in dieser Auseinandersetzung ein Monopol oder einen Vorrang beanspruchen; grundsätzlich kann aber auch keine Stimme etwa mit dem Hinweis auf ihre religiöse Begründung ausgeschlossen werden. Solche religiösen Fundierungen sind vielmehr klar zu benennen und offen zu diskutieren.
2. In der anthropologischen Debatte ist der Beitrag der Theologie unverzichtbar.
Das Reden vom Menschen ist in unserer Kultur in vielfacher Hinsicht durch die christlich-jüdische Tradition bestimmt; dies manifestiert sich auch in der Rechtsordnung, wie gerade an dem Grundbegriff der Menschenwürde – unbeschadet auch antiker Traditionen, die in diesen Begriff einfließen – abzulesen ist. Daß die theologischen Stimmen für den gesellschaftlichen Diskurs unverzichtbar sind, macht freilich keineswegs ein christliches oder ‚christlich-abendländisches‘ Menschenbild verbindlich, zumal ein solches Menschenbild, wie sich zeigen wird, eine durchaus problematische Vorstellung ist. Vielmehr gehört es zur Aufgabe der Theologie, ihre Rede vom Menschen auch für Nichtglaubende möglichst nachvollziehbar darzustellen und als eine Sicht unter anderen Sichtweisen zu positionieren; dazu gehört freilich auch, daß die Theologie um Zustimmung für ihr Verständnis des Menschseins wirbt. Auch das ist eine Überzeugung, die die folgenden Überlegungen leitet: daß die christliche Rede vom Menschen realistisch und befreiend ist. Selbstverständlich steht dieselbe Überzeugung auch konkurrierenden Bestimmungen des Menschseins zu; eben dadurch ist eine fruchtbare Auseinandersetzung um das Menschsein gekennzeichnet, daß sie gleichermaßen für die entschiedene Wahrnehmung der eigenen Überzeugung und den Respekt vor anderen Raum bietet.
Wie in der Auseinandersetzung um das Menschsein die christliche Rede vom Menschen nur im Bezug auf nichttheologische Vorstellungen vom Menschsein möglich ist, so verweist auch die theologische Anthropologie auf den Kontext verschiedenster anthropologischer Forschungen und Theoriebildungen in unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen.
3. Theologische Anthropologie ist nur im Diskurs mit anderen anthropologischen Ansätzen möglich.
Hier ist freilich genau zu unterscheiden: Die Notwendigkeit einer Einbindung in den öffentlichen wie den wissenschaftlichen Diskurs um das Menschsein erfordert zwar von der Theologie die Wahrnehmung dessen, was in anderen Disziplinen vom Menschen formuliert wird, und erfordert auch, mit diesen Aussagen, Theorien und Konzepten im Gespräch zu bleiben. Das kann aber gerade nicht heißen, daß die dort erarbeiteten Resultate und Aussagen von der Theologie zu übernehmen wären, weil jeweils differierenden Vorstellungen vom Menschsein die jeweilige wissenschaftliche Arbeit lenken. Zum öffentlich notwendigen Diskurs um das Menschsein gehört vielmehr die Begegnung klar profilierter unterschiedlicher Positionen und Perspektiven, von denen keine eine privilegierte Stellung einnehmen kann: Weder religiöse, philosophische noch auch wissenschaftliche Zugänge können hier einen grundsätzlichen Vorrang beanspruchen. Diese Verortung im Diskurs über das Menschsein impliziert wiederum Rückwirkungen auf die vertretenen Positionen; auch die theologische Rede vom Menschen gewinnt aus dem Diskurs Präzisierungen, Überprüfungen und Korrekturen.
Die Vielfalt der Bezüge zu den verschiedenen Disziplinen, in denen anthropologische Fragestellungen erscheinen, läßt es freilich auch ausgeschlossen erscheinen, daß sie theologisch in einem einheitlichen Lehrstück erschöpfend zu bearbeiten wären: Theologische Anthropologie vollzieht sich vielmehr sinnvollerweise selbst in unterschiedlichen Gesprächskontexten, die zwar miteinander verbunden sind, aber keine einheitliche Gestalt annehmen können.
4. Die Ausbildung eines isolierten Lehrstücks vom Menschen ist für die theologische Bearbeitung der anthropologischen Fragestellungen nicht hilfreich.
Dies gilt allerdings auch aus genuin theologischen Gründen: Auch innerhalb der Theologie sind die anthropologischen Fragestellungen sachgemäß in verschiedenen Zusammenhängen wie z.B. der Schöpfungslehre, der Soteriologie, der Pneumatologie und Eschatologie – um die nächstliegenden zu nennen – zu verhandeln. Diese Mannigfaltigkeit der theologischen Bezüge ist wohl auch der Grund dafür, daß es in der Tradition nicht zur Ausbildung eines eigenen Glaubensartikels ‚Vom Menschen‘ kam.
Die Vielzahl der relevanten innertheologischen wie interdisziplinären und gesellschaftlichen Bezüge machen aber nicht nur die spezifische Schwierigkeit einer Darstellung jeder theologischen Anthropologie aus; sie verweisen auch auf ihre genuine Aufgabe: In der Anthropologie wird die Verwobenheit theologischer Reflexion in die öffentliche Debatte geradezu thematisch. Ort und Funktion theologischer Anthropologie lassen sich demnach so bestimmen:
5. In der theologischen Anthropologie bringt sich die Theologie in den öffentlichen Diskurs um das gute Leben ein.
Damit ist die theologische Anthropologie wie Anthropologie überhaupt an der Schnittstelle zur Ethik verortet, ohne in Ethik aufzugehen. Das Verhältnis von Ethik und Anthropologie ist vielmehr als Wechselbeziehung zu verstehen: In der Anthropologie werden wesentliche Voraussetzungen der Ethik reflektiert; zugleich aber sind die anthropologischen Überlegungen auch ethisch bestimmt. Wie wir jeweils das Menschsein bestimmen und wie wir mit Menschen umgehen wollen, läßt sich voneinander nicht trennen.