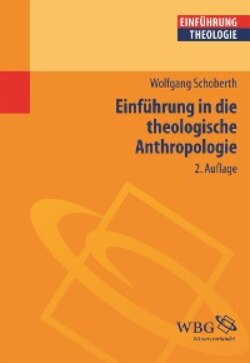Читать книгу Einführung in die theologische Anthropologie - Wolfgang Schoberth - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.2.1 Was sind Menschenbilder‘?
ОглавлениеEine genauere Klärung dessen, was der Begriff ‚Menschenbild‘ leisten könnte und worin seine Grenzen bestehen, setzt darum sinnvollerweise bei solchen Disziplinen an, in denen explizite Reflexionen auf das Menschenbild zu finden sind: Es sind nicht zufällig besonders solche Wissenschaften, die sich wesentlich pragmatisch auf ‚den Menschen‘ beziehen: Hier sind vor allem Pädagogik, Wirtschaftswissenschaft, Rechtswissenschaft und (klinische) Medizin zu nennen. Wie mit der Nennung dieser Disziplinen deutlich wird, setzt die handlungsleitende Funktion von Menschenbildern keineswegs voraus, daß diese auch bewußt wären und ausdrücklich verfolgt würden. Vielmehr folgt das Handeln in den medizinischen, wirtschaftlichen, juristischen etc. Handlungsfeldern zumeist intuitiv bestimmten Vorstellungen vom Menschen, die sich erst in der Reflexion auf dieses Handeln als seine normative Grundlage aufzeigen lassen. Dabei ist in diesem Zusammenhang die Pädagogik besonders instruktiv, weil „Erziehen … als intentionales Handeln auf Ziele und Leitbilder angewiesen“ (63: 72) ist. Die Geschichte der Pädagogik läßt sich „daher auch als Geschichte pädagogischer Menschenbilder lesen. Und man kann auch den aktuellen Streit über die richtige Pädagogik als Auseinandersetzung über das richtige Menschenbild verstehen.“ (70: 125)
Bildung und Menschenbild
Der terminologische Gleichklang von ‚Bild‘ und ‚Bildung‘ ist dabei alles andere als zufällig, auch wenn das auf Meister Eckhart zurückgehende Kunstwort„Bildung“ auf den deutschen Sprachraum beschränkt bleibt (zum Begriff vgl. 69 und 65). Hatte Meister Eckhart die Formung des Menschen in das Bild Gottes – Teilhabe an Gottes Wesen und friedliches, gelassenes Leben in der Welt zugleich (vgl. 62: 116) – als reines Empfangen und also nicht als Resultat der eigenen Anstrengung des Menschen verstanden, so wird die eigentliche Menschwerdung des Menschen in der Renaissance zur souveränen Aufgabe des Menschen. In dieser Selbstwerdung wiederum besteht seine Würde. Bei dem Renaissancephilosophen Pico della Mirandola findet sich die Metapher, die für das Bildungsverständnis der Neuzeit als geradezu klassisch gelten kann. Pico läßt den Schöpfer des Menschen sprechen:
„Wir haben dich weder als einen Himmlischen noch als einen Irdischen, weder als einen Sterblichen noch als einen Unsterblichen geschaffen, damit du als dein eigener, vollkommen frei und ehrenhalber schaltender Bildhauer und Dichter dir selbst die Form bestimmst, in der du zu leben wünschst. Es steht dir frei, in die Unterwelt des Viehs zu entarten. Es steht dir ebenso frei, in die höhere Welt des Göttlichen dich durch den Entschluß deines eigenen Geistes zu erheben.“ (103: 10f.)
Der Mensch als Bildhauer seiner selbst – diese Metapher enthält nicht nur die Vorstellung von der Offenheit des Menschen, die die Voraussetzung dafür ist, daß er Bildung haben kann und Bildung braucht, sondern zugleich auch eine klare Vorstellung vom Ziel menschlichen Seins: die Selbsterhebung durch den Geist. Dabei entsteht freilich in der scheinbar so überzeugenden Metapher eine eigentümliche Paradoxie: Der Bildhauer benötigt, um überhaupt mit seiner Arbeit beginnen zu können, eine Vorstellung davon, wie die fertige Statue beschaffen sein soll; er muß also bereits ein Bild des fertigen Werkes haben, auch wenn er das im Fortgang der Arbeit durchaus modifizieren kann. Weil aber dieses Bild der nicht festgelegte Mensch am Beginn des Bildungsprozesses noch gar nicht haben kann, ist die Vorstellung vom Menschen als Bildhauer seiner selbst inkonsistent. Konsistent kann dieses Bild nur dann sein, wenn dabei der Mensch nicht das Individuum ist, sondern aufgeteilt wird auf verschiedene Akteure: auf den allererst zu Bildenden einerseits und seinen Erzieher andererseits, der bereits selbst seinen Bildungsprozeß durchlaufen hat. In das Urbild neuzeitlicher Pädagogik bei Pico ist also bereits die Diskrepanz eingezeichnet zwischen dem, der das Bild des Menschen, das Ziel der Bildung sein soll, bereits vor Augen hat, und dem Schüler, dessen Bildung an jenem Bild ausgerichtet wird.
ein Widerspruch im Programm der Aufklärung
Dieser Widerspruch zwischen der Betonung der Autonomie des Subjekts einerseits, der Bindung an eine Vorstellung davon, wie dieses Subjekt beschaffen sein müsse, andererseits durchzieht auch das Programm der Aufklärung, die auch als eine pädagogische Bewegung aufgefaßt werden kann. Johann Georg Hamann hat diese Problematik scharfsichtig in seiner Kritik an Kants berühmter „Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung“ herausgearbeitet (vgl. dazu 78, wo auch Hamanns Text abgedruckt ist, und 312: 176ff.): Wenn Kant von der „selbstverschuldeten Unmündigkeit“ spricht, die durch das eigene Denken überwunden werden solle (93: 53), so verschweigt er nach Hamanns Auffassung, daß sich der Aufklärer dabei selbst zum Vormund des Unmündigen aufschwingt, dies aber systematisch verbirgt. Nicht schon in der Vormundschaft, ohne die kein Bildungsprozeß denkbar ist, sondern in ihrem Verschweigen sieht Hamann die Schuld, die Kant wiederum nicht den selbsternannten Vormündern, sondern den Unmündigen aufbürden will.
Die Spannung zwischen der Ausrichtung an einer Zielvorstellung von dem, was ein Mensch sein soll, einerseits und der Orientierung am Individuum andererseits bleibt der Pädagogik erhalten; sie ist unvermeidlich, insofern es hier in eminenter Weise um ein Handeln mit und an Menschen geht. Sie spitzt sich dadurch zu, daß einerseits das intentionale pädagogische Handeln beim ‚Erzieher‘ oder ‚Lehrer‘ liegt, daß aber andererseits der ‚Schüler‘ oder ‚Zögling‘ eben nicht lediglich Objekt pädagogischen Handelns sein kann, sondern ebenso Subjekt des pädagogischen Geschehens sein muß. Beide haben in ihrer jeweiligen Weise Vorstellungen von dem, was das Ziel des Bildungsprozesses ist – und sei es nur in einer vagen Vorstellung davon, was ein ‚gutes‘ Kind, einen ‚guter‘ Jugendlichen oder Erwachsenen ausmacht. Diese Vorstellungen können durchaus als Menschenbild‘ angesprochen werden; dabei kann aber nicht allein allgemein von ‚dem‘ Menschen die Rede sein, sondern vielmehr von individuellen Menschen in ihrer Verschiedenheit.
Pädagogische Kritik an Menschenbildern
Die Orientierung des pädagogischen Handelns an einem Menschenbild ist darum auch immer wieder Gegenstand scharfer Kritik geworden, zumal wenn es nicht aus diesem Handeln erwächst und sich in ihm verändert, sondern aus religiösen, philosophischen oder weltanschaulichen Überzeugungen abgeleitet wird und gerade so normierend wirken soll. Die pädagogische Kritik an Menschenbildern richtet sich mithin gegen zwei Momente: Menschenbilder sind Verallgemeinerungen, hinter denen die lebendigen Menschen in ihrer Individualität zu verschwinden drohen, und die Geltung, die sie beanspruchen, beruht auf Voraussetzungen, die selbst der eingehenden Diskussion bedürften und strittig bleiben. Jürgen Oelkers lehnt eine Ausrichtung der Pädagogik an Menschenbildern darum strikt ab:
„Mit ‚Menschenbildern‘ können allenfalls Generalisierungen ‚des‘ Menschen erfaßt werden, keine empirischen Personen, keine reale Gesellschaft und auch keine Bildungssysteme, aller pädagogischen Adressierung zum Trotz. ‚Menschenbilder‘ erlauben Sichtweisen und nehmen dadurch die Entscheidung ab, auch weil sie immer mit Autoritäten tradiert werden. Wenn also der Mensch Maß des Bildungswesens sein soll, dann nicht im Sinne generalisierter Menschenbilder, die außerstande sind, auf tatsächliche Erfahrungen zu reagieren.“ (72: 134; vgl. auch 67: 18)
Oelkers benennt mit Recht die Gefahr eines unmittelbar normativen Rekurses auf ein vorgegebenes Menschenbild: Die Vorstellung, einen Menschen nach einem bestimmten Bild formen zu wollen, ist unvereinbar mit der Bemühung um die Bildung autonomer Menschen. Diese muß sich vielmehr gerade in dem Sinn ‚am Menschen‘ ausrichten, daß dabei das individuelle Gegenüber im Blick ist und keine allgemeine Vorstellung vom Menschen. Menschenbilder können auch nicht die Rechenschaft über die Ziele des jeweiligen pädagogischen Handelns ersetzen, sondern fordern sie vielmehr heraus. Andererseits ginge die Forderung, wegen dieser Gefahren auf ein ‚Menschenbild‘ ganz verzichten zu sollen, ins Leere: „Alle Bilder der Kindheit manipulieren die Erziehung, aber ohne Bilder kann man nicht erziehen.“ (73: 255)
Zielvorstellung und Vorannahmen
Angesichts dieses Dilemma ist es notwendig, innerhalb dessen, was als ‚Menschenbild‘ erscheint, deutlich zu unterscheiden zwischen der Zielvorstellung, an der das pädagogische Handeln ausgerichtet werden soll, und den zumeist impliziten Vorannahmen, die das Handeln leiten. Dieser Unterschied läßt sich freilich nicht so verstehen, daß das intentionale Zielbild als normative Vorgabe zu vermeiden sei, während die (sei es wissenschaftlich, philosophisch oder religiös bestimmten) Vorstellungen vom Menschen unvermeidlich und letztlich unproblematisch seien. Die Diskussion ist allerdings nicht selten so verfahren: Der Streit wurde weithin so ausgetragen, daß ein jeweils zur Geltung zu bringendes Menschenbild entwickelt und argumentativ verteidigt wurde.
Die pädagogische Diskussion um das Menschenbild ist gerade darum von weitreichender anthropologischer Bedeutung, weil sie exemplarisch aufzeigt, daß die Normativität, die Menschenbildern unvermeidlich innewohnt, zumeist indirekt wirkt: Was jemand vom Menschen oder von einem Menschen denkt, bestimmt seinen Umgang mit ihm. Zielvorgaben und Vorannahmen sind beide normativ; sie unterscheiden sich allerdings in ihrem Bewußtseinsgrad und darin, daß die intendierte Zielvorstellung durch das implizite Menschenbild unterlaufen werden kann.
Handeln setzt Vorstellungen vom Menschen – sowohl auf das Individuum als auch auf den Menschen bezogen – voraus. Menschenbilder stehen aber immer in der Gefahr von ungerechtfertigten Generalisierungen und Verdinglichungen.