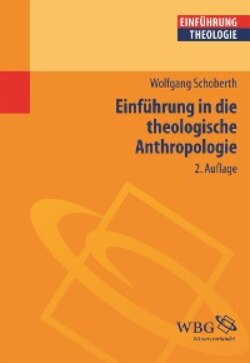Читать книгу Einführung in die theologische Anthropologie - Wolfgang Schoberth - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.1 Ein exemplarisches Problemfeld: Die Stammzellenforschung
ОглавлениеDie politischen und ethischen Fragen, die aus den Entwicklungen in der Biotechnologie entstehen, gehören ohne Zweifel zu den wichtigsten Themen der Gegenwart. Betrachtet man aber den Verlauf der verschiedenen Debatten, so zeigt sich sehr bald, daß es sich hier keineswegs um ethische Spezialfragen handelt, die durch das Abwägen des Für und Wider der jeweiligen Problemstellung hätten beantwortet werden können. Es ist vielmehr ein Charakteristikum dieser Auseinandersetzungen, daß sich die beteiligten Seiten auch nach Austausch aller Sachargumente nicht aufeinander zu bewegen und bewegen können. Dabei fällt auf, daß sich die verschiedenen Positionen nicht nach den gängigen Einteilungen auf politische Lager verteilen lassen; vielmehr finden sich in allen Parteien und Lagern Vertreter und Kritiker der verschiedenen Positionen. Die Vermutung liegt nahe, daß es sich hier um sehr grundlegende Divergenzen handelt, die quer liegen zu offensichtlichen politischen Optionen. Die zumeist auf aktuelle Problemlagen beschränkten Debatten erreichten aber kaum die Ebene der fundamentalen Überzeugungen.
Diese Diskussionen sind weiterhin dadurch gekennzeichnet, daß in ihnen die Basis unserer gesellschaftlichen Ordnung selbst in eigentümlicher Weise thematisch wird. Dies manifestiert sich darin, daß der Begriff der Menschenwürde zu einem Zentralbegriff der Diskussion wurde und werden mußte: Es wird etwa geltend gemacht, daß jede Entscheidung in der Frage der Forschung an embryonalen Stammzellen Konsequenzen dafür hat, was in unserer Gesellschaft als ‚Menschenwürde‘ in Zukunft gelten solle. Wenn nämlich Artikel 1 des Grundgesetzes feststellt: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“, dann entsteht in eminent praktischer Hinsicht die Frage, wem eigentlich hier ‚Würde‘ zugesprochen wird. Kommt der Schutz, der aus der Achtung der Menschenwürde hervorgeht, auch menschlichen Stammzellen zu, also jenen Zellen, die in biologischer Hinsicht am Anfang der Entwicklung eines Menschen stehen? Wird die Frage positiv beantwortet, so müßte dies konsequenterweise ohne weitergehende Argumentationen die Legitimität der Stammzellenforschung verneinen. Denn wenn Stammzellen nicht aus dem Bereich dessen herauszulösen sind, was das Grundgesetz ‚Mensch‘ nennt, so stehen sie unter demselben unbedingten Schutz, der ‚dem Menschen‘ zukommt; eine Forschung, die notwendigerweise Embryonen ‚verbraucht‘, also tötet, wäre zu unterbinden. Wenn aber die Stammzellen aus dem Bereich dessen, was ‚Mensch‘ genannt wird, herausgenommen werden: Unter welchen Bedingungen sind wir dann berechtigt und verpflichtet, von menschlichem Leben zu sprechen? Welche Kriterien für Menschsein müssen erfüllt sein?
Die aktuelle ethische Einzelfrage führt also notwendigerweise auf eine Ebene, die als anthropologisch bezeichnet werden muß, weil es hier um die grundsätzliche Frage geht: Was ist ein Mensch? Die politische Streitfrage kann darum – wie wohl alle grundlegenden ethischen Fragen – nur dann sachgemäß diskutiert werden, wenn die anthropologischen Voraussetzungen, die die verschiedenen Positionen tragen, allererst offengelegt und diskutiert werden. Mit Recht wurde darum in der Debatte wiederholt die Notwendigkeit einer grundlegenden und gründlichen anthropologischen Diskussion angemahnt, weil die nähere Betrachtung zeigte, daß jede der verschiedenen Positionen, die in Hinblick auf die gesetzliche Regelung vertreten wurden – von der Forderung nach völliger Freigabe bis zum völligen Verbot solcher Stammzellenforschung – auf Grundannahmen über das Wesen und die Bestimmung des Menschen basiert. An dem scheinbar eingegrenzten Spezialproblem erweist sich – wieder einmal – der Bedarf nach einer breiten öffentlich geführten Diskussion darüber, welche Vorstellung vom Menschen für Politik und Gesellschaft leitend sein oder werden soll.
Diese Diskussion findet freilich öffentlich kaum statt. Das mag so lange nachvollziehbar sein, als sich die Debatte im engeren Bereich politischer Entscheidungen bewegt: Politik steht unter Handlungs- und Entscheidungszwang; sie verfährt interessenorientiert. Gesetzliche Regelungen brauchen pragmatisch handhabbare Kriterien und klare juristische Linien; sie können sich darum punktuell auch auf die Formulierung solcher Kriterien und Leitlinien beschränken. An der Debatte um die Forschung an embryonalen Stammzellen wurde das exemplarisch deutlich: Statt der grundlegenden anthropologischen Fragen, was wir unter ‚dem Menschen‘ verstehen wollen, und wie mit dem Beginn menschlichen Lebens umzugehen sei, trat die Frage nach einer Bestimmung des Zeitpunkts, ab wann von einem Menschen zu sprechen sei und also der grundgesetzliche Schutz greife, ins Zentrum der Diskussion. Freilich erwies sich aber auch diese Beschränkung als letztlich undurchführbar, weil auch hier so viele anthropologische Voraussetzungen im Spiel sind, daß eine Einigung darüber, ab welchem Zeitpunkt der Schutz der Menschenwürde greife, nicht möglich war.
In der Frage nach der Forschung an embryonalen Stammzellen war die Folge ein politischer Kompromiß, der zwar die entstandenen Fragen nicht lösen konnte und wollte, wohl aber den Interessen der verschiedenen Positionen Rechnung tragen sollte: Einerseits sollte die Forschung an embryonalen menschlichen Stammzellen um ihrer erhofften medizinischen Chancen willen ermöglicht werden; andererseits aber sollte eine enge Reglementierung gewährleisten, daß menschliche Embryonen nicht völlig aus dem Schutz der Menschenwürde herausgenommen und zum Forschungsobjekt und Wirtschaftsgut werden. Von hier aus wird verständlich, warum die Debatte um die gesetzliche Regelung des Stammzellenimports letztlich keine Klärung brachte, sondern nur – was in Anbetracht der Lage sicher kein geringes Verdienst ist – einen für viele akzeptablen Kompromiß in der juristischen und politischen Handhabung. Damit aber wurden die auch politisch und juristisch entscheidenden Fragen wieder in den Hintergrund gedrängt.