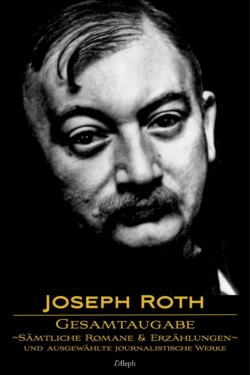Читать книгу Joseph Roth: Gesamtausgabe - Sämtliche Romane und Erzählungen und Ausgewählte Journalistische Werke - Йозеф Рот - Страница 78
На сайте Литреса книга снята с продажи.
IV
ОглавлениеEs geschah in der Pestalozzistraße, an einem heißen Donnerstag und im Hof des Hauses Nummer 37 (der Kirche aus gelben Ziegelsteinen gegenüber, die, rings um sich, mitten in der Straße einen grünen Rasen geschaffen hatte, als hätte sie ihre Besonderheit vor allen anderen Häusern hervorheben wollen), daß Andreas Pum das Verlangen überwältigte, einen Marsch zu spielen, vielleicht, weil die wachsende Mattigkeit des Tages und Andreas’ eigene eine aufrüttelnde Unterbrechung notwendig machten.
Andreas stellte den Wirbel an der linken Seitenwand des Leierkastens auf »Nationalhymne« und drehte die Kurbel so hurtig, daß die feierlichen Klänge ihre langsame Pracht verloren und hastig zu hüpfen begannen, die Pausen vergaßen und wirklich eine entfernte Ähnlichkeit mit der Melodie eines Marsches erreichten.
Fünf Kinder standen im Hof, und zwei Dienstmädchen lehnten ergriffen über die Fensterbrüstungen. Eine schwarzgekleidete Frau trat aus dem Hausflur, lenkte ihre männlichen, zielbewußten Schritte in die Richtung, in der sich Andreas befand und blieb hinter ihm stehen. Sie legte eine kräftige Hand auf die Schulter Andreas Pums und sagte: »Mein guter Gustav ist gestern selig geworden. Spielen Sie was Melancholisches!«
Andreas, obwohl nicht feige von Natur, erschrak dennoch ob der Überraschung, brach ab, so daß die Kurbel mit aufwärts ragendem Griff steckenblieb, und wandte sich um. Dabei tat es ihm leid, daß die starke und warme Hand zögernd, aber notgedrungen von seiner Schulter glitt. Er sah der Witwe in das gerötete Antlitz. Es gefiel ihm. Wenn er auch nicht Zeit genug fand, ihr Alter abzuschätzen, so durchströmte ihn doch plötzlich die Erkenntnis, daß die schwarzgekleidete blonde Frau eine Witwe in jenem Alter war, welches man »das beste« nennt. Aus dieser Einsicht zog Andreas vorläufig noch keine weiteren Schlüsse. Allein, eine dunkle Empfindung breitete sich in ihm aus, daß diese Frau zugleich in den Hof und in sein Leben getreten war. Es war ihm, als beginne es in seiner Seele zu dämmern.
»Mit dem größten Vergnügen«, sagte Andreas und vollzog eine leichte Verbeugung mit dem Kopfe. Als erforderte ein melancholisches Lied ganz besondere Vorbereitungen, schraubte er mit wichtiger Umständlichkeit den Nationalhymne-Wirbel ab, gab der Kurbel einen Schwung, daß ihr Handgriff hinunterglitt und der letzte noch steckengebliebene Ton dem Kasten entfloh, ähnlich einem unterdrückten und abgebrochenen Gähnen. Hierauf drehte Andreas den viertletzten Wirbel. Er hatte eine Sekunde lang zwischen der »Lorelei« und »An der Quelle saß der Knabe« geschwankt. Er entschied sich für die »Lorelei«, weil er annahm, daß dieses Lied der Witwe bekannt sein müsse.
Diese Annahme bestätigte sich. Die Witwe, die sich in ihr Zimmer zurückgezogen hatte, um die melancholische Weise bequemer an ihrem Fenster zu genießen, begann zu singen. Sie bemühte sich, den Klängen des Instruments zuvorzukommen, so, als triebe sie die Ungeduld und der Ehrgeiz, sich und den Zuhörern zu beweisen, daß sie die Melodie auswendig kannte und gleichsam auf den Kasten nicht angewiesen war; während Andreas, im Gegensatz zu der Eile der Frau, eine ganz besondere Langsamkeit nötig befand und gemächliche Drehungen vollführte, um die Melancholie des Liedes deutlicher wirken zu lassen. Auch befand er sich selbst in jener Stimmung, die uns in entscheidenden Augenblicken unseres Lebens befällt und der wir gerne durch eine hervorragende Feierlichkeit nachzugeben gewohnt sind.
Nachdem er die »Lorelei« über eine Viertelstunde gedehnt hatte, kam die Witwe wieder in den Hof, Kuchen, Brot und eine Tüte mit Früchten in der Hand. Andreas dankte. Die Witwe sagte: »Mein Name ist Blumich, geborene Menz. Kommen Sie nach dem Leichenbegängnis wieder.« Andreas fand, daß es angemessen sei, ihr die Hand zu drücken. Er tat es, ihre geschlossene Faust mit seinen Fingern umspannend, und sagte: »Mein Beileid, Frau Blumich.«
An diesem Tage spielte er nicht mehr. Er begab sich zu einer Bank vor der Kirche, verzehrte den Kuchen und das Obst und verwahrte das Brot im Sack. Später als gewöhnlich kam er nach Hause. Willi hatte schon längst das Bedürfnis gefühlt, sich im Bett auszustrecken, und wartete nur noch aus Furcht, daß er einschlafen und später geweckt werden könnte, um aus dem Bett zu steigen und »dem Krüppel« die geschlossene Tür zu öffnen. Als Andreas das Zimmer betrat, erwiderte Willi den Gruß nicht. Das tat Andreas leid. Es war ein Tag, an dem er eine große Güte für Willi empfand. Er holte den Spirituskocher hervor, um seinen Tee zu bereiten. Willi ärgerte die Schweigsamkeit. Er hätte gerne mit Andreas gestritten. Deshalb sagte er: »Wenn du morgen wieder so spät kommst, zerschmettere ich deinen Kasten. Du mußt pünktlich kommen! Ordnung muß sein!« Andreas aber war gerade heute nicht leicht zu erzürnen. Er lächelte Willi an, legte das Brot auf den Tisch und sagte höflich, mit der Galanterie eines Mannes von Welt: »Bedienen Sie sich, Herr Willi.«
»Daß du mir aber pünktlich zu Hause bist!« sagte Willi und setzte sich an den Tisch. Eigentlich ein lustiger Bruder! dachte er und war bereits versöhnt. Er hatte noch eine Wurst vom letzten Spaziergang. Sie hing an einem Nagel über dem Bett. Sachte nahm er sie herab, brach sie in der Mitte entzwei und gab die Hälfte Andreas.
»Ich habe heute eine Frau kennengelernt«, drängte es Andreas zu sagen.
»Gratuliere!« sagte Willi.
»Eine Witwe, namens Blumich.«
»Jung?«
»Ja, jung.«
»Glückskind!«
»Ihr Mann ist gestern gestorben.«
»Und schon –?«
»Nein!«
»Beeil dich, Freund! Witwen warten nicht lange!«
Dieses Wort merkte sich Andreas. Er war nicht gesonnen, Willi als einen hervorragenden Menschen zu schätzen, aber er gab zu, daß Leute dieses Schlages bessere Frauenkenner waren und eine Menge Erfahrungen gesammelt hatten. Vielleicht wäre es nützlich, ja sogar aus Schicklichkeitsgründen notwendig, am Leichenzug teilzunehmen? Vielleicht aber schickte es sich auch nicht wegen der Nachbarn – und auch der Frau Blumich war es gar nicht recht? Es schmerzte ihn fast, daß er ihren Vornamen nicht kannte. Er mußte sie in innigem Gedenken »Frau Blumich« nennen und fühlte, daß sie ihm längst keine Fremde mehr war. Je länger er an sie dachte, desto vertrauter war sie ihm. Kein Mensch auf Erden stand ihm so nahe wie sie. Niemandem glaubte er so nahe zu sein wie ihr, obwohl er keine Beweise dafür hatte. Denn war es nicht der Schmerz um den eben verlorenen Gatten gewesen, dem er, Andreas, ihre Bekanntschaft und ihre Freundlichkeit zu verdanken hatte? Vergaß eine Frau so leicht? Und – vermochte sie es, war sie noch wertvoll? Wer kannte die Frauen? Wer weiß, wie lange ihr Mann krank gewesen war, ein lebender Leichnam? Wie lange die Arme ihre natürliche Lebensfreude hatte hemmen müssen? Andreas wurde von Mitleid geschüttelt.
Auch heute ließ er eine Augenlidspalte offen, und sein Blick angelte nach der Brust des Mädchens. Aber kein Neid erfaßte ihn, sondern nur der Wunsch zu vergleichen. Jene kurzen Augenblicke im Hof hatten genügt, um ihm eine Vorstellung von der körperlichen Beschaffenheit der Frau Blumich zu vermitteln. Ach, sie war stämmig, und man sah, wie das knappe Kleid ihre widerspenstig strotzenden Brüste gleichsam im Kampf bändigen mußte; wie sich ihre Hüften breit und versprechend, kraftvoll und wollüstig gegen das Mieder stemmten; wie alles gesunde Fülle war und gar nichts überflüssig. Ein Strom von Leben und Lust kam aus ihren warmen Händen, und wie zwei kecke Wünsche waren ihre braunen, ein wenig rotgeweinten Augen.
War ein Mann wie Andreas einer solchen Frau ebenbürtig? Was gab er ihr? Gesund konnte man ihn wohl nennen, obwohl das fehlende Bein manchmal, vor den Regentagen, schmerzte. Das aber hing mit dem schlechten Leben zusammen. Er war stramm, er hatte breite Schultern, eine imponierend schmale und knöcherne Nase, schwellende Muskeln, dichtes braunes Haar und, wenn er nur wollte und sein Angesicht straffte, den kühnen Adlerblick eines Kriegsmannes, besonders, wenn der dunkle, noch lange nicht graue Schnurrbart nach beiden Enden hin flott gezogen war und mit Vaseline gefettet. Auch war er in Dingen der Liebe kein unerfahrener Knabe mehr, und gerade jetzt, nach langer Enthaltsamkeit, von vielversprechender Manneskraft gefüllt. Er war der Mann, eine anspruchsvolle Witwe zufriedenzustellen.
Mit diesen stolzen Gedanken schlief Andreas ein, mit ihnen wachte er auf. Zum erstenmal, nach langer Zeit, blickte er beim Ankleiden ausdauernd und peinlich genau in einen Spiegel, wie vor dem Appell in der Militärzeit. Das metallene Kreuz hauchte er an und rieb es am Ärmel blank, so daß es möglichst strahlend wurde. Dreimal setzte er den Kamm an, ehe er die gerade Linie des Scheitels gefunden hatte. Sein erster Weg führte in die Pestalozzistraße.
Unterwegs fiel ihm ein, daß er sich nicht oft genug rasieren ließ. An zwei Tagen in der Woche, Freitag und Dienstag, pflegte er die Lehrlingsschule der Barbiere aufzusuchen, wo die Lehrlinge schmerzhaft, aber umsonst die Bärte kratzten. Diese Lehrlingsschule sowie die Übung, sich nur zweimal wöchentlich rasieren zu lassen, erschienen Andreas unwürdig eines Mannes, der gesonnen war, dauernden und erfolgreichen Eindruck auf eine schmucke Witwe zu machen. Und jener siegreiche Leichtsinn, dem wir selig unterliegen, wenn wir einer Eroberung sicher sind, ergriff auch Andreas Pum gewaltsam und ward stärker als seine sonst so wachsame Besonnenheit. Andreas begab sich in eine Barbierstube, die sich nicht mit Unrecht Frisiersalon nannte, und begegnete, obwohl sein Leierkasten ein wenig Verwunderung hätte erregen müssen, dennoch derselben herzlichen und warmen Höflichkeit, die allen Eintretenden aus den Friseurläden wie eine milde Frühlingsluft entgegenströmt.
Er sah sich im Spiegel, das Gesicht weißbestäubt von Puder, seinen Scheitel glänzend von Öl, und den vornehmen Duft, der von ihm selbst ausging, atmete er mit stolzem Behagen. Der Entschluß, die Lehrlingsschule überhaupt nicht mehr, dafür aber diverse Friseurläden um so häufiger zu besuchen, wuchs in ihm unerschütterlich. Er straffte die Kopfhaut, die Stirn, rief die zwei kleinen imponierenden Falten an der Nasenwurzel hervor und brachte so den Adlerblick zustande, den er immer in den entscheidenden Augenblicken seiner militärischen Laufbahn angelegt hatte. Dann gelang es ihm, mit einer solch vornehmen Bewegung den Leierkasten umzuhängen, daß er fast einem Rechnungsfeldwebel glich, der seinen Säbel umschnallt.
Bedenken verschiedener Natur und Wichtigkeit überfielen ihn erst auf der Straße, in der Nähe des Hauses Nummer 37, wie eine lästige Fliegenschar. Er kam sich wie ein hartherziger Egoist vor, ein kalter Mensch und ein eitler obendrein, der ohne Rücksicht auf den schmerzvollen Tag der Witwe Blumich, vielleicht den schmerzvollsten ihres jungen Lebens, geckenhafte Toilette gemacht hatte. Was würde sie denken, wenn er so vor ihr erschiene, nachdem sie ihn gestern in seinem gewöhnlichen Zustand gesehen hatte? Würde sie nicht mit Recht beleidigt, getroffen, ja schmerzlich bewegt sein? Es war vielleicht überhaupt nicht günstig, heute die Witwe Blumich zu besuchen. Man müßte sich ein wenig auch vor dem toten Mann schämen, der noch nicht in der Erde lag. Andreas hätte eigentlich sehr viel Grund zu warten, der Witwe Zeit zu lassen, bis sie mit ihrem ersten Mann vollkommen ins reine kommen würde. Außerdem hatte sie ihn ja selbst nicht etwa für heute, sondern erst für morgen bestellt, ja man konnte sagen: gebeten.
An diesem Tage hatte Andreas Pum so viel Glück wie noch nie, seitdem er mit der Drehorgel in die Höfe wanderte. Sei es, weil die ungewöhnlich heiße Stunde alle Leute zwang, ihre Fenster weit offen zu halten, und sie den Klang einer Musik zum erwarteten Anlaß nahmen, Luft zu schöpfen und sich über die Brüstungen zu lehnen, sei es, weil ihnen der frischrasierte, saubere und mit einem glänzenden Kreuz gezierte Andreas ganz besonders sympathisch erschien – wir wissen nicht, wieso es kam, daß es rings um Andreas Geld regnete und daß er Mühe hatte, sich zu bücken, so oft mußte er es tun. Es war kein Zweifel mehr: das Glück war zugleich mit der Witwe Blumich in sein Leben getreten. Und lächelnd, mild und gütig, wie die Strahlen der untergehenden Sonne, die noch auf den Giebeln der Häuser ruhte, kehrte Andreas heim, lange noch vor Anbruch der Dämmerung, einen herzlichen Gruß für Willi auf den Lippen und mit einem gesegneten Appetit, der oft eine angenehme Begleiterscheinung einer gesunden Zufriedenheit zu sein pflegt.