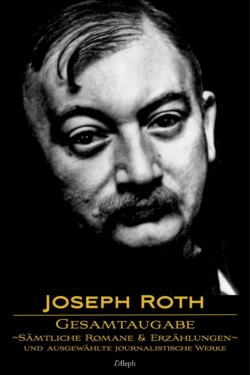Читать книгу Joseph Roth: Gesamtausgabe - Sämtliche Romane und Erzählungen und Ausgewählte Journalistische Werke - Йозеф Рот - Страница 81
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VII
ОглавлениеHerr Arnold war groß, gesund, satt und dennoch unzufrieden. Das Geschäft florierte. Daheim wartete seiner eine treue Gattin, die ihm zwei Kinder geboren hatte: einen Knaben und ein Mädchen, genau so, wie er es sich gewünscht. Seine Anzüge saßen gut, seine Krawatten waren immer modern, seine Taschenuhr ging richtig, sein Tag war mit einer wohltätigen Genauigkeit eingeteilt. Keine unangenehme Überraschung konnte ihm die milde Ordnung seines Lebens stören. Es schien fast ausgeschlossen, daß ihm je eine Morgenpost den peinlichen Bettelbrief eines unbegüterten Verwandten bringen würde. Er hatte keine armen Verwandten. Er stammte aus einer wohlhabenden Familie, in der es keine Zwistigkeiten gab. Alle ihre Mitglieder einte eine versöhnende Sorglosigkeit und eine verwandte Art, die Welt zu sehen, die Politik zu beurteilen, den persönlichen Geschmack zu zeigen, die jeweils herrschende Mode zu kritisieren oder mitzumachen. Im Hause Arnolds gab es nicht einmal jene häuslichen Kümmernisse, deren Ursachen gewöhnlich in einem mißratenen Leibgericht zu suchen sind. Sogar die Kinder lernten gut, benahmen sich züchtig und schienen zu wissen, welche Verantwortung sie dem Namen ihres Vaters und seiner nicht unerheblichen Abstammung schuldig waren.
Dennoch litt Herr Arnold an einer chronischen und, wie man sieht, unbegründeten Unzufriedenheit. Er selbst wußte freilich Gründe genug. Einerseits regten ihn die Zeitverhältnisse auf. Er hatte von seinen Ahnen einen ausgeprägten Sinn für Ordnung geerbt, und ihm war, als gingen die Tendenzen der Gegenwart dahin, diverse Ordnungen zu stören. Andererseits näherte er sich jenem Alter eines Familienvaters, in dem eine weibliche Abwechslung zur Erhaltung des inneren Gleichgewichts nötig wird. Dieser Liebesdrang aber verursachte eine gewisse Unsicherheit, welche die Ordnung des Tags und noch mehr der Nacht zu sprengen drohte, und teilte sich allmählich der ganzen Tätigkeit des Herrn Arnold mit, beeinflußte die großen Abschlüsse und sogar die Erledigung der Korrespondenz; insbesondere diese, weil Arnold die Briefe der jungen Veronika Lenz, die geradezu absichtlich diesen Namen trug, zu diktieren pflegte.
Nun war Fräulein Lenz allerdings so gut wie verlobt. Dennoch hätte sich ein in den Dingen der Verführung mehr geübter Mann durch diese Tatsache nicht abhalten lassen. Gerade die mangelnde Übung hatte bis jetzt den Herrn Arnold ausgezeichnet, seine Solidität unterstützt, seinen Ruf begründet und ihm die Kraft gegeben, sich gegen die zersetzenden Erscheinungen des gegenwärtigen Lebens zu empören. Ach! wie bangte ihm vor dem Tag, an dem er sich in den traurigsten Widerspruch zu seiner ganzen Existenz bringen würde, und wie sehnte er diesen Tag herbei! Wie mußte er sich stündlich vor sich selbst, vor seiner Umgebung, seinem Kompagnon, seiner Frau und seinen Kindern in acht nehmen. Und wie schwer fiel es ihm!
Denn es war nicht leicht, Veronika Lenz zu vergessen, ein hellblondes Mädchen mit kräftigen Händen und einem merkwürdig zarten Angesicht, in einer sehr vorteilhaften Kleidung, welche die wichtigsten Bestandteile des Körpers mit einer aufregenden Deutlichkeit ahnen ließ. Unvergeßlich blieb sie besonders an jenen Tagen, an denen sie in einer dunkelgrünen ärmelfreien Bluse erschien und ein braunes Muttermal in der warmen, blauschattenden Ellbogenhöhlung sichtbar machte. Diese Stelle zu küssen, wünschte sich Herr Arnold.
Er zweifelte nicht daran, daß es ihm gelingen würde, wenn er nur erst einmal den Entschluß gefaßt hätte. Denn seine breitschultrige rötlichblonde Männlichkeit mußte imponieren; obzwar sein Angesicht ein erblicher Fehler störte, der in verschiedenen Gesichtern der Familie Arnold seit Jahrhunderten schon heimisch war. Herr Arnold besaß eine schiefe, unten abgeplattete Nase. Das rührte von der schiefstehenden Scheidewand her, welche das eine Nasenloch rund, das andere dreieckig gestaltete. Immerhin versuchte die Natur, die auch in ihrer Bosheit noch gütig ist, diesen Fehler dadurch zu mildern, daß sie das Nasenende fleischig, platt und beweglich machte. Diese Rührigkeit konnte gelegentlich die schiefen Löcher als eine momentane Verschiebung gelten lassen, etwa durch ein zu starkes Schneuzen verursacht. Den flüchtigen Betrachter täuschte überdies auch der buschige, rötliche Schnurrbart, der die Nase als einen Gesichtsteil zweiten Ranges erscheinen ließ und sich auf ihre Kosten hervorragend bemerkbar machte.
Unbezweifelbar männlich waren alle anderen Merkmale der Arnoldschen Körperlichkeit. Schritt er, Briefe diktierend, durchs Zimmer, so seufzte die Diele unter seiner kräftigen Sohle. Er hatte die Gewohnheit, mit vorgeneigtem Körper, die Hände in den Rocktaschen, auf einem Fuß eine Weile lang stehenzubleiben und mit der Spitze des anderen den Teppich zu berühren, so daß er von ferne an die Stellung einer Statue gemahnte, die einen eilenden Mann in einem bestimmten Moment seines Laufes festhält. Erst nach zwei oder drei Sekunden berührte die Ferse des anderen Fußes den Boden. Die Schritte waren gewaltsam breit und raumfressend. Das Diktat klang streng, und der Stil der Briefe erinnerte, auch wenn sie Höflichkeiten enthielten, an Rügen und Verweise. Obwohl Herr Arnold bereits seit mehr als zehn Jahren für die Firma Briefe zeichnete, bereitete ihm seine Unterschrift doch immer neue Freude. Denn sie war, und wurde sie auch noch so oft gegeben, wie eine Bestätigung der Arnoldschen Macht und rein als graphische Erscheinung ein imponierendes Ornament. Deshalb verrichtete er seine Unterschriften in einer atemraubenden Stille, schnell und dennoch sorgsam, in der Linken die Löschwiege als ein Mittel, die scharfe Wirkung des tintenfeuchten Namens zu beschwichtigen.
Indessen stand Veronika Lenz hinter seinem Stuhl und bezauberte ihren Herrn, ohne es zu wollen. Es war gewiß, daß sie keine anderen Absichten hegte, als die Korrespondenz gewissenhaft zu erledigen und die Stätte ihrer Arbeit schnell zu verlassen. Aber gerade daran zweifelte Herr Arnold. Denn sowenig er auch sonst vom Leben der jungen Mädchen dieser Zeit wußte, so viel schien ihm doch sicher: daß jemand, der so gut wie verlobt war, noch keine Braut genannt werden konnte. Diese Bezeichnung allein hätte ihn mit jenem distanzierenden Schauder erfüllt, den wir den geweihten und heiligen Namen gegenüber empfinden. An sündhafte Beziehungen zu fremden Bräuten dürfen wir nicht einmal im Traum denken. Es gleicht fast einem Ehebruch. Einem Raub fremden Gutes. Einem tückischen Diebstahl. Wir aber leben in einer Welt, in der das Eigentum des Nächsten geschont werden muß. Wo kämen wir denn sonst hin!
Dagegen bedeutet eine Verlobung, die noch nicht feststeht und die unter gewissen Umständen überhaupt nicht zustande kommen könnte, noch keinen heiligen Brautstand. Ja, sie gleicht viel eher einem weniger heiligen Verhältnis, auf das man keine Rücksichten zu nehmen braucht – insbesondere, wenn man weiß, daß jener Mann ein Tunichtgut ist, ein Artist, ein Komödiant, der durch die Städte der Welt reist und wahrscheinlich in jeder Stadt ein Mädchen besitzt. Ihn macht man nicht arm. Ihm raubt man gar nichts. Man tut – im Gegenteil – vielleicht ein gottgefälliges Werk, indem man dem Mädchen die Augen öffnet und ihren stumpfen Sinn für die bitteren Wirklichkeiten dieser Erde schärft, die man nur vergessen und besiegen kann in kurzen, vorübergehenden und vor allem folgenlosen Räuschen.
Nachdem Herr Arnold durch derlei sorgfältige Überlegungen dazu gekommen war, den außergewöhnlichen Zustand seiner Verliebtheit als einen gewöhnlichen Wohltätigkeitsdrang erscheinen zu lassen, verlor er die Angst vor den Schwierigkeiten, die sich seiner Eroberung entgegengestellt hatten. Und so geschah es, daß er eines Tages, während er Unterschriften gab, die Löschwiege langsam hinlegte, seine Feder in das Tintenfaß steckte und – sich schnell erinnernd, daß man Federn ohne Schaden nicht in der Tinte lassen könnte – sie sofort wieder auf dem eisernen Haltergestell sorgfältig plazierte. Hierauf wandte er seinen Kopf, streckte beide Arme hoch und umklammerte den süßen, gebückten Nacken des blonden Mädchens.
Veronika Lenz stemmte sich gegen die umarmenden Hände, deren Druck stärker war und siegreich blieb. Sehr erschrocken und stöhnend in vergeblicher Abwehr mußte sie ihr Angesicht der Wange des Herrn Arnold nähern. Sie sah dabei die rötlichen Haarbüschel in seinen Ohren, roch den kalten Dunst von Zigarren und menschlichem Fett, der aus den Fugen zwischen Kragen und Hals des Mannes zu strömen schien. Die Rückenkante des Stuhls schnitt schmerzhaft in ihren Leib. Sie schloß die Augen, wie um den Tod zu erwarten, und fühlte einen Biß auf ihrer Wange.
Jetzt erst riß sie ihren Kopf heftig zurück, spuckte auf den Nacken des Herrn Arnold, raffte Jacke, Hut und Tasche zusammen und stürzte hinaus.
Arnold blieb nur eine Hoffnung: daß dieses Mädchen, das er jetzt haßte, nicht mehr kommen würde. Er wollte ihr sofort eine größere Summe anweisen lassen. Diesen beschämenden Vorfall würde er einmal schon vergessen. Man kommt über alles hinweg. Arbeiten und nicht verzweifeln! Allzeit Kopf hoch! Auch der Klügste begeht Dummheiten. Und schon träumte er, daß ein Jahr verflossen und das Ereignis begraben sei unter der wuchtigen Fülle von dreihundertfünfundsechzig arbeits-und abschlußreichen Tagen.
Also sein aufgeregtes Gemüt besänftigend, begab er sich im Automobil nach Hause, trat er mit lautem, herablassendem Gruß in sein Zimmer, küßte er beide Wangen seiner immer noch schönen Frau, versprach er den Kindern Geschenke zu Weihnachten, fand er ein leutseliges Wort für das Dienstmädchen, schüttete er Gnaden über sein Haus. Dann schlief er eine lange, ruhige, gesunde Nacht und fuhr des Morgens pfeifend ins Geschäft.
Hier aber unterbrach Luigi Bernotat, ein Tierstimmenimitator aus dem Rokoko-Varieté, Herrn Arnolds zuversichtliche Laune. Luigi Bernotat, ein Mann von höflichen Formen, entschuldigte sich zuerst, daß er so früh schon störe, und begann, ohne zu zögern, von seiner Braut zu sprechen, die durch eine bedauerliche Zudringlichkeit eines Herrn dieses sonst so angesehenen Hauses gezwungen sei, den Dienst aufzugeben und eine Abfertigung zu verlangen.
»Mit dem größten Vergnügen«, unterbrach hier Herr Arnold Luigi Bernotats wohlgesetzten Vortrag.
»Das ist sehr nett«, sagte Bernotat, »aber im Grunde nur Ihre Pflicht. Darüber hinaus fühle ich, als der Verlobte der Dame, mich schwer gekränkt. Ich bin also gekommen, um Ihnen anzukündigen, daß ich den Gerichtsweg beschreiten werde, daß ich fest gesonnen bin, den Gerichtsweg zu beschreiten – schon um ein Exempel zu statuieren.«
Jetzt entstand eine drohende Pause.
Herr Arnold ergriff das blanke Lineal aus Eisen; er drückte die Finger an das kühle Metall, es tat ihm wohl und vertrieb wenigstens an einer Körperstelle und für eine kurze Weile die plötzliche Hitze, die sich seines ganzen Leibes bemächtigt hatte. Er will erpressen, er will erpressen, ich bin hereingefallen, ich bin schön hereingefallen, dachte Herr Arnold. Dann stand er auf und sagte:
»Wieviel wollen Sie?«
Luigi Bernotat schien diese Frage erwartet zu haben. Denn wie ein Schauspieler, dessen Stichwort gefallen, begann er langsam und sicher, mit künstlichen Pausen und abwechselnd sehr schnell fließendem Vortrag eine Rede, und seine Stimme bannte ihren Zuhörer so, daß er eine kurze Zeit nur auf das mähliche Steigen und Fallen des Tones hörte, ohne zu unterbrechen.
»Sie denken wohl«, sagte Luigi Bernotat, »ich wäre ein Erpresser? Wie sollten Sie auch anders? Menschen Ihresgleichen glauben natürlich, daß die Ehre eines Mannes käuflich ist. Die meinige nicht! Bei mir nicht, Herr Arnold. Sie selbst werden dafür einstehen, was Sie zu unternehmen gewagt haben. Noch gibt es Gerichte. Sie glaubten, ein Artist würde das nicht so genau nehmen? Die Braut eines Geschäftsfreundes oder eines Rechtsanwalts, eines Studenten oder eines Offiziers hätten Sie nicht berührt. Ich werde Sie darüber belehren, daß auch die Braut eines Artisten kein Freiwild ist. Ich könnte Sie fordern, wenn ich nicht der Antiduell-Liga angehören würde. Glauben Sie nicht, daß ich feige bin. Man kennt mich. Ich habe den bekannten Martin Popovics, seinen Namen werden Sie bestimmt schon gehört haben, den Kunstbläser Popovics, zweimal geohrfeigt, weil er einen dummen Witz gemacht hat. Übrigens bin ich Amateurboxer. Ich bin also, wie Sie sehen, nicht feige. Aber ich verleugne meine Grundsätze nicht. Konsequenz ist das wichtigste im Leben. Seien Sie ein konsequenter Mann und tragen Sie die Folgen.«
Herr Arnold stand schweigend, weil der Stimme beraubt. Er beobachtete die rote, schwarz und braun gestreifte Schleife seines Gegners, die keck und wie ein Requisit der Lebensfreude über die beiden Kragenenden hinausragte. Es wurde sehr still, nachdem Luigi Bernotat mit erhobener Stimme seine Rede beendet hatte. Plötzlich begann Bernotat zu trillern. Er wollte offenbar seinen frechen Übermut beweisen, indem er eine Lerche täuschend imitierte. Sein Pfeifen schwoll an, und bald war es, als jubilierte ein ganzer Lerchenchor.
Da schrie Herr Arnold: »Trillern Sie hier nicht, Sie frecher Lausbub!«
Luigi Bernotat verneigte sich: »Das werden Sie beweisen«, sagte er leise und gar nicht konsequent, und er tänzelte, nachdem er sich noch einmal verneigt hatte, elegant hinaus.
Herr Arnold übersah, trotz seiner Aufregung, die ganz gefährlichen Folgen dieses Besuches nicht. Da hatte er was angerichtet! Fünfundvierzig Jahre eines anständigen Lebenswandels, eines tadellosen Rufes, eines glänzenden Geschäftsganges waren gefährdet. Und ohne lange zu überlegen, fuhr er zu seinem Rechtsanwalt.
Freilich war dieser abwesend und beim Gericht. Ein Narr, wer es anders erwartet hätte! Wozu haben wir eigentlich unsere Rechtsanwälte? Damit sie verschwinden, sobald wir ihren Rat gebrauchen. Unsere Hausärzte? Sie kommen erst, wenn wir gestorben sind, und schreiben unsere Totenscheine. Unsere Büromädchen? Sie bringen uns eines dummen Witzes wegen in die allergrößte Verlegenheit. Unsere Frauen? Mit ihnen können wir überhaupt nicht sprechen, wenn unser Herz voll ist; unser Unglück löscht nur ihren ewigen Rachedurst. Unsere Kinder? Sie haben ihre eigenen Sorgen, und wir Väter sind womöglich ihre Feinde.
Und obwohl alle diese Verhältnisse seit Jahrhunderten wahr und gültig sein mochten, so war doch vieles von dem, was den besonderen Fall Bernotat, Lenz und Arnold betraf, eine Schuld dieser Zeit; dieser entsetzlichen Gegenwart, deren Tendenzen dahin gingen, diverse Ordnungen zu zerstören. In welchem Zeitalter der Weltgeschichte wäre es sonst möglich gewesen, daß ein kleines Büromädchen ihren Verlobten zu ihrem Brotgeber schickte? Daß dieser »Bräutigam« – Herr Arnold dachte diese Bezeichnung in Gänsefüßchen – zum Chef eines altangesehenen Hauses käme und Rechenschaft forderte – notabene ein Bräutigam, der ein Zirkusmensch ist! In welcher anderen Zeit hätte diese Hefe der menschlichen Gesellschaft noch so viel impertinenten Mut aufgebracht?
Herr Arnold schickte das Auto weg und ging durch die Straßen. Er aß in einem Restaurant. Mochte seine Familie auch ein bißchen aufgeregt sein. Hatte er vielleicht die Verpflichtung, seit Jahren pünktlich heimzukommen? Mochten sie zu Hause nur glauben, ihm sei ein Unfall zugestoßen.
Im Gasthaus schien der Kellner eine so auffällige Erscheinung wie Herrn Arnold nicht bemerken zu wollen. Arnold zerschlug mit einem schweren Messergriff ein Salzfaß und nahm mit der wortlosen Gekränktheit eines gewaltigen Tyrannen die demütige Entschuldigung des feierlichen Direktors entgegen.
Dann trank er einen Mokka, um die Müdigkeit niederzuringen. Dennoch mußte er noch auf der Straße gegen den Schlaf ankämpfen, der mit der Zähigkeit einer langjährigen Gewohnheit auftrat.
Herr Arnold ging durch fremde Straßen mit eiligen Schritten, als wollte er bald ein Ziel erreichen. Mit jedem Schritt merkte er, bitter und dem Weinen nahe, wie wenig er eigentlich bedeutete. Man geht so durch die Welt, durch sein eigenes Land, durch seine Heimat, für die man fünfundvierzig Jahre geschuftet hat – und ist ein Niemand. Vor fremden Automobilen und Wagen muß man sich in acht nehmen. Die Lümmel von Polizisten sehen stolz auf uns herab. Gemeine Menschen aus den unteren Schichten des Volkes, versoffen und zerlumpt, gehen uns nicht aus dem Wege. Geschäftsdiener mit Gepäckstücken stoßen uns an. Sechzehnjährige Burschen bitten mit der Miene ernster Männer um Feuer für ihre Zigarette. Es fällt uns aber nicht ein, stehenzubleiben und Rotzbuben Gefälligkeiten zu erweisen. Auf Schritt und Tritt erkennt man die zersetzenden Tendenzen dieser Zeit. Dieser gottverlassenen Gegenwart!
Die Dämmerung senkte sich rasch über die Welt. Die ersten Laternen erglommen. Ein hinkender Mann stellte sich Arnold in den Weg. Er trug auf Brust und Rücken ein aufreizendes Plakat. »Genossen!« – so begann es, »die Not der Invaliden kennt keine Grenzen. Die Regierung ist ohnmächtig!« In diesem Ton ging es weiter. Das war ja auch eine schöne Bande! Bettler, Diebe und Einbrecher. Viele waren ja gar nicht echt. Simulierten Schmerzen. Gaben vor, Krüppel zu sein! Eine nette Gesellschaft. Die Regierung ließ das zu. Auf öffentlichen Plakaten schreiben sie: Genossen! Ein schreckliches Wort. Anarchistisch. Zersetzend. Es riecht nach Bomben. Die russischen Juden erfinden solche Bezeichnungen. Der Polizist stand in der Nähe und griff nicht ein. Dafür zahlt man die horrenden Steuern! Schrecklich, so was! Da ist ja auch das Versammlungslokal! Hinein strömen sie! Auffallend wenig Krüppel. Drei oder vier Blinde mit Hunden. Aber sonst? – Tagediebe, Bettler, Gesindel.
Es war spät. Man mußte heim. Am besten, man bestieg eine Straßenbahn.
Hätte der Herr Arnold, wozu er wohl in der Lage gewesen wäre, ein Auto genommen, um heimzukommen, er wäre der letzten Aufregung dieses furchtbaren Tages entronnen und sein Weg hätte sich nicht unheilvoll mit jenem des Leierkastenmannes Andreas Pum gekreuzt. So aber richtet es ein tückisches Geschick ein: daß wir zugrunde gehen, nicht durch unsere Schuld und ohne daß wir einen Zusammenhang ahnen; durch das blinde Wüten eines fremden Mannes, dessen Vorleben wir nicht kennen, an dessen Unglück wir unschuldig sind und dessen Weltanschauung wir sogar teilen. Er gerade ist nun das Instrument in der vernichtenden Hand des Schicksals.