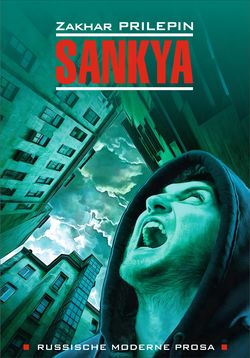Читать книгу Sankya / Санькя. Книга для чтения на немецком языке - Захар Прилепин - Страница 3
Kapitel 2
ОглавлениеSascha trennte sich von Wenja und Ljoschka an der Metro. Sie hatten entschieden, dass sie einzeln weniger Verdacht erregen würden.
Er fuhr aus Moskau in seine Provinzstadt – fünf hundert Werst von der Hauptstadt entfernt – mit der Elektritschka*, oder, wie es seine Freunde nannten, mit dem »Hundefuhrwerk[54]«. Er saß einsam in der Ecke des Waggons, bisweilen schauderte es ihn beim Gedanken an das kürzlich Geschehene, dann wieder erfasste ihn erneut der Rhythmus der Ereignisse, wenn alles klirrt und zerbricht. Sascha hörte sich in diesen Rhythmus hinein, es fühlte sich gut an.
Die Stadt hatte sich als schwach erwiesen, wie Spielzeug, sie zu zerbrechen war genauso sinnlos wie Spielzeug zu zerbrechen: Drinnen war nichts – es war nur leeres Plastik. Und das kindliche Gefühl des Triumphes, dieses überwältigende Gefühl, die Dinge im Griff zu haben, kam daher, dass alles viel einfacher war, als es schien …
Immer wieder kamen Kontrolleure vorbei, Sascha ging auf die Plattform, beäugte durch das trübe Glas ihre blaue Kleidung, die strengen Gesichter. Beim nächsten Halt lief er über den Bahnsteig am Waggon mit den Kontrolleuren vorbei und setzte sich wieder in die Ecke.
Manchmal saugte er an der zerschlagenen Lippe, sie brannte mittlerweile schon nicht mehr so schmerzhaft – sie heilte wie bei einer Katze.
Der Zug schien lautlos zu fahren, Sascha hörte nichts.
Hinter dem Fenster zogen Verwahrlosung und Trostlosigkeit vorbei. Er spiegelte sich im Glas – kurze Haare mit einem widerspenstigen Schopf, unrasiertes Kinn, dunkle Haut, die Stirn in frühen Falten … Ein gewöhnliches Gesicht.
Sascha kam in seiner Stadt an, die Türen des Zuges klappten hinter ihm zu, als wäre er ein Überbleibsel, das einfach abgeschnitten wurde.
Den blödsinnigen Gedanken, im Treppenhaus würde schon ein Hinterhalt auf ihn warten, verscheuchte er (»… da sie im ganzen Lande Fallen errichtet haben«), und lief ins Haus.
Das Schloss machte das übliche Geräusch, ein weiches Klicken. Die Tür ging auf.
Die Mutter arbeitete in der Nachtschicht, die Wohnung war leer.
Sascha rief einen Bekannten an und bat ihn, ihn ins Dorf zu bringen. Der Mann antwortete missmutig: »Ich fahre heute«.
Er hinterließ der Mutter einen Zettel: »Mama, alles in Ordnung«.
Zum Dorf kam er unter dem üblichen Gerumpel. Die »Kopeke« schepperte, auf der Windschutzscheibe hing statt des Zulassungsscheins ein kleiner Kalender des aktuellen Jahres; die Jahreszahlen in fetter Schrift sollten die Verkehrshüter[55] täuschen. Auf dem Weg ins Dorf sahen sie nur einen Posten, der Milizionär schaute angewidert Richtung »Kopeke« und drehte sich weg.
Der Mann schwieg den ganzen Weg über, horchte manchmal auf den Motor, der die unterschiedlichsten Klappergeräusche von sich gab. Die Abfolge dieser Geräusche erschien Sascha willkürlich. Der Mann aber, so schien es zumindest, konnte alle Bestandteile dieser Kakophonie unterscheiden.
Als sie am Posten vorbeikamen, verkrampfte der Fahrer ein wenig, seine Augen wurden schwerer, er hielt das Steuer fester und konzentrierte sich allein auf die Straße, da er befürchtete, er könnte den Milizionär mit seinem Blick streifen – als wäre es der Leibhaftige höchstpersönlich. Einen Augenblick später war der Fahrer wieder ruhig. Und Sascha vermutlich auch.
Bald nach dem Posten ging die Asphaltstraße in einen Feldweg über. Dieser Feldweg lief, vorbei an Gärten und durch zwei ruhige Dörfer, in denen es nicht einmal Hunde gab, auf einen Fichtenwald zu. Im Wald war es finster. Die über einer ehemaligen Schmalspurbahn verlaufende Straße war eine Folter, es tat regelrecht weh, wenn das Fahrzeug gegen ihre harten Rillen prallte.
Die »Kopeke« irrlichterte mit einem Schweinwerfer in die Gegend, der zweite gab gerade ausreichend Licht für sich selbst. Im Lichtkegel bogen sich Äste mit zitterndem Laub. Angst vor Dunkelheit und Bäumen von irgendwo aus der Kindheit überkam ihn, Sascha zündete sich eine Zigarette an – es verging wieder.
Er erinnerte sich daran, wie er dem Vater einmal beim Mähen geholfen hatte, Sascha war damals etwa zehn. Eigentlich mähte der Vater, wenn er aber eine Rauchpause machte, unternahm Sascha seine Mähversuche, sonst rechte er das vom Vater gemähte Gras in Reihen. Die Dämmerung brach herein, sie hätten mit dem Lastwagen abgeholt werden sollen, doch niemand kam. Der Vater zündete ein Feuer an. Sascha sammelte Äste, er hatte Angst, sich vom Feuer zu entfernen. Der Vater aber verschwand von der Wiese in den Wald, Sascha hörte voller Angst das Knacken der brechenden Äste; plötzlich erschien der Vater wieder, seine Beute war reich. Das Feuer flammte auf, das Geäst knackte.
Jetzt kommt diese Wiese … Hier ist sie.
Der Lastwagen war schließlich doch noch gekommen. Der Vater sagte zum Fahrer: »Ich werde hier übernachten.« Als sie wegfuhren, blickte Sascha aus dem Fenster des Lastwagens. Der Vater stand vom Feuer abgewandt. Sein Gesicht konnte Sascha nicht sehen.
»Was? Was wäre gewesen, wenn du’s gesehen hättest? … Was hättest du gesehen?«
Die Stimme war ironisch, ja erregt. Sascha mochte diese Stimme nicht und antwortete ihr nicht. Einen Moment lang zog er die Augen zusammen und versuchte sich abzulenken.
Die verdreckte Windschutzscheibe. Der Kalender. Die abgeschlagene Sonnenblende. Das Innere des Handschuhfachs mit der abgebrochenen Klappe. Sascha legte die herausfallenden Streichhölzer zweimal zurück, dann warf er die Schachtel nebenden Schalthebel. Die Bartstoppeln des Fahrers.
Im Dorf verrottete langsam das Haus des Fahrers.
Saschas Großvater und Großmutter lebten auf dem Dorf, die Eltern des Vaters. Er hatte sie ein Jahr lang nicht gesehen. Weder im Herbst noch im Winter konnte man ins Dorf fahren, auch im Frühjahr war es fast unmöglich – es sei denn, der Mai war trocken und warm. Es sei denn – mit einem Traktor. Selten wagte sich jemand mit einem anderen Transportmittel dorthin.
Er wollte nicht mehr rauchen, die Zigaretten verkürzten nicht wie sonst den Weg, sondern waren wie dieser fad und geschmacklos; als das Auto über eine Rille des schmalen Weges holperte, fiel Asche auf die Hose, und der Fahrer sah mit scheelem Blick, wie Sascha leuchtende Fünkchen von sich wischte.
»Trottel«, beschimpfte Sascha sich selbst und bedauerte die durchgebrannte Hose, die nicht zu Ende gerauchte Zigarette warf er aus dem Fenster.
Sascha rutschte den Sitz hinunter, fast liegend streckte er die Beine und versuchte wenigstens für kurze Zeit, den von der Fahrt ermüdeten Körper zu entspannen. Eine weitere Unebenheit schleuderte Sascha zum Fahrer hin. Sascha wollte sich entschuldigen, überlegte es sich aber anders, und starrte aufrecht sitzend geradeaus.
… Im Kopf sammelten sich ziemlich wirre und für Sascha gleichgültige Dinge. Im nächsten Moment bemerkte er verwundert dieses Gekrabbel seiner – wie er meinte – Gedanken; eine flaue Wirrnis unkontrollierbarer Bemerkungen, eine Verbindung von etwas Undeutlichem mit schon Vergessenem.
Einsamkeit, so schien es Sascha, ist gerade deswegen unerreichbar, weil man in Wahrheit nicht mit sich selbst allein bleiben kann – unberührt von den Reflexen, die in dir jene hinterlassen haben, die an dir nur vorbeikamen, ohne besondere Beleidigung, Fehler und Verletzungen. Was sollte das für eine Einsamkeit sein, wenn der Mensch ein Gedächtnis hat – es ist immer da, streng und ruhig.
»Was ist das für eine Einsamkeit«, überlegte Sascha, »wenn alles, alles in dir und von dir Erlebte einem Eisverkäufer gleicht, der alles verkauft hat, mit seinem Bauchladen dennoch weiterzieht, ihn dann neben sich abstellt, wenn er sich schlafen legt, kalt …« Er grinste verschmitzt über sich selbst. »Irrsinn. Was für ein Irrsinn«, sagte eine Stimme. Sascha antwortete wieder nicht, aber dieses Mal stimmte er zu.
Das Dorf war dunkel, in vielen Häusern brannte kein Licht.
Für Sascha gab es keinen Grund, irgendwie lebendiger zu werden, nur weil er an den Ort zurückkehrte, an dem er aufgewachsen war.
Er hatte schon seit langem den Eindruck, es sei schwierig, bei der Rückkehr ins Dorf Freude zu empfinden, so trost- und farblos war, was sich dem Blick darbot.
Einige Dorfbewohner, die der »Kopeke« am Straßenrand langsam entgegenkamen, blieben stehen und schauten ins Auto. Wer ist das, zu wem kommen sie? Sascha versuchte, die Herumstehenden nicht anzuschauen, um nur ja niemanden zu erkennen. Alles war fremd.
Der Fahrer fuhr zu seinem Haus.
»Findest du hin?«[56] Das klang kaum wie eine Frage, eher wie eine ausdruckslos einfache Feststellung.
»Ich finde den Weg«, sagte Sascha, der sich Mühe gab, es nicht wie eine etwa beleidigte Antwort klingen zu lassen (was ihm schlecht gelang), er kroch aus dem Auto.
Das Geld für die Fahrt hatte Sascha schon in der Stadt gezahlt. Er streckte sich und ging auf der im Dunkel versunkenen Straße Richtung Elternhaus.
Der Weg war verwüstet und voller Dreck[57]. Aus manchen Häusern wurden Abfälle, Essensreste und Spülwasser direkt in die Gräben beim Haus gekippt, die Hühner pickten auf, was sie aufpicken konnten, der Rest verrottete friedlich vor sich hin. Sascha mied die Gräben, er erkannte sie am Geruch und der widerwärtigen Weichheit der feuchten, ringsum verfaulten Erde.
Den Weg zum Haus, das in der benachbarten Straße lag, beschloss er durch den Gemüsegarten abzukürzen. Um all dem Bedrückenden aus dem Weg zu gehen, war es außerdem besser, sich dem Haus unbemerkt, über den Hinterhof zu nähern, und sich so allmählich an Verfall und Verwahrlosung zu gewöhnen.
Er bog in den Trampelpfad ein, die Beine rutschten im Dreck auseinander. Sascha fuchtelte mit den Armen und fluchte leise …
Vergeblich wehrte sich Sascha gegen den Schmutz. Auf dem Weg durch den Gemüsegarten rutschte er trotzdem aus, besudelte sich, die letzten Meter bis zur Gartentür schwankte er, es war unvermeidbar, in den schwarzen Matsch zu treten.
»Und du hast auch nicht vergessen, wie der Riegel aufgeht?«, versuchte Sascha sich aufzumuntern, zusammenzureißen. Mühsam zwängte er die Hand in einen Schlitz der Gartentür (als Kind ging das leichter – mit den feinen Pfötchen) und schob den Riegel zur Seite.
»Nicht vergessen«, wisperte Sascha, und spielte sich selbst gekünstelte Freude vor: Ein letztes Mal gab er seiner Stimmung – wie einer Schaukel – einen Schubs, aber da war keine Freude, nichts.
»Nicht vergessen«, wiederholte er nochmals laut. Dieser Satz gehörte schon nirgendwo mehr hin, bezog sich auf nichts, er musste einfach etwas sagen, schloss die Gartentür und bewegte sich über den Hof zwischen den beiden, vom kranken Großvater nicht mehr genutzten Scheunen und der Getreidedarre. Weiter weg befand sich der Stall, in dem die Großmutter schon ein Jahr lang keine Ziege mehr hielt, seit drei Jahren gab es keine Schweine mehr, schon vor zehn Jahren hatte man die Kuh Domanka von dort auf den letzten Weg geführt. Aus dem Stall kamen keine Gerüche von Leben oder Mist, keine zottige Seele trampelte mehr mit den Hufen, niemand schnaufte, keuchte laut oder erschrak vor Saschas Schritten. Es roch nur nach Feuchtigkeit und Schmutz.
Sascha blickte sehnsüchtig auf das Haus: die kleinen Fenster waren dunkel. Weich und vorsichtig auftretend ging er den verfallenden Zaun entlang, neben der ziegelroten Hauswand, die auf der linken Seite dunkel aufragte, und blieb dann, warum auch immer, an der Hausecke stehen – hinter der Ecke befand sich die Haustür. Am Eingang stand eine Bank, Sascha erinnerte sich daran und wusste, dass die Großmutter immer auf der Bank saß, die weichen und müden Hände in den Schoß gelegt[58].
Auf der Straße neben dem Haus stand ein Kind mit einer Gerte. Während es etwas murmelte, peitschte es mit ihr in die Lache und zischte, hüpfte von den Spritzern weg.
Sascha machte noch einen halben Schritt.
Ja, die Großmutter saß auf der Bank – gleichmütig und regungslos, es schien, als würde sie gar nichts sehen. Und aus dem Verhalten des Kindes, seinem Spiel, seiner Stimme war zu schließen, dass es auch nichts sah, sich an die auf der Bank sitzende Großmutter gar nicht erinnerte. Die Großmutter und das Kind befanden sich gleichsam in unterschiedlichen Sphären.
Die Straße war leer, dunkel und voller Dreck, wie alle anderen Straßen des Dorfes. Hinter dem mit wildem Unkraut überwucherten Garten war die nachbarliche Ordnung zu erkennen, dort leuchteten einige Fenster gelb. Die Sonne ging gerade unter, war schon fast verschwunden.
Das Kind fuchtelte mit der Gerte herum und trampelte auf der Stelle.
Die Großmutter blickte, ohne zu blinzeln, über das Kind, über den Garten, über die Bäume hinweg.
Das Dorf ging seinem Ende entgegen und starb aus – das war in allem zu spüren. Umgewühlt verzog es sich, verschwand – wie ein dunkles Stück Eis trieb es still erstarrt davon. Die verlassenen, aus der Erde wachsenden Scheunen entlang der Straße waren mit ihren feuchten nebeneinander verfaulenden Pfosten ganz schwarz geworden. Auf den Scheunendächern wuchs Gras und sogar dünne Bäumchen bogen sich im Wind, die sich da angesiedelt hatten, aber keinen Grund fanden, in den sie ihre Wurzeln treiben konnten – unter ihren schwachen Wurzelchen befanden sich kalte, leerstehende Gebäude; dorthin, zu den zertrümmerten Milchtöpfen und löchrigen Fässern, schlängelten sich Nattern, die schon niemanden mehr störten. Gebüsch trieb aus und wucherte über den Weg.
Inmitten dieses langsamen, beinahe vollendeten Zerfalls nahm sich das Kind merkwürdig aus, beschämend, deplatziert.
»Saschenka …«, seufzte die Großmutter, als Sascha, die Zähne zusammenbeißend, um sich nicht umzudrehen und durch den Gemüsegarten zu fliehen, einen Schritt machte, die Tasche zu Boden stellte und der Großmutter die Hände entgegenstreckte.
»Wie bist du denn hergekommen, ha?«, fragte sie. »Mit dem Auto, oder? Alleine?«
Sascha antwortete, er sei allein und mit dem Auto gekommen, und sah dabei in das dunkle runde Gesicht der Großmutter und in ihre tränenden Augen.
»Ich dachte schon, wieso kommt Sankya denn nicht«, sagte sie, und Sascha spürte einen leichten Vorwurf in ihrer Stimme. »Briefe schreibt er keine. Opa stirbt und Sascha wird es nicht einmal erfahren …«
»Stirbt« sprach die Großmutter wie »stüabt« aus und das Wort klang deshalb auch viel hilfloser und endgültiger. In ihm war keine Härte – sondern nur Vergänglichkeit.
Das Kind hob den Blick unabsichtlich zu Sascha, der die Großmutter umarmte und küsste, ihre weichen Schultern an sich drückte. Für das Kind war das vermutlich ebenso sonderbar, als hätte Sascha einen Baum oder die Ecke eines Schuppens umarmt.
Sascha hob seine Tasche auf und stand unentschlossen da. Die Großmutter öffnete die Haustür.
»Dem Opa geht’s ganz schlecht, wer weiß ob er den September noch erlebt … Er steht nicht auf, mag nichts essen, nur Wasser trinkt er«, sagte die Großmutter leise, und verließ den Ort des Geschehens.
Sascha wollte nicht in die Hütte gehen, in der Großvater lag, und folgte der Großmutter in die Küche. Nach guter dörflicher Gewohnheit begann sie sofort zu kochen, ohne Fragen, die würden erst später kommen.
In der Küche brannte eine schwache Lampe. Alles war voller Fliegen und als die Großmutter eintrat, flogen einige Fliegen lautlos auf. Nach ein paar Runden landeten sie wieder ruhig, waren satt und faul.
Die Großmutter sprach leise über ihre Söhne. Sie hatte drei Söhne gehabt, Saschas Vater und zwei seiner Onkel, von denen einer Saschas Taufpate war. Alle waren gestorben.
Als erster war der jüngste, Serjoscha, gestorben – er starb mit dem Motorrad, betrunken. Vor zwei Jahren im Sommer kam Saschas Taufpate Nikolaj bei einem Streit im Suff um. Er war der mittlere Sohn. Man begrub ihn neben dem jüngeren Bruder.
Und vor eineinhalb Jahren starb Saschas Vater Wasilij in der Stadt, aus der Sascha gekommen war. Er war der Gebildetste in der Familie, unterrichtete an der Universität, war jedoch auch ein Trinker, am Ende trank er hart und schonungslos[59].
Sascha brachte den Sarg mit dem Vater im Winter … der Weg war ein Alptraum … es war ihm unerträglich, sich an diese Fahrt zu erinnern.
»Ich hab den Hof gekehrt und bin zu Opa gegangen«, erzählte die Großmutter. »Ich fragte: ›Opa, ist es wahr, Wasja ist gestorben? Ich glaube, ich hab das geträumt.‹ ›Ist nicht wahr!‹ sagte er … Wie konnte er nur sterben, Sankya …«
Sascha saß am Tisch, der mit einem alten Tischtuch bedeckt war, und drehte eine Zigarette in den Fingern.
Die Großmutter sagte leise: »Ich setz mich ans Fenster und sitze und sitze. Ich denke, würde mir jemand sagen: Geh tausend Tage barfuß in egal welchem Winter, um deine Buben zu sehen – ich würde sofort gehen. Würde nichts sagen, sie nicht mal berühren, einfach nur sehen, wie sie atmen.«
Die Großmutter sprach ruhig, hinter ihren Worten stand das blanke Entsetzen, jene fast unvorstellbare Einsamkeit, an die Sascha vor Kurzem gedacht hatte, die Einsamkeit, die sich mit ihrer anderen Seite öffnet, die große Einsamkeit, die selbst ihres Echos beraubt ist. Sie antwortete auf nichts, auf keine Stimme.
»Waskja hat so viele Bücher gelesen, steht denn in keinem geschrieben, dass man Wodka so nicht trinken darf?«, fragte die Großmutter Sascha ohne eine Antwort zu erwarten. »Er hat doch unzählige Bücher gelesen, und heißt es dort nicht, dass man vom Wodka stirbt?«
Sascha schwieg.
»Und jetzt liegen sie alle dort draußen. Sie stehen nicht mehr auf, trinken keinen Wodka mehr, fahren nirgendwo hin, sagen niemandem mehr ein Wort. Zu Tode getrunken haben sie sich. Der Opa und ich dachten, wir werden neben dem jüngsten Buben liegen, aber Kolkja und Waskja haben sich in unsere Gräber gelegt. Für uns ist da jetzt nicht einmal mehr Platz.«
Die Großmutter kochte gleichzeitig mit zwei Pfannen – in einer wärmte sie Kartoffeln und Fleisch auf, in der zweiten zischten und zerbarsten Saschas geliebte Karawajtschiki*, dünne, fast durchsichtige Pfannkuchen mit einem süßen, knusprigen, dunklen Muster am Rand. Die Großmutter kochte ohne Hast, geschickt und behände, dachte nicht daran, dass sie kochte, und hätte wahrscheinlich die Augen dabei schließen können, sich im Geiste von dem, was sie tat, ganz und gar entfernen: »Heuer im Winter haben wir die letzten Enten geschlachtet«, erzählte die Großmutter, während sie Kartoffeln und Fleisch in der Pfanne umdrehte, »ich hab keine Kraft mehr, zum Bach zu gehen. Runter geht’s, aber zurück nur mühsam, die Enten warten auf michund rufen mich.«
Die Großmutter wechselte übergangslos von einem zum anderen, es ging aber immer um eines: Alle sind gestorben und es gibt nichts mehr.
»Opa ist völlig taub, er hört nichts mehr … Das letzte Mal ist er im Juni aufgestanden. Er ging aufs Klo und fiel im Hof nieder. ›Warum bist du aufgestanden?‹ fragte ich ihn. ›Ich hab dir doch einen Kübel hingestellt!‹« Er war mit letzter Kraft aufgestanden.
Die Großmutter drehte das Feuer unter der Pfanne mit den Kartoffeln und dem Fleisch zurück, nahm den letzten Karawajtschik aus der anderen Pfanne und ging in die Hütte.
Sascha stand auf, torkelte durch die Küche und ging auf die Straße, um zu rauchen. Beim Hinausgehen hörte er, wie die Großmutter laut zu Opa sagte: »Sankya ist gekommen! Sankya!«
»Sankya? Was kommt er denn nicht herein? Ich höre, dass du dort mit jemandem schwätzt.«
Es war völlig dunkel. Das Dorf war lautlos.
Das Kind war weggegangen. Neben der Pfütze lag seine Gerte.
Die Zigarette brannte. Die Asche fiel nicht hinunter.
Ein Betrunkener stapfte vorbei, ein verkümmertes Männlein, das Sascha nicht beachtete.
»Was kommst du denn nicht zu mir, Sankya?«, fragte der Opa, als Sascha die Hütte betrat und sich an Opas Bett setzte.
In seiner Stimme schwang kaum hörbar die Ironie des Alten mit – fürchtest dich wohl vor mir, deinem sterbenden Opa. Und in der Ironie war zugleich Mitleid zu hören – na ja macht nichts, Jungchen, ich halte dich nicht lange auf.
Opa war dünn geworden, die spitzen Schultern, die schwachen Augen klebten zusammen. Der Großvater bereitete sich aufs Sterben vor. Wenn er sprach, knackste es kaum hörbar im Hals und die Wörter kamen praktisch unverständlich heraus.
»Sterben ist nicht schrecklich, Sankya … Das Leben ist sehr lang. Es reicht schon. Da liege ich jetzt und kann nicht sterben. Ach Sankya, Sankya …«
Sascha blickte den Opa schweigend an.
»Lass ihn doch erst mal essen nach der Reise!«, sagte die Großmutter, die hereingekommen war. »Du wirst noch genug reden können! Du stirbst schon nicht, während er isst!«
»Lass ich ihn etwa nicht essen?«, antwortete der Opa. »Geh essen, Sankya …«
Sascha ging folgsam in die Küche. Der Opa murmelte etwas, sprach mit geschlossenen Augen mit jemandem.
Die Großmutter fragte Sascha nach der Mutter, ob die Mutter nicht wieder heiraten werde, ob er selbst nicht trinke und wo er jetzt arbeite. Die Mutter wird nicht heiraten, Sascha trinkt nicht, zumindest nicht so, wie die Großmutter meinte, über die Arbeit erzählte er Lügen. Er arbeitete, war aber zu faul zu erklären, was er tat. Für die Alten ist Arbeit die Erde pflügen oder Fabrik, oder das Krankenhaus, oder die Schule … Sie haben recht. Aber heute ist diese Arbeit in den meisten Fällen zum Schicksal von nicht sehr erfolgreichen, vom Leben benachteiligten Menschen geworden.
Die Großmutter trug auf – wie man das im Dorf so nannte – und Sanja trank den Selbstgebrannten gerne zu Fleisch und Kartoffeln, um sich ein bisschen zu erleichtern.
Er trank einmal, zweimal, dreimal.
Im Nebenzimmer lag der Großvater im Sterben. Sascha aß mit großem Appetit. Er war hungrig. Die Karawajtschiki schmeckten so gut wie in der Kindheit. Die Großmutter erzählte davon, was im Dorf passierte.
Im letzten Haus in der Straße lebte ein Mann mit Spitznamen Chomut. Sascha kannte ihn gut. Chomut hatte ihn, Sascha, gerettet. Und der Vater hatte Chomut auch gekannt, sie waren befreundet; ihre Freundschaft war unspektakulär und still gewesen.
Chomut war gesund, helläugig, stark wie ein Pferd. Letzten Sommer hatte er sich erhängt. Die Söhne waren aus der Stadt zu ihm gekommen, um im Gemüsegarten zu helfen. Bei der Arbeit im Gemüsegarten zerstritt sich Chomut mit den Söhnen. Er hatte sich mit ihnen noch nie gut verstanden.
Er schimpfte und sagte: »Ich werde es euch jetzt mal zeigen!« Er ging ins Haus. Die Söhne zuckten nur mit den Schultern und arbeiteten weiter. Als sie dann heimkamen, fanden sie den Vater im Schuppen, er hatte sich an einer Querstange erhängt, die Beine angezogen.
Chomut gab’s jetzt also nicht mehr.
Zwei Häuser neben Saschas Geburtshaus lebte ein Mann mit Spitznamen Kommissar gemeinsam mit seiner Mutter. Kommissar wurde er deshalb genannt, weil er in den letzten fünf Jahren nichts getan hatte, als die Dorf bewohner zu beobachten, vom frühen Morgen an stand er an den Zaun gelehnt da. Er ließ sich scheiden, lebte von der Pension seiner Mutter. Sascha spürte in ihm immer etwas Ungesundes. Womit beschäftigt sich so ein vierzigjähriger Bock ohne Frau den ganzen Tag? Die Tochter wächst allein in der Stadt auf, ist noch ganz klein … Bei einem derartigen Leben kann man sich ja nur auf hängen. Aber er hängte sich nicht auf. Zuerst war sein stilles Mütterchen gestorben, und bald starb auch er selbst, irgendwas mit dem Herzen.
Zwei Söhne einer unmittelbaren Nachbarin starben schon damals, als Saschas jüngster Onkel verunglückte[60]. Auch die Nachbarsjungen verunglückten, auch mit den Motorrädern. Das kam so: In den letzten Jahren der ehemaligen Regierung hatte die Bauernschaft – endlich – Fleisch angesetzt und ein wenig Geld angesammelt. Das Erste, was einer aus dem Dorf macht, der sein ganzen Leben im Schweiße seines Angesichts geschuftet hatte: Er verhätschelt sein Kind, wie alt es auch sein mag. In jenen Jahren wollten die Jungs aus dem Dorf vom Fahrrad aufs Motorrad umsteigen. Im Dorf gab es keine Verkehrspolizisten, ja, auch den Revierinspektor sah man monatelang nicht, also fuhren alle betrunken. Und sofort fingen die Unfälle an: Sie verunglückten schrecklich, wurden in Stücke zerfetzt, vor dem Tod segelten sie – schlagartig aus dem Sattel gehoben, fünfzig, ja oft siebzig Meter weit, zertrümmerten ihre blöden Köpfe an Bäumen und Zäunen, brachen sich alle Knochen, ihre Körper verwandelte sich in weichen rosafarbenen Matsch, und manchmal traf es auch junge Mädchen, die auf dem Rücksitz gesessen hatten. Und wenn die Mädels auch nicht starben, so brachen sie sich die Wirbelsäule und lagen dann bewegungsunfähig da, wiederholten in Gedanken jede Minute jenes unglücklichen Abends.
Sascha, der als Kind immer in den Dorfladen gelaufen war, um Brot zu holen, traf dort drei, manchmal fünf und mehr Frauen in schwarzen Kleidern; ihre Söhne waren alle verunglückt. Die Frauen standen da und sprachen leise davon, wie ihre Kinder gelebt hatten und wie sie gestorben waren. Und einige der Wörter, die er im Vorbeigehen aus den schwarzen Mündern der Frauen hörte, schwirrten noch lange in Saschas Kopf herum, ohne den richtigen Platz zu finden.
Manche verließen das Dorf in den letzten Jahren, erzählte die Großmutter; jemand war an einer frühen Krankheit still gestorben, und im Großen und Ganzen war ein einziger Mann übrig geblieben, der – niemand erinnerte sich daran, warum eigentlich – Solowej, die Nachtigall, genannt wurde. Er betrank sich jeden Abend – man wusste nicht wo —, kam nach Hause, schrie seine sprachlose Frau blöde an, die längst schon alles verdammt hatte und in ihrer Ausweglosigkeit verstummt war. Kinder hatten sie keine. Abends hörte man im fast leeren Dorf Solowejs Gebrüll.
War er betrunken, erkannte er kaum jemanden, ging durchs Dorf, ohne etwas zu bemerken, und nur der wehmütige Blick seiner Frau brachte ihn aus der alkoholischen Ferne in die trübe Realität zurück und erweckte bei ihm das geradezu physische Verlangen, zu brüllen und zu schimpfen, ohne übrigens zu wissen, was er dabei von sich gab.
Das war er, Solowej, der da am Haus vorbeiging, als Sascha am Zaun rauchte.
Die Großmutter räumte den Tisch ab und ging, um für Sascha im Zimmer, von Opas Liege durch eine Zwischenwand getrennt, das Bett zu machen.
Während sie das Bett herrichtete, erinnerte sie sich daran, dass in diesem Bett Wasja, ihr eigenes Fleisch und Blut, als kleines Kind geschlafen hatte; nach dem Krieg wurde er neben der Bauernarbeit ohne alles Getue[61] zu einem dünnen, hochaufgeschossenen, aber früh kahl gewordenen Jungen aufgepäppelt, der dann das Elternhaus verließ – zurück kam er als kräftiger junger Mann, in dem allein sie mühelos noch immer dasselbe Kind erkennen konnte. Nun war Wasja also das Blut im Leib gestockt und er hatte aufgehört, zu sein.
Als Wasja das erste Mal Probleme mit dem Herzen hatte, träumte sie von ihm. Im Schlaf lag Wasja auf dem Bett und sagte: »Mama, hier tut es weh, ich kann nicht atmen«, und zeigte auf das Herz.
Sie fuhr sofort zu Wasja und kam unerwartet in die Stadt, in der sie schon zehn Jahre nicht gewesen war und dort musste sieerfahren, dass der Traum Wirklichkeit war.
Sascha brachte sie ins Krankenhaus, in das der Vater eilig eingeliefert worden war.
Der Vater lag ruhig, mit dunklem Gesicht, in sich hineinhorchend[62]. Im Innern schlug das kranke Herz. Die Großmutter saß daneben und blickte ins Gesicht des Sohnes. Der Vater wurde operiert, man schnitt ihm die Brust auf – während die Ärzte zauberten, befand sich sein Herz eine halbe Stunde außerhalb des Körpers. Er überlebte. Er durfte nichts trinken. Als aber bald danach Brüderchen Kolja starb, begann Wasja doch zu trinken. Er betrank sich einmal, dann noch einmal, dann kam er ins Krankenhaus und starb schnell, binnen zweier Tage.
Sascha wusste, dass die Großmutter das Bett machte und zum wievielten Male darüber nachdachte, warum nur, warum sie nicht von ihm geträumt hatte, als Wasja zum zweiten Mal schlecht wurde, warum rief er sie nicht, und nie konnte sie eine Antwort darauf finden.
Er erschien nicht im Traum und rief nicht nach ihr. Im Winter wurde bei den Nachbarn angerufen – das einzige Telefon im Dorf – und es hieß, Wasja sei gestorben, richten Sie das aus, wir bringen ihn fürs Begräbnis. Und drei Wochen nach dem Begräbnis kam Saschas Brief, den Sascha eineinhalb Wochen vor dem Tod des Vaters geschrieben hatte. Aufgrund der schlechten Arbeit des Postdienstes überschritt der Brief alle Zustellfristen, fast war es, als wäre er zu Fuß gegangen. In diesem Brief hatte Sascha geschrieben, dass der Vater sich gut fühle.
»Wie konnte das alles so plötzlich passieren?«, fragte die Großmutter Sascha, der noch einmal aufgestanden war, um zu rauchen und sich danach hinzulegen. »Du hast im Brief geschrieben, dass es dem Vater gut geht. Ich lese das, und er ist schon im Grab. Und nichts ist ihm besser geworden. Er hat sich ein Leben lang abgequält.«
Die Großmutter blickte Sascha ruhig an, ohne eine Antwort zu erwarten.
»Die Leute sagen manchmal, dass die Enkel mehr geliebt werden als die Kinder. Das ist nicht wahr …«, dachte Sascha.
Die Großmutter liebte ihre Söhne. Sascha war für die Großmutter eine undeutliche Erinnerung an jene Zeit, als die Familie vollständig und die Söhne noch am Leben waren. Sie hatte aber keine Kraft, in Sascha die Züge seines Vaters zu sehen, in ihm ihr eigenes – dem Sohn und dem Enkel weitergegebenes – Blut zu spüren. Sascha war ein eigenständiger Mensch, beinahe schon fremd …
Ganz selten aber schaute die Großmutter Sascha in der Hoffnung an, der verstorbene Sohn möge im Antlitz des Enkels erscheinen, ein Zeichen geben, riss sich davon aber sogleich los: »Nein, er ist es, nicht er …«
Sascha verstand das und akzeptierte gelassen die stille, kaum merkliche, hauchdünne Entfremdung der Großmutter. Bewusst war ihm das nicht aufgrund einer klaren Einsicht und obwohl er es eher vor sich selbst verheimlichte, spürte er, dass es ihm so – in einer gewissen Distanz zur Großmutter – leichter fiel, sich hier aufzuhalten. Wenn jeder in seinem Herzen sein Unglück trägt, sollten sich diese Herzen möglicherweise besser nicht berühren. Vermutlich ist es besser, gewisse Grenzen nicht zu überschreiten, wenn es ohnehin schon unmöglich ist, das Ganze zu ertragen.
Der Großvater wollte jedenfalls nicht mehr länger leiden, es zog ihn zu den Kindern[63].
Er ertrug den Tod der beiden Söhne stoisch und noch ein Jahr vor dem Tod des dritten war er bei Kräften gewesen. Kräftiger als Sascha – Sascha konnte sich erinnern, wie er sich über Opas Gesundheit gewundert hatte, als sie einmal auf dem Hof arbeiteten und Opa mit einem riesigen Hammer herumwerkte, den Sascha kaum hochheben konnte.
Aber dann verließ ihn auch der letzte Sohn, und Opa überlegte sich, ob er weiterleben solle.
In Opas Kopf gab es keine Abbilder der Vergangenheit. Es gab keine Erinnerungen an jene Zeit, als er, ein junger Stoßarbeiter, auf dem Mähdrescher arbeitete, und daran, als er, ein junger Offizier, mit der Waffe Befehle erteilte. Weder an die fast dreijährige Gefangenschaft erinnerte er sich, noch an das Leben nach dem Krieg. Es gab nicht die Klarheit einer guten Erinnerung. Es gab Nachklänge, Unausgesprochenes, Fetzen an Erinnerungen, kein einziger Gedanke hatte sein Ende gefunden, alles wackelte wie in einem dunklen Waggon, mit flackerndem, fast kraftlosem Licht – irgendwo Stimmen unsichtbarer Mitreisender, das Geschirr scheppert, es gibt keinen Zugbegleiter, und hinter dem Fenster blitzt etwas Verschwommenes auf.
Opa horchte, konnte aber nichts erkennen.
Großmutter ging vorbei, das bemerkte Opa. Und wieder konnte er nichts denken, nichts über sie, nichts über sich, nichts über irgendjemand. Es war nichts zu entscheiden, und nichts entschied sich von selbst. Alles war verflossen und verwischte sich. Das Farblose rollte heran. Selten tropft das, was sich auf dem Boden findet.
Der Großvater schaltete das Radio immer auf volle Lautstärke – damals. Um sechs Uhr früh ertönte im Haus die Hymne. Die Großmutter war zu dieser Zeit schon aufgestanden.
Sascha streckte die dürren, dreckigen Beine, er ärgerte sich über den Großvater. Aber er schlief sofort wieder ein, sobald die Melodie auf hörte. Er stand in guter Geistesverfassung auf. Er aß eine Milchsuppe. Manchmal fand er in der Suppe eine Fliege, aber Sascha ekelte sich nicht; er aß alles auf, nachdem er die Fliege herausgefischt und neben den Teller gelegt hatte. Die Fliege lag in einer kleinen weißen Pfütze, mit zusammengeklebten Flügeln. Die Suppe war außergewöhnlich schmackhaft, süß, heiß. Nach der Suppe gab es Karawajtschiki und Tee. Alles war so fein.
Um sechs Uhr morgens fing das Radio zu bellen an, als wäre die Platte mit der Hymne schon zu Ende oder hätte gar nicht erst beginnen können, weil sie hängengeblieben war. Das Radio atmete schwer mit seiner schwarzen, staubigen Lunge und begann zu schnarren. Der Lärm hörte nicht auf.
Sascha öffnet die Augen.
Über dem Kopf hingen Ikonen.
Das kleine Fensterchen neben dem Bett saugte alles Licht an.
Oma war nicht im Haus.
Sascha horchte, wollte den Atem des Großvaters hören, doch er hörte nichts. Er wollte nicht aufstehen. Aber liegen – zu zweit mit dem Großvater hinter der Trennwand – wollte er noch weniger.
Die Füße berührten angewidert den Boden. Die Schultern zuckten zurück. Die Backenknochen zogen sich zusammen, als er das Gähnen zurückhielt. Die Augen irrten flink durch das Zimmer, suchten etwas, um sich festzuhalten, damit das Herz sich beruhigte und der Morgen im Guten begann.
In der gegenüberliegenden Zimmerecke befand sich der »Familienschrein«[64], mit tausendfach angesehenen Fotos. Sascha schaute ihn trotzdem immer wieder gerne an – bis jetzt.
Er zog sich an, schlüpfte sofort in Hosen und T-Shirt und Pullover und ohne Gedanken wie »… schau mal, wie der Großvater dort …« an sich ranzulassen, streckte er sich und schlich sich, möglichst leise, in die Ecke, zu den ausgeblichenen, verschwommenen Fotos.
Die großen Bilder beeindruckten Sascha immer wieder: 1933, die Mädchen des Dorfes sitzen in einer Gruppe, es sind ungefähr zwanzig. Die Mädchen sind gepflegt, man kann sagen, herausgeputzt, eine süßer als die andere. Aber – es ist die Zeit der Kollektivierung, alle müssen halt arbeiten. Sascha vergaß immer, die Großmutter zu fragen, wie das eigentlich gewesen war. Das da ist Großmutter, sie war ungefähr sechzehn oder jünger (sie wusste den Tag ihrer Geburt nicht und feierte ihren Geburtstag nie) – aber schon ein wunderbares Mädchen, alles war schon da. Und das Jahr 1933 stand vor der Tür.
Und hier, das ist Opa, mit einem Freund, 1938. Die Gesichter sind klar, die Augen weit geöffnet, hartes männliches Lächeln. Die Kommandantenuhr am Arm des Großvaters, riesengroß, zur Schau gestellt. Ein Genosse von halbkaukasischem Aussehen, aber so ein würdevoller Kaukasier, hell, glänzend von unten bis oben, als würde er auf mysteriöse Weise das Blitzlicht spiegeln. Das Jahr 1938. Warum lächeln alle?
Es geht ihnen gut. Sie sind zufrieden, weil sie fotografiert werden, das Leben liegt vor ihnen.
Der Freund des Großvaters, dessen Familiennamen Sascha vergessen hatte, starb den Heldentod im Vaterländischen Krieg, er war Pilot. Seine Büste steht beim Geschäft, ewig welke Blumen zu Füßen.
Der Großvater war unabkömmlich[65] – bis 1942 schickten sie ihn nicht an die Front, er war der beste Mähdrescherfahrer im Gebiet. Der Großvater war damals schon mit der Großmutter verheiratet, Kinder hatten sie jedoch noch keine.
Aber im Herbst 1942 musste auch der Großvater an die Front. Bald danach geriet er in Gefangenschaft[66]. Und den ganzen Krieg über blieb er dann in Gefangenschaft. Er erzählte nicht gerne davon. Gerne erinnerte er sich nur daran, wie ihm in der Gefangenschaft ein Hellseher vorausgesagt hatte, er würde achtzig Jahre alt.
»Die Leute starben unauf hörlich, mehrere Menschen jeden Tag«, sagte der Großvater. »Wir schliefen nebeneinander, damit es wärmer war, alle in einer Reihe. Alle drehten sich gleichzeitig von einer Seite auf die andere, mehrere Male pro Nacht. Du drehst dich um und der Nachbar neben dir streckt alle Viere von sich, er liegt kalt da … Mir hatte man prophezeit – und ich glaubte es nicht, niemand glaubte daran, dass er noch einen Tag leben werde – und da sagt man mir ›achtzig Jahre‹ voraus. Aber ich habe es erlebt. Und dann lebte ich noch ein Weilchen länger.«
Als Saschas Vater starb, war der Großvater bereits vierundachtzig.
Der Großvater erzählte bei der Totenfeier diese Geschichte noch einmal, und fügte hinzu: »Ich hätte mit achtzig sterben sollen. Die Söhne lebten noch. Ich wäre glücklich gestorben. Aber jetzt, Sankya, verstehe ich nicht, wozu ich gelebt habe, ich habe nichts – letztlich auch niemanden in die Welt gesetzt, es ist, als hätte ich gar nicht gelebt.«
Die Großmutter sagte: »Der Großvater hat die Gefangenschaft überlebt, weil er nicht rauchte. Die Deutschen gaben den Gefangenen Tabak und Brot. Der Großvater tauschte seinen Tabak bei anderen Gefangenen gegen Brot. Er gab ihn nicht einfach so her.«
Sascha dachte manchmal: Soll man das dem Großvater vorwerfen oder nicht? Es hätte Sascha auf der Welt gar nicht gegeben, hätte der Großvater nicht ein zusätzliches Stück Brot für den Tabak erhalten. Was soll ich ihm vorwerfen? Wenn du jemand beschuldigen willst, begib dich in diese Sklaverei, überlebe dort drei Jahre, gib den Tabak einfach so ab, während ihn die anderen tauschen, kommst du dann lebend zurück, kannst du Vorwürfe erheben.
Als der Großvater aus der Gefangenschaft zurückkehrte, wog er siebenundvierzig Kilo – bei einer Körpergröße von einem Meter dreiundachtzig.
Der Großvater erzählte außerdem noch: Als sie befreit wurden (von den Alliierten, den Amerikanern), machten er und einige seiner Genossen sich zu Fuß auf den Weg[67] zu den eigenen Leuten. Sie gingen durch eine befreite deutsche Siedlung, fanden ein Fass mit weißem Honig. Sie waren fünf Mann – und alle, außer dem Großvater, stürzten sich auf den Honig, um ihn zu essen, gleich mit den Händen, direkt aus dem Fass. Der Großvater warnte seine Kümmerlinge, das Zeug nicht zu essen – sie hörten nicht auf ihn. Sie aßen sich satt und begannen sofort zu erbrechen, zu taumeln und sich zu winden. So starben sie alle, nicht weit vom Fass mit dem weißen Honig.
Manchmal sah Sascha dieses Fass, gefüllt mit etwas Weißem und Dickflüssigem. Wie schmutzige bebende Finger mit langen Nägeln in den Honig gleiten. Zahnlose Münder, die von verdreckten Haaren umwachsen sind, schnappen nach dem Honig. Und der Honig verätzt die Kehle. Und der Großvater sitzt abseits, gebeugt und abgewandt. Vielleicht hatten Großvaters Weggefährten auch noch gelacht, einige Minuten lang waren sie sehr übermütig gewesen. Doch plötzlich setzte einer sich abrupt hin oder fiel sofort um, und die Augen weiteten sich vor Schmerz …
Und der Großvater ging allein weiter.
Von den Kommunisten wurde er ausgeschlossen, weil er in Gefangenschaft gewesen war. Er kehrte ins Dorf zurück, zu seiner Frau. Im Lauf der Nachkriegsjahre zeugten[68] sie drei Söhne.
Da sind sie, die Söhne – auf einem anderen Foto. Saschas Vater, Wasja, er steht zwischen Großmutter und Großvater, ein blonder Schopf, oder wie es hier im Dorf heißt – flachsblond[69], das bedeutet, dass die Haare hell wie von der Sonne ausgeblichenes Leinen waren[70]. Der Großvater hält den mittleren Sohn auf den Armen, die Großmutter das kleine Söhnchen. Der Großvater – mager, hochgewachsen, abgearbeitet, streng. Die Großmutter – mit dunklem Gesicht, hohlwangig, sich selbst nicht ähnlich. Es war schwierig gewesen, die Kinder aufzuziehen.
Daneben eine andere Aufnahme – Saschas Urgroßvater mit Freunden – der Vater des Großvaters. Die festgehaltene Zeit: Der Erste Weltkrieg, vor dem Hintergrund eines Bunkers stehen vier Soldaten, mit – wie bei Pferden – langgezogenen Gesichtern, sinnlos, repräsentabel. An Urgroßvaters Brust drei Georgs- Orden. Er hat dann noch im Bürgerkrieg gekämpft und auch Auszeichnungen erhalten. Aus dem Bürgerkrieg waren allerdings keine Aufnahmen erhalten. Und die Auszeichnungen waren verloren gegangen.
Und hier ist Sascha selbst, vierzehnjährig, rosig, hellhäutig, die Haare wie zur Seite geleckt. Als er aus dem Dorf wegfuhr, war er, wie alle Dorfjungen, strohblond, in der Stadt verlor er die helle, seltene Färbung und wurde dunkelblond.
Sascha war mittlerweile der Einzige, der noch etwas über das Leben dieser Menschen wusste, die auf den Schwarzweißfotos abgebildet waren, zumindest war er ein Zeuge ihrer Existenz. Wenn die Großmutter stirbt, kann keiner mehr irgendwem erklären, wer hier abgebildet ist, welche Leute das sind – Stille. Ja, es wird auch niemand fragen, das braucht keiner. Die neuen Hausherren werden den Fotoaltar in das undurchdringliche Gestrüpp auf der anderen Straßenseite schmeißen, die Gesichter auf den Bildern werden verwaschen, und das war’s dann. Als wäre es nie gewesen[71].
Schon jetzt wusste Sascha nicht mehr, wer all die Menschen auf den vielen Fotos waren – vielleicht irgendwelche Verwandte der Großmutter, des Großvaters, vielleicht Nachbarn, mit denen sie befreundet gewesen waren, sonst noch wer. Die ganze Verwandtschaft ist weggestorben und die Freunde sind gestorben, es gab niemanden mehr, der sich erinnern konnte, wie die Großeltern in den Nachkriegsjahren eigentlich waren, ganz zu schweigen von der Zeit vor dem Krieg. Es hatte ja auch eine Hochzeit stattgefunden – die jungen Leute küssten sich scheu und die Gäste lärmten und tranken und alle lächelten, oder fast alle, vielleicht hat jemand missmutig in der Ecke gesessen und sich leise betrunken, auf jeder Hochzeit gibt es solche, trotzdem waren alle glücklich und lärmten … aber vermutlich ist kein Zeuge dieser Hochzeit mehr übrig geblieben.
Sascha erinnerte sich plötzlich, wie dem Großvater einmal herausgerutscht war, dass er mit der Großmutter in zweiter Ehe verheiratet sei. Die erste Frau hatte er am Tag nach der Hochzeit verlassen. Was sie eigentlich gemacht hatte, sagte der Großvater nicht. Angeekelt verlor er über seine erste Hochzeit ein paar Worte, die Sascha längst vergessen hatte, das war alles.
Dass der Großvater zwei Mal verheiratet gewesen war, beeindruckte Sascha sogar mehr als die furchtbaren Jahre, die der Großvater in Gefangenschaft verbracht hatte. Was war das für eine Ehefrau, was war das für ein Mädchen? Was hat sie getan? Hat der Großvater sie etwa mit einem anderen erwischt? Oder hat sie sich betrunken und den Großvater beschimpft? »Vielleicht hat sie das Tor mit Pech beschmiert?«, dachte Sascha, und vergaß dabei, dass im Dorf kein Haus hinter dem Tor versteckt war. Du machst einen Schritt von der Straße weg – und da ist gleich die Tür, die oft nicht einmal verschlossen ist. Und Hunde hielt auch niemand.
»Das Tor … mit Pech …«, äffte Sascha sich selbst nach. »Zu viele Bücher gelesen …«
Niemand weiß, wie das alles gewesen war. Aber all das war gewesen.
Wie kommt das, ha? Wohin sind alle verschwunden?
Hätte es einen Wert, zu wissen, wie die Großeltern ihr Leben gelebt haben? Oder war es für gar nichts nütze?
Sascha ging leise zum Großvater hin.
Die Türrahmen in der Hütte waren niedrig, und Sascha verbeugte sich unwillkürlich vor dem Großvater, der aber nichts sah – er lag mit geschlossenen Augen da. Sascha hörte das heisere, bebende Atmen des Großvaters und blickte einige Momente lang auf seine blasse Stirn mit der dünnen, schwärzlichen Vene.
Der Großvater zuckte mit den tränenden Augen, man konnte die Pupillen unter den Lidern nicht ausmachen.
»Sieht er? Sieht er nicht? Soll ich was sagen?«
»Sankya«, sagte der Großvater leise. »Bist aufgestanden. Hättest noch weiterschlafen …«
Sascha schwieg und sah den Großvater ohne zu blinzeln an. Der Großvater atmete.
Sascha nahm den Hocker und stellte ihn neben Großvaters Bett, vielleicht tat er das auch lauter, als es möglich gewesen wäre – schon die Bewegung, der Lärm verwischten gleichsam den Eindruck der schwermütigen Schmerzhaftigkeit dessen, was hier vor sich ging.
Der Großvater schielte kaum merklich auf den daneben sitzenden Sascha – das Lid zuckte, ein bleicher Fleck der Pupille bewegte sich, und das Lid zuckte von Neuem, drückte eine kleine Träne hervor, die sich sofort in einer Falte verlor.
»Fährst du bald? Bleib doch noch … Bleib, bis ich sterbe … Ich sterbe bald … Begrab mich wenigstens. Die Oma ist doch alleine … Die Weiber werden mich begraben. Es gibt doch keine Männer mehr …«
»In solchen Fällen«, dachte Sascha, »sagt man sicher: ›Was heißt du stirbst bald, Großvater, alles kommt in Ordnung. Du liegst ein bisschen und wirst bald wieder aufstehen.‹« Er schwieg.
»Solange ich lebe, kann ich mich nicht erinnern, dass die Weiber jemanden begraben hätten … Gibt’s in der Stadt noch Männer?«
Sascha lächelte ein wenig.
»Gibt es«, sagte er laut, um wenigstens etwas zu sagen.
»Bei uns sind sie alle ausgestorben. Ich bin der letzte. Alle sind zu meinen Lebzeiten geboren, aufgewachsen, und alle sind sie gestorben. Ich habe sie alle begraben … Die meinigen und die fremden.«
Der Großvater verstummte und lag lange schweigend da.
»Ich esse nichts, und kann trotzdem nicht sterben …«
Er schwieg wieder.
»Erinnerst du dich an meinen silbernen Löffel? Nimm ihn, wenn ich sterbe. Mein Vater hat ihn mir gegeben. Jetzt gehört er dir.«
Sascha erinnerte sich an diesen Löffel – er war schwer, schön. Die Großmutter sagte, dass der Großvater mit diesem Löffel alle seine kleinen Jungs auf die rosa Stirn schlug, wenn sie bei Tisch Unfug trieben[72]. Sascha glaubte das nicht. Mit so einem Löffel kann man töten. Ja, und das passte auch nicht zu Großvaters Charakter. Sascha dachte, dass er nie im Leben gehört hatte, wie Großvater schrie – nie erhob er die Stimme und niemals fluchte er. Seine Unzufriedenheit äußerte er durch Gesten. Einmal kam Sascha mit dem Vater ins Dorf, ungefähr vor fünf Jahren war das. Der Großvater war schon fast achtzig. Onkel Kolja kam noch dazu und sie tranken den ganzen Abend und tranken noch die halbe Nacht weiter. Am Morgen setzten sie sich zum Frühstück, um auszunüchtern. Die Großmutter, die ja hörte, wie schwer der Großvater im Schlaf atmete, entschied, ihn zu schützen und füllte den Söhnen die Gläser mit Selbstgebranntem[73] ganz voll, dem Großvater nur etwas mehr als die Hälfte. In Großvaters Gesicht bewegte sich nicht ein einziger Muskel, mit einer laschen Bewegung schob er mit dem Handrücken der Rechten das Glas weg, nicht abrupt, aber immerhin so, dass es umfiel: Der Selbstgebrannte breitete sich auf dem Tisch aus, der Gestank war schneidend. Dann stand der Großvater auf und schob den Stuhl weg, als wollte er hinausgehen.
»Bleib schon sitzen, du Waldgeist! Bleib sitzen!«, schrie die Großmutter. Augenblicklich wischte sie den Tisch ab, stellte das Glas hin, füllte es bis zum Rand und ging schimpfend hinaus, maßvoll schimpfend, nicht laut und nicht bösartig, seit Langem kannte sie die Grenze, die sie nicht überschreiten durfte, wenn sie ihren Mann tadelte.
Der Großvater setzte sich, trank ruhig aus und die Großmutter versuchte nie mehr, ihm nicht richtig einzuschenken; es erinnerte oder erwähnte auch niemand mehr diesen Vorfall.
Sascha schaute auf den Großvater, dieser war wohl eingeschlafen. Sascha stand vorsichtig auf.
Auf der Straße stand Dunst, nebelgraue Feuchtigkeit, die im Sommer besonders unangenehm war.
Das Dorf gab kein einziges Lebenszeichen von sich.
Neben derselben Pfütze von gestern stand derselbe Junge mit der Gerte in der Hand. Zischend schlug er auf die schmutzige Spiegelung seiner selbst und sprang dabei von der Pfütze weg.
Der Anblick des Kindes hätte vielleicht das Herz zusammengezogen, wäre im Herzen nicht stille Leere gewesen.
»Du stehst schon auf, Sankya, warum bist du denn schon auf«, sagte die Großmutter, die vom Hof kam. »Gehen wir frühstücken.«
Das Rührei mit Speck, Tomaten und Zucchini – unnatürlich hell, wie die Zeichnung eines Kindes – verströmte ein starkes Aroma, bebte und spritzte als wäre es lebendig und voller Freude.
»Interessant, und wenn man die Alten zu zeichnen zwingt – werden ihre Zeichnungen genauso hell sein wie die der Kinder?«, überlegte Sascha.
Der Selbstgebrannte trübte sich ein, das grobe Brot wurde voller Gelassenheit dunkler. Auf einem Tisch ist Brot ist immer das Strengste, es kennt seinen Preis.
Sascha aß alles schnell und sagte, er gehe spazieren. Er bewegte sich vom Haus weg, den Berg hinunter zum Fluss. Er erinnerte sich, wie er als Kind auf demselben Weg ging und die Gänse der Nachbarin traf und lange nicht an ihnen vorbeigehen konnte, da der Gänserich, der widerwärtige Vogel, den Hals streckend und mit den Flügeln schlagend, den Weg blockierte. Sascha sprang weg und drehte sich vor Schreck um und lief, mit hochgezogenen Knien. Dann blieb er in einiger Entfernung lange stehen, von einem dunklen Bein auf das andere tretend, wie ein kleines Pferd. Als jemand die Straße entlangging, setzte sich Sascha und tat, als würde er mit den Steinen spielen. Er schämte sich, dass er sich vor einer Gans fürchtete. Der Mensch ging vorbei, erschreckte die Gänse und sie liefen wild mit den Flügel schlagend und wie blöde schnatternd davon.
Wenn Sascha sich erinnerte, sich an sein Leben erinnerte, dann mochte er auch nur diesen Jungen, den dunkelbeinigen, mit den Schrammen. Dann, als er die blonde Mähne losgeworden war, wurde aus diesem Jungen ein weißhäutiger, buckliger Blödkopf, der dumm lachte und alle anderen Merkmale eines Halbwüchsigen hatte. Sascha erinnerte sich nicht an seine Zeit als Halbwüchsiger, er vermied es, sich daran zu erinnern. Fahrig, raufsüchtig, unangenehm – wer möchte sich schon daran erinnern.
Jetzt gab es keine Gänseriche mehr.
Die Stege über das Flüsschen verbogen sich, brachen ein.
»Geht denn etwa niemand mehr ans andere Ufer hinüber?«, dachte Sascha und ertappte sich dabei, dass Großmutters »denn etwa«[74] in seine Sprache eingegangen war. Aber vermutlich verwendete er diesen Ausdruck nur, weil er mit seinem eingebildeten Dörflertum spielte, das sich, wenn es je existiert haben sollte, schon lange in Nichts aufgelöst hatte. Selbst »denn etwa« konnte er nicht gelassen aussprechen, ohne sich bei einem Selbstbetrug zu ertappen.
Sascha ging das Ufer entlang zum weiter entfernten Strand. Manchmal fand er am Ufer alte Boote, die mit Ketten an Bäumen festgemacht waren, oder herrenlose, löchrige, die schon lange niemand mehr brauche. Sascha schaute in jedes Boot, in das feuchte oder vertrocknete Innere.
Das Dorf blieb rechter Hand zurück.
Der Weg zog sich in Furchen, als hätte man ihn durchgekaut und ausgespuckt und während die Spucke vertrocknet war, blieben die verbogenen, groben Spuren von Zähnen oder hartem Zahnfleisch zurück.
Der Fluss wurde allmählich breiter. Manchmal war in der Strömung schwaches Plätschern zu hören.
Über dem Gras taumelten unsinnig Mücken.
Sascha ging zu dem Platz, der Timochas Winkel[75] hieß. Der Vater sagte, hier habe einst der Einsiedler Timocha gelebt, neben dem Fluss, der hier tatsächlich unvermittelt abbog und einen Knick bildete. Timocha war an irgendetwas erstickt. Die Fabel schenkte dem schönen stillen Strand mit dem weißen, fast schneefarbenen Sand seinen Namen.
Als kleiner Junge, der sich am Strand das Bäuchlein wärmt, hatte Sascha oft an Timochas Schicksal gedacht, aber in Anbetracht der Abwesenheit selbst eines kleinen Gebäudes, hatten die Überlegungen, wer dieser Timocha überhaupt gewesen war und wieso er ohne Menschen gelebt hatte, zu nichts geführt. Und dann war Saschka baden gegangen.
Manchmal – der Zeit nach zu urteilen, während der Mittagspausen – kamen junge Männer und hübsche Mädchen zum Strand. Irgendwo nicht weit entfernt wurde Torf abgebaut und in der freien Zeit planschte das arbeitende Volk glucksend herum.
Damals hatte der kleine Sascha zum ersten Mal gesehen, wie ein kräftiger Kerl in Badehose, in die sie so etwas wie eine Kartoffelknolle gelegt hatten, eine gut gebaute Schönheit abknutschte, sie an den Hüften streichelte und ihre weißen Brüste rieb, ohne sich vor dem Jungen zu schämen. Das auf dem Rücken liegende Mädchen ließ sich nicht lange auf die Lippen küssen und schlug bald dem Kerl gegen die Brust. Der nahm schließlich seine gierigen heißen Pfoten weg, stand unvermittelt auf und sprang vom hohen Ufer ins Wasser, verschwand fast für eine Minute unter Wasser, sodass die zerzauste Göre, die aufgestanden war und den Büstenhalter gerichtet hatte, sich Sorgen zu machen begann und unter vorgehaltener Hand Ausschau hielt, bis ihr Kavalier schließlich wie ein Wasserteufel am anderen Ufer auftauchte.
Sascha wusste nicht, was größeren Neid in ihm hervorrief – die Kunst, unter Wasser weit zu schwimmen oder dieser freie Umgang mit dem anderen Geschlecht. Das übrigens erschreckte Saschka, es rief eine merkwürdige Mischung aus Verwunderung und Ekel hervor.
Der Vater führte Sascha weiter am Fluss entlang, weg vom Lärm und den ständigen Flüchen, dort hatten sie noch ein anderes Geheimplätzchen – eine von Sträuchern eingewachsene Betonplatte, von der man nicht wusste, wie sie ans Ufer gekommen war. Der untere Teil der Platte ragte in den Fluss. Im Sommer erwärmte sich die Platte und Sascha und der Vater lagen lange auf ihr und schmorten[76]. Wenn die Sonne unerträglich wurde, gingen Saschka und der Vater bis zu den Knien ins Wasser und übergossen die Platte mit Wasser – davon wurde sie feucht und kalt, sie war wieder gut geeignet, um sich entspannt darauf zu bräunen und auszuruhen.
Er legte eine große Strecke zurück und da er vor so langer Zeit hier gewesen war, verwechselte er die Treppe – Sascha kam nicht bei Timochas Winkel heraus, sondern weiter flussabwärts. Er musste umkehren.
Der Pfad entlang des Flusses, einst von den Fischern und den Arbeitern ausgetreten, war ganz verwachsen, und Sascha ging mit vorsichtigen Storchenschritten[77], weil er Angst hatte, auf eine Natter zu treten. Seit der Kindheit hatte er Angst vor Schlangen.
Als er älter war, erfuhr Sascha, dass er bei der Geburt fast gestorben wäre – von der Nabelschnur erwürgt; man sagt, Menschen, die in den ersten Augenblicken ihres Lebens auf dieser Welt einen derartigen Schock erleben, würden sich ihr ganzes Leben vor Schlangen fürchten. Damit begründete Sascha wenigstens seine unglaubliche Angst vor harmlosen Nattern.
Natürlich traf er auf eine Natter, nicht nur auf eine, sondern auf eine ganze Familie, die herausgekrochen war, um sich in der Sonne zu wärmen. Sascha schrie auf, sprang hoch und kam mit gespreizten Beine wieder zu stehen. Die Nattern waren schon weg. Er hätte geschworen[78], dass die widerlichen Kreaturen weggekrochen waren, während er in der Luft hing.
Fluchend und ein wenig zitternd sprang Sascha durch die Sträucher und lief weiter bis zu jener Platte, auf der er mit dem Vater immer gelegen hatte.
Die Platte war vom Gebüsch ganz zugewachsen, ihr größter Teil ins Wasser gerutscht und mit grünen, schleimigen Unterwasserpflanzen überwuchert. Auf der Platte zu liegen war jetzt ganz offensichtlich nicht mehr möglich.
Sascha spürte bei diesem Anblick ein gramerfülltes Zucken im Herzen – als würde nicht die Platte im Wasser liegen, sondern ein umgestürztes Denkmal.
Sascha blickte sich nach allen Seiten um, überlegte, wo er sich hinsetzen konnte, um sich seiner Trauer zu überlassen. Er setzte sich ins niedrige Gras am Ufer und zündete eine Zigarette an.
Im Dorf, in der frischen Luft, rauchte es sich immer schlechter – in der schwülen Pestilenz der Stadt ist die Zigarette das Allerliebste, auf dem Dorf aber, wo die Lungen eine Schwindel erregende Frische atmen, ist es fast sträflich, sich eine Zigarette anzuzünden.
Sascha wollte sich noch einmal der Schwermut hingeben, die höchst wohlig und mit Zigarettenrauch vermischt war, allerdings drehte sich ihm der Kopf und die Trauer sammelte sich nicht in einem süßen Klumpen unter dem Herzen, sondern kroch als Trägheit durch den ganzen Körper. Er musste die Zigarette mit dem Absatz im Gras zertreten. Zum unverbrannten Tabak, vermischt mit trockener, schmutziger Erde, krabbelten sofort einige Ameisen.
Timochas Winkel, zu dem Sascha nach einigen Minuten kam, war von hässlichen Kletten überwuchert. Es gab keinen Strand mehr, an seiner Stelle hatte sich eine Sandwüste ausgebreitet.
Sascha schlüpfte aus den Schuhen und ging ins Wasser. Das Wasser war kalt und schleimig wie Sauerteig. Den Lehm zu berühren, war unangenehm – mit seiner vernarbten Kälte erinnerte er an das nackte Zahnfleisch eines alten Menschen.
Sascha stieg aus dem Wasser und setzte sich entkräftet auf den schmutzigen Sand. Er blickte sich um, spuckte aus, stand wieder auf. Er begann die Kletten an den Wurzeln herauszureißen, ein widerliches Gewächs mit langen Wurzeln, unbekannte niederwüchsige Gräser, und säuberte den Strand. Das ausgerissene rötliche, trockene, hässliche Zeug warf er ins Wasser. Die Strömung trug es fort.
Nach etwa eineinhalb Stunden war auf dem Strand kein einziges Gewächs mehr geblieben. Nur abgerissene Wurzeln ragten manchmal hervor. Der Strand war nicht hell und sauber geworden, wie er in Saschas Kindheit gewesen war, nein. Es war, als hätte der Strand an einer Infektion gelitten, den Pocken – und er lag mürrisch da, überzogen von Kerben und Scharten.
Sascha kehrte nach Hause zurück, er aß kein Abendbrot[79]. Er stand neben dem schlafenden Großvater, ging hinaus zur Großmutter und sagte, dass er abfahre. Jetzt sofort, er müsse.
Die Großmutter schwieg.
»Du warst doch beim Vater am Grab?«, fragte sie.
»War ich«, log Sascha.
»Wie geht es ihm, ist er aufgestanden?«
Sascha nahm eine Zigarette und begann sie mit den Fingern zu kneten, er wusste nicht, was er antworten sollte.
»Ich werde dir Zwiebeln mitgeben. Und Eier …«, sagte die Großmutter leise.
54
mit dem »Hundefuhrwerk« – на перекладных собаках
55
die Verkehrshüter – стражи дорог, сотрудники ДПС
56
»Findest du hin?« – «Дойдешь?»
57
Der Weg war verwüstet und voller Dreck. – Дорога была разбита и грязна.
58
die weichen und müden Hände in den Schoß gelegt – сложив мягкие и усталые руки на коленях
59
schonungslos – (зд.) беспробудно
60
verunglücken – пострадать в результате аварии, разбиться
61
ohne alles Getue – без суеты, неприметно
62
in sich hineinhorchend – прислушиваясь к себе
63
es zog ihn zu den Kindern – его тянуло к детям
64
der »Familienschrein« – «семейный иконостас»
65
unabkömmlich – вне досягаемости
66
in Gefangenschaft geraten – попасть в плен
67
sich auf den Weg machen – отправиться в путь
68
zeugen – зачинать, рождать
69
flachsblond – белобрысый
70
die Haare hell wie von der Sonne ausgeblichenes Leinen waren – волосы светлые, как лен, выгоревший на солнце
71
Als wäre es nie gewesen. – Как будто их никогда и не было.
72
Unfug trieben – безобразничать, баловаться
73
das Selbstgebrannte – самогонка
74
»denn etwa« – «нешто»
75
Timochas Winkel – Тимохин угол
76
schmoren – жарились (на солнце)
77
ging mit vorsichtigen Storchenschritten – шел, осторожно и высоко ступая
78
Er hätte geschworen – он был готов поклясться
79
er aß kein Abendbrot – он не ужинал