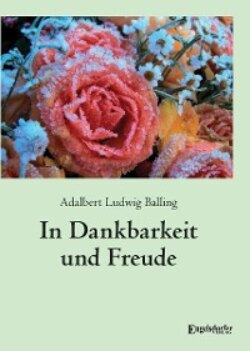Читать книгу In Dankbarkeit und Freude - Adalbert Ludwig Balling - Страница 28
Pfarrhäuser, Pfarräcker und Hobby-Pfarrer
ОглавлениеZu Pfarrer Friedels und Pfarrer Spielmanns Zeiten gab es im Dorf neben einem riesigen Pfarrhaus zwar noch mehrere Pfarräcker und einen weiträumigen Bauernhof mit Scheune und Stallung, aber keiner der beiden Geistlichen fühlte sich als Landwirt. Das war früheren Pfarrern vorbehalten. Zur Zeit unserer Eltern und Großeltern. Damals galten die Gemeindepfarrer auch als aufgeschlossene und fortschrittliche Landwirte. Sie waren belesen und wussten oft besser Bescheid als die ortansässigen Bauern, wie man zu ertragreichen Ernten kam, wann man pflügen und wann säen müsste und auch was nötig wäre, um Viehseuchen fernzuhalten.
Vom einen oder anderen dieser bäuerlichen Pfarr-Herren sprach man noch Generationen später. Sie langten zu, hieß es, sie hielten Predigten a la Abraham a Sancta Clara13 und stoppten mitunter mitten in der Messe, um ein paar freche Messbuben abzuwatschen. Aber sie machten auch sonst im Alltag der Bauern immer wieder von sich reden. Echte Originale waren sie, manchmal auch grobe und jähzornige. Aber was den Bauern allemal imponierte: Dass sie, diese Geistlichen, wohl immer auch selber mit anpackten, auch und gerade in den Ställen und auf den Feldern!
Das änderte sich später völlig. Pfarrer Friedel konzentrierte sich auf die Seelsorge. Spielmann auch, aber zu seinen Hobbys zählten noch Bienen, Uhren und lateinische Verse. In dieser Reihenfolge: Er hatte in guten Jahren bis zu 30 Bienenvölker, reparierte die alten Uhren im Dorf und dichtete lateinische Verse so gekonnt und so schnell, wie andere kaum denken konnten. Dass ich in Latein keine besondere Leuchte war, nahm er mir zwar nicht übel, aber gewünscht hätte er sich schon einen flotteren Lateinschüler. – Nach meiner Weihe, und schon in Rhodesien, war Pfarrer Spielmann ein aktiver Förderer meiner Missionsstation. – Das war übrigens auch, und zwar sehr intensiv, unser Onkel Josef. Jetzt zogen beide am selben Strang – zu Gunsten der Mariannhiller Missionen.
Auch sonst engagierte sich Spielmann im Dorf, mitunter bis hinein ins Politische. Wenn er sich im Recht glaubte und überzeugt war, etwas müsse berücksichtigt werden, dann entpuppte er sich als nachhaltiger Kämpfer – für die gerechte Sache. Mit unserem Bürgermeister legte er sich etliche Male an. Einmal auch, als er erfuhr, dass unser Knecht Hans Braun, der aus dem Banat stammte, sich darum mühte, seine Familie aus dem benachbarten württembergischen Simmringen (bei Bad Mergentheim) zu uns ins Dorf zu holen. Wir boten seiner Familie das Zimmer an, das vorher Frau Folz mit ihrem Sohn Heinz aus Pirmasens belegt hatten, inzwischen aber frei geworden war. Zu dieser Umsiedlung erhielt Hans vom Ortsvorsteher partout kein grünes Licht. Es war nach Papas Tod, und Mama brauchte Hans sehr notwendig für den Bauernhof und die Landwirtschaft. Doch die amtliche Zustimmung zum Ortswechsel seiner Familie wurde nicht erteilt. Als Spielmann das mitbekam, schrieb er direkt an die Bayerische Landesregierung nach München, stellte den Casus dar und bat um sofortige Entscheidung zugunsten von Hans und seiner Familie. Wenige Tage später traf die schriftliche Genehmigung ein. Die Brauns durften reibungslos und sofort bei uns einziehen und dauerhaft bei uns bleiben, und Hans musste nicht mehr länger zwischen seiner Familie und dem Arbeitsplatz hin und her pendeln.
In meiner Jugend besuchten so ziemlich alle Einwohner des Dorfes regelmäßig die Sonntagsmesse; viele, vor allem Frauen und Kinder, gingen auch zu den Andachten und zu den Sonntagsschulen am frühen Nachmittag. – Die jungen Burschen und die noch ledigen Knechte bevölkerten die Empore. Manche taten dies vielleicht nur knurrend, aber sie kamen zur Messe. Das war im Dorf so üblich; man ging sonntags in die Kirche – und da machten eben alle mit. Manche Männer lümmelten nicht gerade andächtig in den Kirchenbänken. Aber ganz wegzubleiben traute sich kaum einer; das hätten alle mitbekommen! Und vielleicht gar mit den Fingern auf sie gezeigt.
Kein Bauer arbeitete sonntags auf den Feldern. Das Vieh, ja, die Rinder, die Schweine, die Pferde, die Hühner und Gänse wurden auch sonn- und feiertags gefüttert. Aber andere schwere Arbeiten wie Ackern, Pflügen, Mähen, Dreschen, Kartoffel-Ernten, Mist-Fahren und dgl. – all das durfte man an Sonn- und Festtagen nicht tun.
Ausnahmen gab es nur im Sommer, wenn die Getreideernte dringend eingebracht werden musste, weil schwere Gewitter oder gar Unwetter drohten, die Früchte zu vernichten. Dann war allerdings zunächst der Ortspfarrer zu befragen: Er, und nur er, durfte die generelle Erlaubnis geben, ausnahmsweise auch sonntags auf den Feldern zu arbeiten.