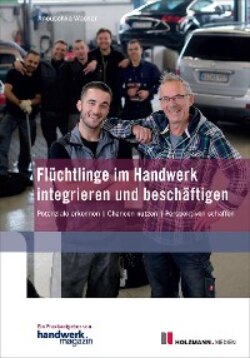Читать книгу Flüchtlinge im Handwerk integrieren und beschäftigen - Anouschka Wasner - Страница 11
1.5 Was spricht aus unternehmerischer Sicht für die Beschäftigung von Flüchtlingen im eigenen Betrieb?
ОглавлениеNatürlich spielt die spezielle betriebliche Situation bei den Überlegungen, ob ein Geflüchteter beschäftigt werden kann, eine wichtige Rolle. Ein Check kann helfen: Einige der Fragen der nachfolgenden Checkliste zielen auf die Überlegung, Geflüchtete als Aushilfskräfte mit der Perspektive einer langfristigen Beschäftigung in Betracht zu ziehen, andere auf die Besetzung von Ausbildungsstellen mit jungen Geflüchteten. Nutzen Sie die Checkliste, um die Situation im eigenen Unternehmen näher zu betrachten und um in Gesprächen Argumente zur Hand zur haben.
| trifft auf unseren Betrieb zu | trifft auf unseren Betrieb nicht zu | |
| In unserer Branche haben wir Schwierigkeiten, offene Stellen mit geeigneten Mitarbeitern zu besetzen. Wir sollten versuchen, geeignete Arbeitskräfte für die Branche unter den Geflüchteten zu finden bzw. sie entsprechend auszubilden. | ||
| In unserer Branche bzw. Region gibt es Ausbildungsstellen, die nicht besetzt werden. | ||
| In unserem Betrieb gibt es offene Stellen, die nicht unbedingt eine formale Qualifikation erfordern. | ||
| In unserem Betrieb gibt es offene Stellen, die leichtere Tätigkeiten mit sich bringen und keine lange Einarbeitungszeit erfordern. | ||
| Unser Betrieb kann die Win-win-Chance im Interesse aller nutzen und den Mehraufwand in der Betreuung mit Fördergeldern decken. | ||
| Unsere Geschäftspartner kommen teilweise aus Ländern aus den Herkunftsregionen der Geflüchteten. | ||
| Ein Mehr an menschlichen und beruflichen Erfahrungen und Sichtweisen wird unser innovatives Potenzial stärken. | ||
| Wenn wir die gemeinsame Aufgabe, die hinter der Idee steckt, richtig angehen, wird das die Kooperation in unserer Belegschaft stärken und Motivationsfaktor für alle sein. | ||
| Unsere innerbetrieblichen Strukturen und Instrumente der Mitarbeiterführung sind gut ausgebaut und durchsichtig, sodass Integration und Teilhabe gefördert werden (Oder: Wir möchten die Gelegenheit nutzen, unsere innerbetrieblichen Strukturen und Instrumente der Mitarbeiterführung weiter auszubauen, sodass Integration und Teilhabe gefördert werden). |
Sprache und ihre Wirkung
Worte erzeugen Bilder. Spricht man von einem „Arzt“ (und nicht von „Ärztin“) und fragt dann Kinder nach ihren Vorstellungen, beschreiben sie natürlich einen Mann – schließlich wurde ja von einem Mann gesprochen. Bei Erwachsenen funktioniert das ähnlich, auch wenn hier die Lebenserfahrung die Spannbreite der Bilder (hoffentlich) etwas erweitert hat. Tatsache ist, dass Worte und Vorstellungen in unserem Gehirn eng verquickt sind, den wenigsten Menschen aber bewusst ist, was Sprache bei ihnen auslöst bzw. was sie selbst mit ihrer Wortwahl auslösen.
Worte wie Flüchtlingsströme oder Flüchtlingsflut lösen Angst aus. Der einzelne flüchtende Mensch mit seinem individuellen und berührenden Schicksal wird in dieser Angst nicht mehr wahrgenommen. Im Kopf bleibt das Bild von einem Phänomen, das abgewehrt werden muss – nicht von Menschen, die Schutz suchen oder ein bereichernder Teil unserer Gesellschaft werden können. Solche Bilder prägen Meinungen, gesellschaftliche Diskussionen und politische Entscheidungen. Ein unüberlegtes Aufgreifen von Worten – welche in manchen Fällen auch gezielt in Umlauf gebracht werden – kann (unbeabsichtigt) zu menschenfeindlichen Einstellungen und Entscheidungen beitragen.
Flüchtling oder Geflüchteter?
Viele Wörter, die nach dem grammatikalischen Muster wie das Wort Flüchtling mit der Endung „ling“ gebildet werden, sind negativ besetzt, z. B. Eindringling, Emporkömmling, Schreiberling, Schädling. Andere Beispiele, wie Impfling, Säugling, Häftling, Schützling, weisen auf Unterlegenheit hin bzw. bringen eine Versächlichung mit sich. Dadurch werden die persönliche Hintergründe der Personen, ihre Geschichte, ihre Interessen und Meinungen unsichtbar, und es besteht die Möglichkeit, dass sich das unbewusste Sprachempfinden auf die Konnotation auswirkt. Da die Bezeichnung Geflüchteter dagegen nach einem Muster gebildet wird, das bei positiv wie negativ besetzten Wörtern Einsatz findet (Gefallene, Geschworene, Gesuchte etc.), ziehen manche Menschen die Bezeichnung Geflüchteter vor.
Eine andere Position nimmt den Begriff Flüchtling vor seinem historischen und seinem rechtlichen Bedeutungshintergrund wahr. Viele aktuell ehrenamtlich Aktive haben mit ihrem Engagement begonnen, weil sie Parallelen von den damaligen Kriegsflüchtlingen zu den heutigen Flüchtlingen ziehen konnten. Außerdem – so auch die Argumentation, die von Pro Asyl [11] publiziert wird – wird Flüchtlingen als solchen über den bestehenden internationalen Rechtsrahmen noch vor Feststellung des „Flüchtlingsstatus“ der Anspruch auf eine individuelle Schutzprüfung zugestanden – dem Flüchtling wird also ein Recht eingeräumt.
Beide Argumentationen haben ihre Berechtigung. In diesem Ratgeber greifen wir auf verschiedene Begrifflichkeiten zurück – es geht um Flüchtlinge, Geflüchtete, Schutzsuchende, Menschen, die aus ihrer Heimat vertrieben wurden, und Menschen mit Fluchtgeschichte. Dabei werden die Begriffe nicht im juristischen Sinne, sondern als Sammelbegriff verstanden, für alle, die als Schutzsuchende nach Deutschland kommen, unabhängig von ihrem rechtlichen Status. Vor allem soll es aber um Menschen gehen – und in unserem Zusammenhang um mögliche neue Mitarbeiter bzw. neue Kollegen.
Rassismus oder gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit?
Rassentheorien gingen davon aus, dass die Menschheit in verschiedene Rassen einteilbar ist – sie gelten heute als wissenschaftlich nicht haltbar, da die Menschheit selbst eine Rasse ist und die Unterschiede innerhalb derselben minimal und so fließend sind, dass keine Grenzen gezogen werden können. Soziologisch gesehen tritt Rassismus auch meist nicht alleinstehend auf: Wer Menschen anderer Herkunft als minderwertig wahrnimmt, geht davon aus, dass Menschen unterschiedlich viel wert sein können und es eine Art von Menschen gibt, die „normal“ und „wertvoll“ ist. Auf dieser Grundlage ist es sozusagen logisch, Minderwertigkeit generell auf Menschengruppen, die über wenig Einfluss und Macht verfügen, zu projizieren – also z. B. auf Homosexuelle, Behinderte, Menschen mit anderer Religion. Deswegen sprechen Soziologen, die sich in den letzten Jahren intensiv mit dem Erstarken dieses Phänomens in unserer Gesellschaft beschäftigt haben, von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit.
Integration oder Inklusion?
Integration unterscheidet zwischen Menschen mit und ohne „Besonderheit“— entsprechend wird unterschieden zwischen Behinderten und Nichtbehinderten oder zwischen Geflüchteten und Deutschen. Mit welcher Beeinträchtigung gilt aber jemand als behindert? Definieren sich Menschen, die bereits vor längerer Zeit nach Deutschland geflüchtet sind, für immer als Flüchtlinge?
Während Integration die Eingliederung der Menschen mit dem besonderen Merkmal in „das Normale“ anstrebt, geht Inklusion von der Besonderheit und den individuellen Merkmalen und Bedürfnissen eines jeden Menschen aus, da jeder Mensch eine einmalige Kombination an Merkmalen in sich vereint: Geflüchtete sind auch Behinderte und Nichtbehinderte, Frauen und Männer, Akademiker und Menschen ohne Schulbildung und so weiter – genauso wie Menschen, die schon lange oder schon immer in Deutschland leben. In diesem Ratgeber liegt der Schwerpunkt auf Integration, da es zunächst um die Eingliederung in einen funktionierenden Arbeitsmarkt geht. Inhaltlich schwingt die Thematik der Inklusion aber an verschiedenen Stellen des Ratgebers mit.
Warum ist dieser Ratgeber nicht „gegendert“, um alle Geschlechter anzusprechen?
Unter „gendern“ versteht man, einen Text so zu schreiben, dass immer Männer und Frauen angesprochen werden („Leserinnen und Leser“) bzw. alle möglichen Formen von Geschlecht („Leser*innen“). In diesem Ratgeber wird die grammatikalisch männliche Form benutzt, auch wenn alle Geschlechter gemeint sind, da ein Ratgeber leicht zugängliche Inhalte liefern sollte und dieses immer noch die übliche Schreibweise ist. Diese Lösung ist unbefriedigend, aber für den Moment scheint es keine andere zu geben. Unserer Eingangsthese zufolge besteht also die Gefahr, dass der Leser/die Leserin vorrangig an männliche Flüchtlinge denkt, wenn von „dem Geflüchteten“ die Rede ist – achten Sie doch einmal darauf und korrigieren Sie Ihre Gedankenwelt!