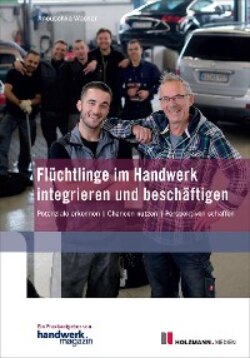Читать книгу Flüchtlinge im Handwerk integrieren und beschäftigen - Anouschka Wasner - Страница 8
1.2 Was motiviert das Handwerk, die Chance zu nutzen?
ОглавлениеDie naheliegendste Antwort auf die Frage, warum jemand einen geflüchteten Menschen in seinem Unternehmen beschäftigen möchte, ist doch: „Ja, warum denn nicht?“ Denn letztlich ist immer noch entscheidend, ob jemand sein Handwerk beherrscht – und nicht, aus welchem Land er kommt.
Gesellschaftlich betrachtet birgt die Frage eine schon fast zwingende Logik: Während Deutschland aus demografischen Gründen dringend Bedarf an Zuzugsreproduktion – also eine Erweiterung der Gesellschaft über Zuwanderung – benötigt, sind viele, in der Mehrzahl junge Menschen, aus anderen Ländern neu in dieses Land gekommen. Als einheimischer Bevölkerung bieten sich uns zwei Möglichkeiten: Entweder wir ergreifen die Chance und gestalten die Bedingungen so, dass über eine Integration in den Arbeitsmarkt gleichzeitig das Bedürfnis der Flüchtlinge, sich eine neue Existenz aufzubauen, befriedigt wie auch der Bedarf im hiesigen Arbeitsmarkt gedeckt wird und damit die Existenz manches Betriebes gesichert ist. Oder wir verharren untätig in der Hoffnung, dass wir nur alles Kommende ablehnen müssen, damit die Welt so bleibt, „wie sie immer war“ – und haben in jedem Fall eine Chance verspielt. Denn die Bedingungen für eine Integration in den Arbeitsmarkt müssen gestaltet werden, damit diese erfolgreich sein kann. Dabei lässt sich das, was jetzt nicht getan wird, irgendwann nicht mehr nachholen. [1]
Auch für den einzelnen Betrieb gibt es einige sehr konkrete Gründe, die für die Beschäftigung von Geflüchteten sprechen. Diese Gründe, auf die wir nach und nach eingehen werden, sind offensichtlich so überzeugend, dass viele Unternehmen, die bereits Erfahrungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, mögliche Herausforderungen gerne in Kauf nehmen. Auch Handwerksbetriebe setzen jetzt bewusst auf jene Menschen, die ihre Hoffnung auf ihre neue Heimat setzen.
Einer der wichtigen anstoßenden Momente für das Engagement der Betriebe liegt tatsächlich in der Notwendigkeit: Für einige Unternehmen ist der vielzitierte Facharbeiter- und Lehrlingsmangel längst bittere Realität geworden. Sie sind kaum noch in der Lage, motivierte Auszubildende und passende Fachkräfte zu finden. Auch wenn diese Entwicklung in den einzelen Regionen unterschiedlich prognostiziert wird: In manchen Gewerken und in manchen Regionen treibt dieser Mangel die Betriebe bis an die existenzielle Grenze. Die Bewerber, die bei den Betrieben vorstellig werden, entsprechen nicht den Anforderungen, während die Handwerksberufe für jene, die auch angesichts gestiegener technischer Anforderungen ausreichend fit wären, an Attraktivität verloren zu haben scheinen – wer kann, versucht ein Studium zu absolvieren, weil er sich mehr davon verspricht.
Diese Lücke kann von den heute hier Ankommenden nicht ohne Übergangsphase ausgefüllt werden. Vielen fehlen zunächst die schulischen und beruflichen Voraussetzungen, um aus dem Stand heraus die Anforderungen zu erfüllen, die das Handwerk an seine qualifizierten Mitarbeiter stellen muss. Und es muss auch bedacht werden, dass sich Menschen, die durch Flucht nach Deutschland gekommen sind, in einer sehr speziellen Situation befinden: Sie haben meistens schwierige Erfahrungen machen müssen, sie kommen mit anderen Gewohnheiten und Selbstverständlichkeiten in das neue Land, sie sprechen die Sprache kaum oder gar nicht – sogar die Frage, ob sie überhaupt bleiben dürfen, ist oft lange unbeantwortet. Damit muss man bewusst umgehen.
Zuversichtlich stimmt angesichts dieser schwierigen Voraussetzungen (auf die wir in den folgenden Kapiteln eingehen werden) eine aktuelle, ins Positive weisende Einschätzung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zur Integration von Flüchtlingen in den deutschen Arbeitsmarkt. [2] Die verbesserte Einschätzung gründet sich u. a. darauf, dass in der jüngeren Vergangenheit endlich damit begonnen wurde, die entsprechenden Voraussetzungen zu schaffen wie z. B. mehr Sprachkursangebote und eine frühzeitigere Vermittlung in arbeitsfördernde Kurse, Praktika und Fortbildungen. Der Studie zufolge dauerte es 2014 rund zehn Jahre, bis die Mehrheit der Flüchtlinge in Beschäftigung war. Bis zu 20 Jahre dauerte es, bis die Beschäftigungsquote bei Flüchtlingen das Niveau der Inländer erreicht hatte. Experten gehen davon aus, dass heute nach fünf bis sechs Jahren 50 % der Flüchtlinge auf dem Arbeitsmarkt integriert sein werden.
Das Handwerk hat an dieser Stelle gute Chancen, besonders integrativ zu wirken und selbst davon zu profitieren – und zwar nicht nur im Bereich Aushilfsjobs. Weit über 50 % der Asylsuchenden waren 2015 unter 24 Jahren alt, weitere über 25 % zwischen 25 und 34 Jahre alt [3] – eine große Zahl hat also keine Ausbildung, aber noch ein langes Erwerbsleben vor sich. Diese vielen jungen Menschen sind oft hoch motiviert, müssen aber teilweise zunächst befähigt [4] werden, weil sie manchmal jahrelang auf der Flucht waren und in ihren Heimatländern häufig weniger Bildungschancen hatten.
Und selbst in Ländern, in denen ein relativ hoher Bevölkerungsanteil über eine schulische Bildung verfügt, kann offensichtlich nicht unter allen Aspekten von Vergleichbarkeit ausgegangen werden: Studien zu mathematischen und naturwissenschaftlichen Kompetenzen der heute 18-Jährigen zeigten, dass in Deutschland 16 % der Schülerinnen und Schüler nicht über die absoluten Grundkompetenzen hinauskommen, während das in Syrien beispielsweise 65 % der Schülerinnen und Schüler betrifft. Dieser Umstand müsse bei Überlegungen zur Arbeitsmarktintegration beachtet werden, sagen Experten und betonen die Notwendigkeit von Angeboten, die jedem der hier Ankommenden die besten Optionen liefert. Mehr Ausbildungsbegleiter, teilqualifizierende Berufsausbildungen – die im Handwerk angesichts des großen Bedarfs an qualifizierten Kräften wiederum kritisch gesehen werden – und mehr Gewichtsetzung auf die praktischen Anteile einer Ausbildung könnten einen schnelleren Berufseinstieg für jene ermöglichen, die sich vielleicht zunächst noch Grundkompetenzen aneignen müssen. [5]
Der Hinführung zu einem Berufseinstieg dienen auch überbetriebliche Maßnahmen (Kapitel 6), oft von den Kammern organisiert, die spezielle Zusatzlehrinhalte speziell für Geflüchtete vermitteln. Die Betriebe können große Hilfestellung geben, indem sie Praktikumsplätze zur Verfügung stellen und den jungen Menschen so ermöglichen, reale Erfahrungen zu machen, die sie auf ihre berufliche Laufbahn hier in Deutschland vorbereiten. Nach einer individuellen Vorbereitungszeit geht es dann darum, den jungen Geflüchteten in eine Ausbildung zu bringen.
Gleichzeitig bietet der Karriereweg in unserem handwerklichen Fortbildungssystem mit der am Anfang stehenden dualen Ausbildung aber auch eine besondere Attraktivität für jene Flüchtlinge, die den direkten Einstieg in eine qualifizierte Laufbahn schaffen können: noch nicht ausgebildete, aber über eine Grundbildung verfügende Flüchtlinge, die darauf brennen, hier einen guten Einstieg mit Perspektive zu finden, und Flüchtlinge, die bereits berufliche Erfahrungen mitbringen, Studiengänge begonnen hatten oder in technischen Berufen gearbeitet haben, die hier nicht voll anerkannt werden können. Immerhin haben 52 % der Menschen, die im Jahr 2015 einen Asylantrag gestellt haben, eine Mittelschule oder ein Gymnasium besucht. 65 % dieser Flüchtlinge sind im Herkunftsland bereits einer Erwerbstätigkeit nachgegangen, im Iran und Pakistan waren es rund 80 % [6] – eine recht hohe Zahl in Anbetracht des niedrigen Durchschnittsalters der Schutzsuchenden.
Um die hohe Attraktivität des Handwerks auch für jene, die bereits im Herkunftsland relativ gut ausgebildet wurden, einschätzen zu können, muss man sich vor Augen führen, welches berufliche Niveau über eine duale Ausbildung und die guten Fortbildungsmöglichkeiten in Deutschland erreicht werden kann. Nicht von ungefähr sind deutsche Handwerker international so geschätzt. Oft entspricht das, was in Deutschland eine handwerkliche Ausbildung ist, in den Herkunftsländern einer Art Studium bzw. einer berufsbezogenen Fachoberschule oder Fachhochschule.
Und gleichzeitig ermöglicht die Praxisorientierung der Handwerksausbildung für die Neuankömmlinge einen leichteren Zugang für die Menschen, die am Anfang ihres neuen Lebens neben dem beruflichen Einstieg auch noch mit dem Spracherwerb und dem Einfinden in das neue Land konfrontiert sind. Hier liegt eine große Chance für Handwerksbetriebe, qualifizierte und loyale Mitarbeiter an sich zu binden.
Menschen zu unterstützen, die gezwungen waren, aus ihrer Heimat zu flüchten, und sich hier ein neues Leben aufbauen müssen, sollte grundlegender Bestandteil einer gesellschaftlich-humanitären Motivation sein, Flüchtlinge bei ihrer Integration ins Arbeitsleben zu fördern – die Menschen sind nicht geflüchtet, um unseren Fachkräftemangel zu mildern, sondern mit der Hoffnung auf ein besseres bzw. überhaupt ein Leben. Aber um das Zusammengehen auf dem Arbeitsmarkt für den einzelnen Betrieb tragfähig zu machen, muss jeder einzelne „Deal“ funktionieren und eine Win-win-Situation daraus entstehen.
Das ist ein erreichbares Ziel: Betriebe, die aufgrund ihres für Flüchtlinge attraktiven Arbeitsumfeldes – durch sprachliche Flexibilität, kulturelle Aufgeschlossenheit und gute Arbeitsstrukturen – Menschen mit entsprechenden beruflichen, kognitiven und sozialen Fähigkeiten einstellen konnten, haben gute Erfahrungen gemacht und wollen auch weiterhin auf diesem Weg motivierte und loyale Mitarbeiter an ihren Betrieb binden.
Die Werkstatt Kolbenfresser wurde 1982 als Betrieb in Selbstverwaltung gegründet. Heute arbeiten dort einschließlich der drei Geschäftsführer acht Mitarbeiter aus fünf Ländern.
Wolfgang Spalding, einer der drei Inhaber der freien Kfz-Werkstatt Kolbenfresser in Wiesbaden:
>> Unser Azubi Amir ist jetzt 18 Jahre alt. Er ist Kosovo-Albaner und im Februar 2015 als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling ohne Familie nach Deutschland gekommen. Ein weiterer Expraktikant und unser zukünftiger Umschüler ist ein 33-jähriger Syrer, der mit Frau und drei Kindern aus Aleppo vor den IS-Milizen fliehen musste. Er hatte dort eine eigene Werkstatt und eine Art Berufsfachschule abgeschlossen.
Klar, es bindet ja schon ein bisschen Arbeitskraft, jemanden in dieser Situation in einen Betrieb unterzukriegen, wir investieren hier. Wir haben auch überlegt, ob das Risiko nicht zu groß ist. Aber Amirs Chancen auf einen guten Aufenthalt seien sehr groß, wenn wir ihn erstmal ausbilden und beschäftigen, sagt die Ausländerbehörde.
Und ob Flüchtling oder nicht, die beiden passen super in unseren Betrieb und sind einfach gut – und wir haben hier einige Auswahl, die Praktikanten geben sich bei uns die Klinke in die Hand. Man darf keine Vorurteile oder Berührungsängste haben, nur dann kann man die Chance auch erkennen. Die zwei haben uns so gut gefallen, dass wir seit 34 Jahren zum ersten Mal zwei Auszubildende haben. Ich schätze, dass sie bis zum Ende ihrer Ausbildung bzw. Umschulung alle Nachteile, die ihnen durch das Einleben und die fehlenden Sprachkenntnisse entstehen, aufgeholt haben.
Für uns wäre es theoretisch auch naheliegend gewesen, Flüchtlinge aufzunehmen, um unseren Beitrag in der Gesellschaft zu leisten. Aber das wäre ein hoher Anspruch für eine so kleine Firma gewesen. Wir nehmen ja schon quasi durchgehend Praktikanten: Der nächste kommt aus Afghanistan. Und jetzt wird’s auch langsam eng – wir passen schon nicht mehr alle an den Pausentisch! (lacht)
Aber wir brauchen die Leute auch: Einer von uns geht in drei Jahren in Rente, ich in sieben oder acht Jahren, irgendjemand soll die Werkstatt weiterführen. Wir sind mit dem Selbstausbilden bisher am besten gefahren. Bei den Leuten, die sich hier bei uns ein neues Leben aufbauen, ist die Chance groß, dass sie bleiben. <<