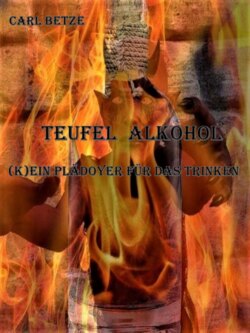Читать книгу Teufel Alkohol - Carl Betze - Страница 8
04 – warum trinken wir Alkohol?
Оглавление„Edles Bier, du tust mir gut.Gibst mir Zuversicht und Mut“
Der Konsum alkoholischer Getränke initiiert also einen biochemischen Prozess, im Rahmen dessen durch den ausgeschütteten Botenstoff Dopamin beim Trinkenden Wohlbefinden und Glücksgefühle entstehen.
Unser Gehirn speichert, dass Alkohol glücklich macht. Und will mehr davon...
Die Reduktion negativer Gefühle, verursacht durch die Stimulation inhibitiver Neurotransmitterrezeptoren, ist eine der verführerischsten Konsequenzen des Trinkens.
Indes auch eine der gefährlichsten.
Alkohol ist einer der besten Wirkstoffe gegen Ängste, Sorgen, Probleme, trübe Gedanken und erlittene Verletzungen.
Er unterstützt uns dabei, den Film im Kopf so zurechtzuschneiden, dass er für das Ego wieder erträglich wird. Alkohol ist einer der besten Tranquilizer auf dem Markt. Es gibt kein effektiveres Mittel gegen Stress. Keinen kürzeren Weg zu einem angenehmen Befinden. Was man auch macht, wo man sich auch aufhält – mit einem Drink in der Hand wird das Leben für viele Menschen gleich ein wenig rosaroter und erträglicher.
Alkohol wird missbraucht, um eigene Gefühle regulieren zu können. Dies ist notwendig, wenn wir nicht gelernt haben, unsere Gefühle als normale psychische und körperliche Reaktionen wahrzunehmen und zu akzeptieren (32).
Die Kehrseite der Medaille sind die vielschichtigen physischen wie psychischen Auswirkungen, die regelmäßiges Trinken auf den menschlichen Organismus hat.
Trotzdem trinken wir Alkohol. Ist es also letztendlich die Sehnsucht nach Glück, das Streben nach dem Gefühl des Seelig-seins, was uns in die Sucht treibt?
Bestimmt auch, aber übermäßiger Alkoholkonsum kommt oft nicht von ungefähr.
Meist gibt es einen subjektiven, oft höchst individuellen Grund, warum der Betroffene immer häufiger zum Glas, beziehungsweise zur Flasche, greift.
Und doch gibt es Gemeinsamkeiten, sind es immer wieder bestimmte, ganz konkrete Lebenssituationen, in denen sich der Alkohol ganz hervorragend eignet, um der eigenen Gemütsverfassung ein wenig auf die Sprünge zu helfen.
Am Tag der Deutschen Einheit anno 2018 stehe ich frühmorgens in der Küche und bin dabei, das Frühstück für meine Frau Ewa und mich zuzubereiten, als das Telefon klingelt. Wer kann das sein, so früh am Morgen? Bestimmt jemand aus Ewas großer Familie oder eine ihrer besten Freundinnen – meine Frau telefoniert gerne, viel und zu allen Tageszeiten. Ewa hebt den Hörer ab, legt kurze Zeit später wieder auf, gesprochen hat sie mit dem Anrufer offenbar nicht. Sie kommt zu mir in die Küche, Tränen laufen ihr über die Wangen.
„Dein Papa ist gestorben“. Der Anruf kam aus dem Pflegeheim, in dem meine Eltern seit knapp anderthalb Jahren leben.
Mein Vater ist in den Morgenstunden, zwar im stolzen Alter von fast 97 Jahren, trotzdem aber plötzlich und völlig unerwartet, verstorben.
Unmittelbar lege ich das Brotmesser zur Seite, öffne den Kühlschrank, greife mir wortlos eine Flasche Bier und gehe die Kellertreppe hinab, dann in den Garten. Dort stehe ich, vor Schock am ganzen Leib zitternd und keines klaren Gedankens fähig, und trinke mein Bier – um 08:00 morgens.
Auf dem Weg zurück in den Wohnbereich unseres Hauses nehme ich mir aus dem Zweitkühlschrank, der im Keller steht, eine zweite Flasche mit nach oben.
„Wir müssen ins Heim, auch wegen Deiner Mutter“, sagt Ewa.
„Ich kann nicht“ antworte ich. Die zweite Flasche Bier ist beinahe schon geleert.
„Aber wir müssen dahin. Sie weiß noch nichts, ich denke, DU solltest es ihr sagen“.
Ewa hat Recht. Die Autofahrt zum Pflegeheim dauert keine fünf Minuten, das muss reichen für die dritte Flasche Bier. Im Heim angekommen, zeigt der Alkohol erste Wirkung: Ich bin in der Lage meiner Mutter die Todesnachricht zu überbringen. Ewa wartet vor ihrer Zimmertür.
„Gehen wir zu ihm rein?“ fragt sie.
„Das kann ich nicht“ entgegne ich auch jetzt.
Ewa geht allein ins Sterbezimmer meines Vaters. Auch er hat dem Alkohol zeitlebens regelmäßig zugesprochen und so befindet sich in seinem Zimmer ein kleiner Kühlschrank, der lediglich dazu dient, Bier zu kühlen. Dessen bewusst, betrete ich das Zimmer, gehe schnurstracks zum Kühlschrank, entnehme diesem eine Flasche Bier, nehme einen kräftigen Schluck und wende mich meinem toten Vater zu.
„Ein letztes Prost, Papa“.
Anderer Anlass – gleiche Reaktion.
In meiner Zeit als Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens holt mich die Vergangenheit der Firma ein.
Mein Vorgänger hatte sich bei einem Prüfverfahren nicht an die Recht gebende Verordnung gehalten, ich bin persönlich haftender Geschäftsführer, habe mit den Verfehlungen aus der Vergangenheit zwar nichts zu tun, bin aber trotzdem kurz davor, wegen eben diesen verklagt zu werden.
In diesen Wochen wird es zur Gewohnheit, abends die Unterstützung von drei oder vier Flaschen Bier zu suchen, um ein wenig abzuschalten, um Entspannung zu finden und die Gedanken in meinem Kopf zur Ruhe zu bringen.
Auf der Arbeit wird der Stress zunehmend größer, die Stimmung unter den Kollegen immer angespannter, steht und fällt doch die Existenz der Firma mit einer drohenden Anklage und dem damit einhergehendem vorübergehenden Berufsverbot.
Wie wünsche ich mir das wohlige Gefühl vom Vorabend zurück, als mir die beruflichen Probleme weitaus belangloser erschienen.
Ich schaffe es kaum mehr, mich morgens ins Auto zu setzen, um ins Büro zu fahren und mein Tageswerk zu verrichten. Und so kommt es, wie es kommen muss: ich beginne, bereits auf der circa fünfundvierzig Minuten dauernden Fahrt zum Arbeitsplatz die ersten zwei Flaschen Bier zu trinken.
Zwei weitere (diese habe ich Zuhause zuvor ins Eisfach gelegt, warmes Bier trinkt sich schlecht und im Firmenkühlschrank kann ich den geliebten Gerstensaft kaum deponieren...) trinke ich bis zur Mittagspause heimlich und vor allem hektisch – ich habe zwar ein Büro für mich alleine, aber es kann ja jederzeit jemand hereinkommen- an meinem Schreibtisch.
In der Mittagspause gehe ich in Kneipen, in denen ich mir ziemlich sicher bin, dass dort niemals ein Kollege auftauchen wird, um neben dem Mittagsessen auch das ein' oder andere Bier zu trinken. Auf dem Rückweg ins Büro eile ich noch schnell in den Supermarkt, um mir weitere zwei Dosen Bier zu kaufen, die dann bis zum Feierabend reichen müssen. Dass diese lauwarm sind, ist mir mittlerweile egal.
So überstehe ich einige Wochen den Arbeitstag, um dann am Feierabend, schließlich muss ich ja die Gedanken an den nächsten Arbeitstag verdrängen, weiter zu trinken.
Der Tod eines nahestehenden Menschen sowie Leistungsdruck und Stress auf der Arbeit sind nur zwei von vielen möglichen Anlässen, zu Glas oder Flasche zu greifen.
Beziehungsprobleme, schlimmstenfalls das Scheitern einer Ehe, eine schwere Krankheit – es gibt genug Probleme, denen sich der Mensch im Laufe seines Lebens ausgesetzt sieht und Probleme kann man – kurzfristig - „weg-trinken“.
In all' diesen Situationen kann der Alkohol Linderung verschaffen, kann er entspannen, beruhigen – und gerade das macht die Droge so gefährlich.
Der amerikanische Physiologe und Erforscher der Alkoholkrankheit Elvin Morton Jellinek hat eine Alkoholikertypologie entwickelt, in der er Trinker in fünf sogenannte „Trinkertypen“ einteilt.
Alpha – Trinker, auch Konflikt – oder Problemtrinker genannt, trinken Alkohol, um sich zu entspannen, um Angst und Verstimmungen zu beseitigen oder um Ärger herunterzuspülen.
Mit der eintretenden Beruhigung kommt auch die Kreativität für Problemlösungen zurück: man schreibt einen ergreifenden Liebesbrief, man hat eine berufliche Inspiration, man entscheidet sich für ein alternatives Behandlungsverfahren.
Die steigende Kreativität durch Alkoholkonsum bezieht sich übrigens nicht nur auf Problemlösungen, auch in alltäglichen Situationen tut der Alkohol seinen inspirierenden Dienst: Sitze ich im Sommer abends absichtslos im Garten („ich möchte einfach nur hier sitzen“, Loriot-Zitat aus dem Sketch „Szenen einer Ehe“), stehe ich spätestens nach der zweiten Flasche Bier auf, um dieses und jenes Gartenwerk zu verrichten. Ich gieße, schneide, pflanze um und zupfe Unkraut und merke dabei gar nicht, wie die Zeit vergeht, während ich mir noch ein Bier genehmige. Am nächsten Morgen wundere ich mich dann manchmal über das Werk vom Vorabend...
Im Winter muss das Haus dran glauben: die Deko wird gewechselt, der Kleiderschrank aufgeräumt, im ganzen Haus nach etwaigem Sperrmüll gesucht oder der Kellerbereich gesaugt.
Zurück zu den Problemtrinkern: Diese haben durchaus eine seelische Abhängigkeit zum Alkohol, aber sie haben auch noch die Freiheit, mit dem Trinken aufzuhören.
Das Problemtrinken ist einer der häufigsten Gründe, warum Menschen in Deutschland zur Flasche greifen. Und warum sie an der Flasche bleiben. Häufig verhält es sich nämlich so, dass die positive Erfahrung „mir geht es besser“, die mit dem Genuss alkoholischer Getränke verbunden ist, dazu führt, dass die Anlässe, warum man trinkt, immer nichtiger und damit immer häufiger werden. War es anfangs noch der Tod eines Angehörigen oder der Verlust des Jobs, reicht später bereits eine kleine Meinungsverschiedenheit mit dem Partner aus – Hauptsache, es gibt einen angenommenen Grund zu Trinken. Auch, wenn objektiv kaum ein Grund existiert. Das Problem Alkohol hat sich verselbstständigt. Man trinkt um des Trinkens willen und sollte sich dessen schleunigst bewusstwerden, solange man noch in der Lage, gegenzusteuern, um einer drohenden Abhängigkeit zu entgehen.
Die Freiheit, mit dem Trinken aufzuhören, hat ein weiterer Trinkertyp, der Beta – Trinker, auch Gelegenheitstrinker genannt, auch. Sein Trinkverhalten wird oft vom sozialen Umfeld mitbestimmt und auch Geselligkeitstrinken genannt.
In der heutigen Konsum- und Überflussgesellschaft geht beinahe jedwede Feier zwingend einher mit dem Genuss von Alkohol.
Sogar am Arbeitsplatz ist es zur Gewohnheit geworden, bereits am frühen Morgen mit Sekt auf Geburtstage anzustoßen.
Auch das „Abfeiern“ oder das gediegene „Essen-gehen“ am Wochenende ist meist gleichbedeutend damit, sich einen hinter die Binde zu kippen.
Anlässe für den Beta-Trinker, Alkohol zu konsumieren, sind Geburtstage, Familienfeiern ebenso wie Arbeitsjubiläen oder Verabredungen in Gaststätten. Mag einem auch nicht immer nach Bier, Wein und Schnaps sein – der Konsum alkoholischer Getränke gehört einfach zum Anlass dazu und wird deshalb auch kaum in Frage gestellt.
Das Trinken kann auf diese Weise zur Gewohnheit werden (33).
In kaum einem anderen Land finden sich so viele BETA-Trinker wie in Japan. Hier braucht man keinen Anlass für feuchtfröhliche Runden. In Japan gehört Alkohol einfach zu einem gelungenen Abend dazu. Auch bei einer Reise im Flugzeug, in der Bahn oder im Bus genehmigen sich Japaner schon in der Früh gern ein Bier oder auch zwei. Studenten treffen sich regelmäßig zu „Nomikai“, zu Trinkanlässen. Besonders ausgeprägt ist die Zecherei nach Dienstschluss: Das Feierabendbier ist in vielen Unternehmen fast schon ein Ritual. Ein guter Schluck hilft, mehr als nur den Arbeitsstress abzubauen: Beschwipst fällt das Plaudern leichter. Bei Bier, Wein oder Sake fallen mit den Hemmungen auch strikte soziale und hierarchische Schranken. Es gibt auch ein Wort für diese Art des geselligen Zusammenseins. Japaner umschreiben ihre regelmäßigen Trinkgelage mit „Nomunication“, das sich aus dem Begriffen „nomu“ (japanisch: trinken) sowie dem internationalen „Communication“ zusammensetzt und tatsächlich der innerbetrieblichen Kommunikation dient. Im mildernden Umstand der Trunkenheit erfahren die Chefs, was ihre Untergebenen am Führungsstil oder an Entscheidungen kritisieren. Bei alkoholisierten Scherzen können sie Fehler erkennen und auch zugeben, ohne ihre Autorität aufs Spiel zu setzen. Niemand wird sie irgendwann nüchtern darauf ansprechen. Es ist ein ungeschriebenes, aber bindendes Gesetz, am nächsten Tag zu „vergessen“, was alkoholumnebelt am Vorabend gesagt wurde.
Kaum irgendwo auf der Welt ist die Toleranz für Alkohol so groß: Wer über den Durst trinkt, vom Barhocker fällt oder auf der Tatami-Matte umkippt und einschläft, wird nicht getadelt. Kein Japaner nimmt Anstoß daran, wenn im Zug oder auf der Straße ein Angestellter im dunklen Anzug sturzbetrunken torkelt oder einfach herumliegt. Man setzt den Fremden einfach in ein Taxi oder geleitet ihn zur S-Bahn. Eine Umfrage des Forschungsinstituts Pew Global bestätigt diese legere Haltung auch statistisch.
Demnach sind Japaner spitze in Sachen Toleranz. Für 66% der Interviewten ist Alkoholkonsum „moralisch akzeptabel“, nur 6% sind entgegengesetzter Meinung. Mit großen Abständen folgen Tschechen, Deutsche und Briten: Bei den Tschechen finden es 47% okay, Alkohol zu trinken, bei den Deutschen 41% und den Briten 38%. „Japan ist ein Paradies für Trinker“, so „Japantoday“.
Ärzte verlangen seit Jahren mehr Aufklärung über die Folgen, über Sucht, Missbrauch und Behandlungen. Aber die Politik weigert sich, Alkoholismus als Krankheit anzuerkennen. Das Problem: Viele führende Politiker halten es wie ihre Landsleute, sie trinken gern, regeln bei einem Gläschen wichtige Deals und würdigen jene, die besonders viel vertragen. So wurde ein ehemaliger Präsident des Unternehmerverbandes auf seinem Grabstein mit der Inschrift „geehrt“: „Er war ein begnadeter Trinker“ (34).
Gelegenheitstrinker bekommen nicht selten Organschädigungen. Sie sind weder körperlich noch seelisch vom Alkohol abhängig, aber gefährdet.
Praktiziert man das Gelegenheitstrinken über einen längeren Zeitraum besteht die Gefahr, zum Gamma- oder Delta-Alkoholiker zu werden.
Gamma – Alkoholiker sind suchtkrank und können ihren Alkoholkonsum nicht mehr steuern. Sie erleiden einen Kontrollverlust, das eigentliche Merkmal der Alkoholkrankheit, sie können ihren Alkoholkonsum nicht mehr kontrollieren, ihn mengenmäßig nicht mehr steuern. Gamma-Trinker müssen trinken, weil ihr Körper den Alkohol verlangt. Zwischendurch haben sie bisweilen völlig alkoholfreie Perioden, manchmal sogar über längere Zeiten bis zu mehreren Monaten.
Insbesondere vormalige „Problemtrinker“ neigen dazu, sich zu Gamma-Alkoholikern zu entwickeln.
Delta – Alkoholiker werden auch Spiegeltrinker genannt, weil sie einen andauernden, ständigen Blutalkoholspiegel aufrechterhalten müssen. So wird aus einem angedachten „Frühschoppen“ oft ein „Tagesschoppen“. Das Bier schmeckt schon lange nicht mehr, der Bauch bläht und der stetige Harndrang treibt einen wieder und wieder auf die Toilette – trotzdem ist ein „Schluss-für-heute“ vor dem Zubettgehen keine Option. Einmal Alkohol im Blut ist das Verlangen, diesen Zustand aufrecht zu erhalten, einfach zu groß.
Fehlt die Zufuhr von Alkohol, kommt es bisweilen zu starken Entzugserscheinungen. Die Spiegeltrinker sind nicht abstinenzfähig, die Entzugserscheinungen sorgen für ein ständiges Weitertrinken.
Auch, weil Spiegeltrinker oftmals eine sogenannte Alkoholtoleranz entwickeln. Das bedeutet, dass sie, um die gleiche Wirkung zu erzielen, mehr Alkohol trinken müssen (35).
Spiegeltrinker entwickeln sich oft aus Beta-Trinkern, aus Gelegenheitstrinkern. Sie sind krank.
Epsilon – Alkoholiker schließlich werden im Volksmund auch schlicht und einfach „Quartalsäufer“ genannt. Sie verspüren in zeitlichen Abständen einen unwiderstehlichen Drang nach Alkohol, der sich oft Tage zuvor durch Ruhelosigkeit und Reizbarkeit ankündigt. Sie veranstalten dann regelrechte Sauf – Exzesse, die einige Zeit andauern können, und leben dann oft tagelang in einem Rauschzustand.
Während dieser Trinkphase haben sie den Kontrollverlust. Sie trinken hemmungslos und haben Erinnerungslücken („Filmrisse“).
Zwischen den einzelnen Trinkphasen leben die Kranken oft wochenlang ohne Alkohol und haben nicht einmal das Bedürfnis, Alkohol zu trinken, bis wieder eine Rauschphase beginnt. Die Epsilon- Alkoholiker sind im Sinne der Reichsversicherungsordnung (RVO) ebenfalls krank (36).
Soweit die Trinkertypologie nach Jellinek. Ich möchte diese im Folgenden gern noch um vier weitere Trinkertypen erweitern, die ich für wesentlich im Hinblick auf die Frage „warum trinken wir Alkohol?“ halte, den „Selbstwerttrinker“, den „Schöntrinker“, den „Belohnungstrinker“ und den „Gewohnheitstrinker“.
Beginnen wir mit dem „Belohnungstrinker“.
Anfangen kann der Weg in die Sucht oft mit „harmlosem“ Belohnungstrinken.
Der Belohnungstrinker konsumiert alkoholische Getränke immer dann, wenn er glaubt, etwas Besonderes erreicht, etwas geschafft zu haben. Beruflicher Erfolg, die Bewältigung einer unangenehmen Situation im Privatleben, eine sportliche Höchstleistung – und schon heißt es „darauf trinke ich mir einen“.
In der Werbung findet der Belohnungstrinker vielfach die Bestätigung seines Verhaltens.
"das habe ich mir verdient“, „man gönnt sich ja sonst nichts“, „wenn einem so viel Gutes widerfährt, dann ist das einen … wert“, „darauf einen...“. - pfiffige Marketingspezialisten sprechen dem Alkohol eine Erlöserqualität zu, die er nicht hat.
Eine amerikanische Studie zeigt, dass der Alkoholgenuss auch stark vom Belohnungszentrum im Gehirn abhängt. Forscher gehen schon lange davon aus, dass Alkohol Endorphine im Gehirn freisetzt und so angenehme Gefühle hervorgerufen werden. Vermutlich verhält es sich so, dass bei Belohnungstrinkern das Belohnungszentrum im Gehirn besonders stark auf die Zufuhr von Alkohol reagiert.
„Offenbar ist ihr Gehirn irgendwie verändert, sodass sie im Gegensatz zu Normaltrinkern Alkoholkonsum als angenehmer empfinden und mehr wollen – und zwar unabhängig von der Menge der Endorphinfreisetzung oder -bindung“, glaubt Studienleiterin Jennifer Mitchell von der University of California (37).
Ein weiterer Trinkertyp ist der „Selbstwerttrinker“. Er konsumiert Alkohol, um auf diesem Wege sein Ego aufzupolieren, wohl wissend, dass die enthemmende, bisweilen gar euphorisierende Wirkung alkoholischer Getränke oft mit einer Steigerung des Selbstbewusstseins einhergeht.
Der Genuss von Alkohol zur Steigerung des Selbstbewusstseins oder, anders ausgedrückt, Trinken um „gut drauf zu sein“, ist weit verbreitet.
Ich erinnere mich an zwei Ereignisse im Kreise unserer Clique, damals alle Anfang 30.
Eine gute Freundin hat angekündigt, eine Bekannte auf ein Straßenfest mitzubringen. Ich hatte diese schon Wochen zuvor auf einem Geburtstag kennen gelernt und war zu der Ansicht gelangt, dass sie gut zu einem meiner besten Freunde, damals glücklich geschieden, passen würde. Wir sitzen in einem kleinen Zelt auf einer Biertischbank, mein Freund signalisiert mir unauffällig, dass er durchaus interessiert an dem Überraschungsgast ist. Nur sitzt er stocksteif auf der Bank, traut sich kaum einmal in Richtung des Objektes der Begierde zu schauen, vom Anbahnen einer Unterhaltung ganz zu schweigen.
Nach einer Weile steht mein Freund auf und verabschiedet sich, um „nur kurz eine Kleinigkeit essen“ zu gehen. Als er sich nach circa dreißig Minuten wieder zu uns gesellt, bietet sich uns ein ganz anderes Bild: breit grinsend, den von der Band zu Gehör gebrachten Musiktitel mitsingend, stolpert er fast über die Holzbank und quetscht sich geradezu in die kaum vorhandene Lücke zwischen meiner Freundin und derer Bekannter, um unmittelbar das Gespräch mit beiden aufzunehmen.
Die Vermutung liegt nahe, dass er statt einer „Kleinigkeit essen“ am nächsten Tresen verweilt und eher flüssige Nahrung zu sich genommen hat.
Dass der Versuch, die Auserwählte an diesem Abend nachhaltig zu beeindrucken, kläglich scheitert, bedarf nicht der Erwähnung...
Frisch verliebt nehme ich eines Abends meine neue Herzdame zu einer Geburtstagsparty mit, man trifft sich in einem bekannten Kölner Stimmungslokal.
Als wir in dem Lokal feiern, verändert sich die Stimmung meiner Begleiterin schlagartig: Sie redet kaum, schaut mehrmals betreten auf den Boden und sieht einfach nur unglücklich aus. In diesem Lokal, bei dieser Musik und unter völlig unbekannten Menschen fühlt sie sich offenbar nicht wohl.
„Ich bin mal 'ne halbe Stunde weg“, sagt sie auf einmal, ich denke mir nichts dabei. Vielleicht ein wenig frische Luft schnappen, vielleicht ein wichtiges Telefonat. Um die fünfundvierzig Minuten später steht ein anderer Mensch vor uns: hoch erhobenen Hauptes, dabei lächelnd und sich rhythmisch zur Musik bewegend scheint meine neue Freundin den Abend auf einmal zu genießen. Auch das Gespräch zu meinen Freunden sucht sie nunmehr.
„Ich war kurz draußen am Kiosk, nüchtern kann ich diesen Laden nicht ertragen“ flüstert sie mir ins Ohr.
Das Selbstwerttrinken mag in manchen Situationen durchaus ein probates Mittel sein, um sich selbstbewusster zu fühlen, sicherer aufzutreten, „cooler“ zu wirken.
Selbstwerttrinker neigen jedoch manchmal dazu, immer mehr Situationen auszumachen, in denen sie sich selbstsicherer fühlen möchten.
Das birgt die Gefahr, dass sich der Selbstwerttrinker langsam, aber sicher in Richtung Gewohnheitstrinker entwickelt.
Bei dem Begriff „Schöntrinken“ denkt man unweigerlich an Karneval, an Ballermann und andere Lokalitäten, die mit „Bagger-Image“ versehen sind, also im Ruf stehen, aufgrund Ihres Ambientes die Kontaktaufnahme zum anderen Geschlecht zu fördern.
Der platte Männerspruch „die sauf' ich mir schön“, wenn es darum geht, der wahrgenommenen Attraktivität einer Vertreterin des anderen Geschlechts mit Alkohol auf die Sprünge zu helfen, ist allseits bekannt.
Das sprichwörtliche Schöntrinken gibt es nach Erkenntnissen britischer Wissenschaftler tatsächlich – und zwar nicht nur in Bezug auf die Attraktivität des jeweils anderen Geschlechts. Nach ein paar Gläschen fanden heterosexuelle Männer bei einer Versuchsreihe der Universität von Bristol sowohl Frauen als auch Vertreter des eigenen Geschlechts hübscher als vorher. Auch in den Augen von Frauen wurden Vertreter beider Geschlechter attraktiver (38).
Der Schöntrinker beeinflusst mittels Alkoholes dabei keinesfalls nur seine Wahrnehmung vom weiblichen Gegenüber, er merkt schnell, dass sein Prozedere auch in andern Lebenssituationen Erfolg verheißt und er sich vieles
schöntrinken kann, wenn nur der Pegel stimmt.
Eine Visite der nicht unbedingt heiß und innig geliebten Verwandtschaft wird infolge von Begrüßungssekt, Tischwein zum Essen und dem Schnäpschen danach durchaus erträglich.
Den Besuch einer Travestieshow, an der mich nun wirklich überhaupt nichts reizt, finde ich beinahe amüsant.
Sie sollten sich einmal nüchtern in die entsprechenden Situationen begeben. Ich habe es versucht. Nach dem Besuch der Verwandtschaft habe ich davon abgesehen, mich nüchtern dem heiteren Spott der Travestiekünstler auszuliefern...
Erst ohne den Einfluss von Alkohol erkennt man, was einem wirklich Freude bereitet und was eben nicht.
Ist der regelmäßige Alkoholkonsum zur Gewohnheit geworden, ist oftmals allein das schon Grund genug, weiter zu trinken, der Betroffene wird zum Gewohnheitstrinker.
Denn die Wirkung des Alkohols, in Maßen genossen, ist ja auch ohne die Probleme, die man mit selbigem bekämpfen will, eher angenehm als das sie uns stört. Und so vermisst man nach einer Zeit regelmäßigen Trinkens das wohlige Gefühl der Leichtigkeit des Seins, welches sich bereits nach recht geringen Mengen Alkohol einstellt.
Außerdem verbindet man gewisse Situationen des Alltags, beispielsweise das Abendessen oder das abendliche Fernsehen, unweigerlich mit dem Genuss von alkoholischen Getränken - oft fällt es schwer, diesen Gewohnheitszusammenhang aufzulösen.
Dazu kommt, dass manch' einer sich gar nicht bewusst ist, dass er viel beziehungsweise zu viel trinkt und dieser Gewohnheit weiter nachgeht, ohne überhaupt in irgendeiner Form darüber
nachzudenken.
Gerade Menschen, die ein durch Arbeit, Familie und Freizeitgestaltung ausgefülltes Leben führen, nehmen sich oft nicht die Zeit zur Selbstreflektion, sondern leben einfach in ihrem gewohnten Rhythmus weiter. Ist der Genuss alkoholischer Getränke erst einmal Bestandteil desselben, wird er, wie andere Bestandteile des täglichen Lebens auch, weiter fortgesetzt.
Das Einteilen alkoholgefährdeter Menschen in „Trinkertypen“
kann wertvolle Unterstützung bieten, wenn es darum geht, den Ursachen für einen übermäßigen Alkoholkonsum auf den Grund zu gehen.
Basierend auf diesem Wissen ist es dann möglich, entsprechende Ansatzpunkte zur Bekämpfung der möglichen Alkoholsucht des Betroffenen zu erhalten.
Doch was ist das eigentlich genau – Sucht? Und wie kommt sie zustande? Damit befassen wir uns im nächsten Kapitel.