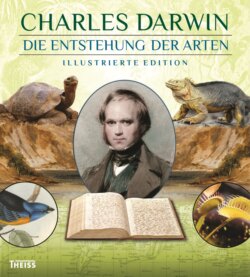Читать книгу Die Entstehung der Arten - Charles Darwin - Страница 6
EINFÜHRUNG VON DAVID QUAMMEN
ОглавлениеÜber die Entstehung der Arten« ist in vielerlei Hinsicht ein überraschendes, besonderes Werk, doch von all seinen Besonderheiten ist diese meine liebste: Selten ist in der Geschichte der englischen Prosa so ein gefährliches, brisantes, folgenreiches Buch im Ton so bescheiden und leutselig gewesen. Und zwar, weil sein Autor, Charles Darwin, ein bescheidener und umgänglicher Mann war – scheu im Verhalten, aber selbstsicher bei seinen Ideen –, der weder wettern noch einschüchtern, sondern vielmehr überzeugen wollte.
Als ich an Bord des Königlichen Schiffs Beagle als Naturforscher Südamerika erreichte, ward ich überrascht von der Wahrnehmung gewisser Tatsachen in der Verteilung der Bewohner und in den geologischen Beziehungen zwischen der jetzigen und der früheren Bevölkerung dieses Weltteils. Diese Tatsachen schienen mir einiges Licht über die Entstehung der Arten zu verbreiten, diesem Geheimnis der Geheimnisse, wie es einer unserer größten Philosophen genannt hat.
Er klingt wie ein sanftmütiger Onkel, der sich höflich räuspert, um gleich zum Tee ein paar seltsame Beobachtungen und Vermutungen anzustellen.
Der Philosoph, auf den Darwin da anspielt, war Sir John Herschel, dessen Buch über »Naturphilosophie«, wie man das damals nannte, Charles in seiner Studentenzeit in Cambridge beeindruckt hatte. Die Naturphilosophie war empirisch und induktiv, aber sie wandelte sich kaum merklich zur »Naturtheologie«, einer frommen Denkschule, welche die Wunder der Natur als Beweis für die Allmacht und Güte Gottes begriff. Was war der Ursprung der neuen Arten, die die alten ausgestorbenen ersetzten? Die Orthodoxie verordnete, jede Spezies sei ein besonderer göttlicher Schöpfungsakt. Herschel selbst mag vermutet haben, dass »Zwischenursachen« damit zu tun hatten; das hieß jedoch keineswegs, zu akzeptieren, dass Arten durch einen materialistischen evolutionären Prozess entstanden waren. Deshalb stellte die Frage, wann, wo und wie Gott Arten schuf, um die ausgestorbenen zu ersetzen, noch immer das »Geheimnis aller Geheimnisse« für Sir John dar. Darwin teilte nach der Beagle-Fahrt Herschels Interesse an dem Geheimnis, war aber zu einer anderen Lösung gelangt.
Was die »Bewohner Südamerikas« anlangt, auf die Darwin gleichfalls anspielte, so zählten zu ihnen Armadillos, große flugunfähige Vögel namens Rheas, verschwundene Formen des Pferdes und ein ausgestorbenes Riesenfaultier mit der Gattungsbezeichnung Megatherium, die allesamt (neben der bekannteren Fauna der Galapagosinseln) sein Denken weiter in Richtung Evolutionstheorie trieben. Zu den bemerkenswertesten Dingen bei dieser Eingangsbehauptung in der »Entstehung« zählt, dass Darwin das Gewicht auf die Festlandspezies Südamerikas legt und die Galapagosinseln nicht einmal erwähnt. Diese – für ihn wichtigen, ja, aber nicht ganz so wichtigen, wie die Legende nahelegt – Inseln kommen erst weiter hinten im Buch zu ihrem Recht.
Sein vertrauensvoller erster Absatz geht so weiter:
Nachdem ich dies fünf Jahre lang getan hatte, getraute ich mich erst, eingehender über die Sache nachzusinnen und kurze Bemerkungen niederzuschreiben, die ich 1844 weiter ausführte, indem ich die Schlussfolgerungen hinzufügte, und seitdem war ich mit beharrlicher Verfolgung des Gegenstands beschäftigt.
Es war ein stetiges – so stetig wie das Tempo einer Schildkröte in einem Labyrinth –, aber kein direktes, kein schnelles Bemühen, denkt man an die acht Jahre, in denen er ein vierbändiges Werk über die Taxonomie der Rankenfüßer schrieb. Andere wissenschaftliche wie private Ablenkungen waren ebenfalls hinzugekommen, etwa seine Heirat, ein Buch über Korallenriffe, eine Hausrenovierung, zwei Ausgaben seiner Fahrt der Beagle, lange Aufenthalte in einer Kaltwasseranstalt wegen einer unklaren Erkrankung, die Kopfschmerzen, Herzrasen und Brechreiz verursachte, plus die Zeugung von zehn Kindern und der Tod seines Lieblings, seiner Tochter Anne. Aber nun war Darwin wieder in der Spur und überreichte der Welt endlich (am 26. November 1859, dem Erscheinungstag der ersten Auflage) dieses Buch, das die Theorie der Evolution beschreibt, die er 21 Jahre zuvor als junger Mann entworfen hatte. Er setzt hinzu:
Ich hoffe, dass man die Anführung der auf meine Person bezüglichen Einzelheiten entschuldigen wird: Sie sollen zeigen, dass ich nicht übereilt zu einem Entschluss gelangte.
Hier trat zu seiner Bescheidenheit noch schüchternes Understatement. Die gewundene Geschichte hinter Darwins großem Buch zeigt, dass er bei der Publikation der »Entstehung der Arten« alles andere als hastig vorging.
Darwin kehrte am 2. Oktober 1836 von der langen Reise zurück – mit seinen Notizen und seinen gesammelten Proben sowie dem aufkeimenden Verdacht, dass die Theorie des besonderen Schöpfungsakts nicht richtig war. Er war 27 Jahre alt. Er fuhr eiligst nach Hause, um seine Familie wiederzusehen, ins Städtchen Shrewsbury in den Midlands, wo sein verwitweter Vater nach fünf Jahren einen ersten Blick auf ihn warf und zu Charles’ Schwestern sagte: »Nun ja, die Form seines Kopfes hat sich stark verändert.« Aber wahrscheinlich dachte er sich das bloß.
Darwin mietete sich in London ein Haus. In den nächsten zwei Jahren lebte er als beschäftigter Junggeselle, ging nur wenig in Gesellschaft (nachdem das Novum der Dinnerpartys und das Flirten mit heiratsfähigen jungen Frauen seinen Reiz verloren hatte) und konzentrierte sich entschlossen, aber insgeheim, auf die Frage, ob Arten unveränderlich waren (die vorherrschende Meinung) oder irgendwie veränderbar. Wenn Spezies änderungsfähig waren – wenn sie sich modifizierten, anpassten, zu neuen Formen entwickelten, wobei sie sich von einem gemeinsamen Vorfahr aus diversifizierten –, welcher Mechanismus rief dann diese Effekte hervor? Darwin wusste es nicht. Er hatte Ideen, wilde Thesen, aber keine Theorie – noch nicht. Er las viel. Er studierte die Proben von der Beagle. Er ging in den Zoo und beäugte den Orang-Utan. Er stopfte seine ausgewählten Tatsachen und einen Wirrwarr an Gedanken in kleine geheime Hefte, die er seine Transmutatios-Notizbücher nannte, da sie von der Veränderung der Arten handelten. Von »Evolution« sprach er erst später.
Fast zwei Jahre lang tastete er erfolglos nach einer Erklärung, wie die Spezies sich verändern könnten. Dann, Ende September 1838, las er die »Abhandlung über das Bevölkerungsgesetz« von Thomas Malthus, die seine Aufmerksamkeit auf die Tatsache lenkte, dass alle Spezies (auch der Homo sapiens) dazu neigen, sich in einer Rate fortzupflanzen, die zu Überbevölkerung führt, zu viel mehr Individuen, als vom Habitat und Nahrungsangebot her tragbar sind. Die Folge ist ein Kampf ums Überleben und um Möglichkeiten zur Fortpflanzung. Welche Individuen sind dabei erfolgreich? Jene, die durch kleine Abweichungen in der Anatomie, Physiologie oder im Verhalten für die physischen und sozialen Herausforderungen ihrer Lebensumstände am besten geeignet sind. Jetzt sah Darwin es. Er hielt seine Erleuchtung im aktuellen Notizbuch mit einer groben Analogie fest:
Man könnte sagen, es existiert eine Kraft, wie wenn hunderttausend Keile versuchen, jede Art von adaptierter Struktur in die Lücken im Aufbau der Natur zu zwängen oder vielmehr Lücken zu bilden, indem sie die schwächeren hinauswerfen.
Das Ergebnis des ganzen Zwängens, so erkannte er, »muss sein, die richtige Struktur auszuwählen und sie für die Veränderung passend zu machen«. Das war die erste Feststellung – sehr grob noch, sehr geheim, bloß ein noch ungeschiedenes Gedanken-Nugget – zu seiner Theorie der Evolution durch natürliche Zuchtwahl. Diese Analogie sollte dann in der »Entstehung« (siehe S. 80) in einem Kapitel auftauchen, in dem er den von ihm so genannten »Kampf ums Dasein« erklärte. Die Idee des Kampfes, sollte er hinzufügen, ist »die Lehre von Malthus mit verstärkter Kraft übertragen auf das ganze Tier- und Pflanzenreich«.
Rund zwei Monate nach seiner Erleuchtung, am 27. November, kritzelte Darwin eine deutliche, aber plump unterstrichene Behauptung in das aktuelle Notizbuch, mit der er die Theorie klarer umriss:
Drei Prinzipien, werden alles erklären
1. Enkel. Wie. Großväter
2. Tendenz zur kleinen Veränderung … vor allem bei physischer Veränderung
3. Große Fruchtbarkeit im Verhältnis zur Hilfe der Eltern.
Punkt drei bezog sich auf den Druck durch die Überbevölkerung, auf den Malthus ihn hingewiesen hatte. Punkt eins hielt die Grundtatsache des Erblichkeitsgesetzes fest – dass die Nachkommen dazu neigen, ihren nächsten Vorfahren sehr ähnlich zu sein. Und Punkt zwei erkannte die entscheidende Tatsache an, dass die Vererbung nicht exakt ist – dass in jeder Generation die Individuen sich durch willkürliche Abweichungen unterscheiden. Einige sind ein wenig größer oder kräftiger oder schneller oder haben einen längeren Hals oder ihr Gefieder ist in kräftigerem Rot oder Gelb als das der anderen. Solch eine Abweichung spiegelt sich auch in der Tatsache, dass selbst Geschwister (bis auf eineiige Zwillinge) nicht haargenau gleich sind. Doch nimmt man die drei Punkte zusammen, so erkannte Darwin, hat man einen funktionierenden Mechanismus, der über Generationen zur Anpassung führt. Das ist der Punkt, ab dem sich seine Theorie der Evolution am genauesten nachzeichnen lässt: 27. November 1838, Notizbuch E, S. 58.
Beeilte er sich, das zu veröffentlichen? Nein. Warum nicht? Weil er mehr als nur eine radikale geniale Idee mit subversiven Implikationen anbieten wollte; er wollte ein ganzes Gebäude an Beweisen und logischer Argumentation zur Untermauerung dieser radikalen genialen Idee vorlegen. Einen Grund zur Eile sah er nicht (später dann schon). Nach außen hin führte er weiter das Leben eines konventionellen jungen Naturforschers und parallel insgeheim das des Evolutionsforschers; er sammelte mehr Material aus gedruckten Quellen, aus dem Briefwechsel mit Tier- und Pflanzenzüchtern sowie seinen eigenen Beobachtungen und Experimenten. Und er war zusehends mit anderen Aufgaben und Rollen ausgelastet. Er heiratete seine Cousine Emma Wedgwood, die Erbin des Porzellanherstellers und eine fromme Christin. Er teilte ihre tiefe Gläubigkeit nicht, und sie wusste das und sorgte sich um sein Seelenheil; aber egal, irgendwie schafften sie es, dass ihre Ehe funktionierte. Sie flohen aus London und zogen in ein marodes Haus in dem kleinen Dorf Down. Er beendete seine Arbeit als Herausgeber des fünfbändigen Kompendiums ›The Zoology of the Voyage of H.M.S. Beagle‹, das auf seinen Spezimen von dieser Expedition basierte. Er richtete sich in seinem Arbeitszimmer ein, das ihm als Home-Office diente, in dem großen Haus mit einer wachsenden Familie (bis 1844 vier lebende Kinder und eine kleine Tochter auf dem Kirchhof) und der Dienerschaft und seiner beschützenden Ehefrau, fern vom lärmigen London. Und dann verstrich immer mehr Zeit.
Und Darwin war stetig stärker eingebunden in seine Rollen als Ehemann, Vater, Landedelmann, öffentlichkeitsscheuer Verfasser von naturhistorischen Büchern und geachteter, wenn auch etwas langweiliger Wissenschaftler; und ihm war klar, wie haarsträubend und verwirrend seine Theorie wirken würde – auf Emma, seine wissenschaftlichen Freunde, die viktorianische Gesellschaft –, wenn er sie schließlich doch veröffentlichte.
Er unternahm in jenen Jahren mehrere Anläufe, die Theorie auszuformulieren. 1842 erstellte er einen Entwurf seiner Ideen und Argumente, legte ihn dann aber beiseite. 1844 schrieb er eine längere Version, legte aber auch diese zur Seite, mit einer Notiz für Emma, sie solle sie »im Falle meines plötzlichen Todes« publizieren. Wenn seine Theorie richtig war (was er glaubte), sagte er Emma, und wenn auch nur ein kompetenter Richter sie akzeptieren würde, dann wäre sie »ein beträchtlicher Schritt für die Wissenschaft«. Da hatte er recht. Doch er war noch nicht bereit, diesen Schritt öffentlich zu gehen.
In jenem Jahr erschien in London noch ein Buch mit dem Titel »Vestiges of the Natural History of Creation«. Provokant in seiner Aussage und sehr mysteriös, weil der Autor anonym zu bleiben entschied, verkauften sich die »Spuren« gut (vier Auflagen in einem Jahr) und sorgten mit ihren verträumten, wirren, unbewiesenen Thesen über einen kosmischen Prozess der evolutionären Veränderung beim Publikum für viel Aufsehen. Das Buch amüsierte die unkritischen Leser und stieß bei den vorsichtigen Wissenschaftlern auf Ablehnung, für die es ein Obstkuchen mit unechtem Zuckerwerk war. Darwin sah dies jedoch als Zeichen, dass die Zeit für einen Text zur Evolution noch nicht reif, ja wohl ungeeigneter denn je war. Er wollte nicht mit dem namenlosen Autor der »Vestiges« als Lieferant von bösen geistigen Kohlehydraten in einen Topf geworfen werden.
Zehn Jahre vergingen.
Darwin sezierte, skizzierte und beschrieb zahlreiche Rankenfußkrebse. Weitere fünf Kinder wurden geboren, nun tobten acht durchs Haus. Dann starb Annie mit zehn Jahren herzzerreißend an Tuberkulose, wie es scheint. Ihr Leiden und Sterben, das er an ihrem Bett miterlebte, entfernte Darwin noch weiter von den orthodoxen christlichen Trostsprüchen. Er war nie sonderlich fromm gewesen (obwohl er sich in Cambridge auf die anglikanische Priesterweihe vorbereitete, bevor ihn die Fahrt mit der Beagle von dieser Laufbahn abbrachte), und sein langsames Wegdriften vom Christentum war genauso stark mit intellektuellen Zweifeln verbunden wie mit persönlichen Gefühlen. Aber das Leid von Unschuldigen wie Annie und seine Skepsis hinsichtlich des besonderen Schöpfungsakts und anderer wundersamer Eingriffe sowie seine Ablehnung des Dogmas von der ewigen Verdammnis der Ungläubigen machten es ihm unmöglich, gläubig zu sein oder auch nur die Idee eines allmächtigen gütigen Gottes zu akzeptieren. Später sagte er: »Ich gab das Christentum nicht auf, bevor ich vierzig Jahre alt war.« Als Annie starb, war er zweiundvierzig.
1854, nach Beendigung des langen Umwegs über die Taxonomie der Rankenfußkrebse, zog Darwin seine alten Notizen zur Transmutation wieder hervor und machte sich an die Evolutionstheorie als Vollzeitprojekt.
Die nächsten zwei Jahre verbrachte Darwin erneut mit Lesen, Forschen, Experimentieren und Nachdenken. Er fügte seiner Theorie ein weiteres entscheidendes Element hinzu, das er »das Prinzip der Divergenz« nannte (siehe S. 124–139) und mit dem er nicht nur die Anpassung und Komplexität der Arten, sondern auch ihre Diversifikation von gemeinsamen Abstammungslinien – dem Ursprung der biologischen Diversität – erklären konnte. Dann fing er an zu schreiben. Bis zum Frühsommer 1858 hatte er eine Reihe von Kapiteln zu dem, was er »mein großes Buch« zu nennen begonnen hatte. Die Kapitel umfassten über eine Viertelmillion Wörter, doch er meinte, er habe erst die Hälfte. Da landete ein Brief in seiner Post. Er kam von einem jungen Engländer namens Alfred Russel Wallace, einem autodidaktischen Naturforscher und kommerziellen Sammler mit wenig Schulbildung und nicht vom selben gesellschaftlichen Status wie Darwin (wiewohl sie eine wissenschaftliche Brieffreundschaft pflegten). Wallace hatte vier Jahre lang die Inseln des Malaiischen Archipels (heute großenteils Indonesien) bereist und davor schon vier Jahre am Amazonas verbracht. Sein Brief war in einem Handelshafen im Norden der Molukken aufgegeben worden. Er enthielt ein Manuskript. Lieber Mr Darwin, stand in dem Brief, hier ist eine recht ungewöhnliche Theorie, die ich entwickelte; wenn Sie meinen, dass der beigelegte Aufsatz es verdient, würden Sie ihn bitte an eine Person mit Einfluss weiterleiten? Wallace beschrieb in dem Papier die Evolution durch natürliche Zuchtwahl – nicht in diesen Worten, aber mit Gedanken, die mit Darwins eigener Theorie fast identisch waren.
Das ist die klassische Geschichte einer wissenschaftlichen Konvergenz, die bereits viele Male erzählt wurde; doch die grundlegenden Fakten verdienen es, noch einmal geschildert zu werden. Nach ein paar Tagen voller Panik und Verzweiflung vertraute Darwin die Sache seinen beiden engsten wissenschaftlichen Freunden an, dem Geologen Charles Lyell und dem Botaniker Joseph Hooker, die ihren Einfluss in der Wissenschaftsgemeinde nutzten (ohne Wallace darüber zu informieren), die Entdeckung durch die beiden bekanntzugeben. Hooker stellte einige Auszüge von Darwins unveröffentlichten Schriften, die gerade mal zum Umreißen seiner Theorie reichten, zusammen. Dieser Abriss und Wallace’ Papier wurden bei einer Sitzung der Linnean Society am 1. Juli 1858 vorgetragen und die Urheberschaft der Idee wurde beiden zugesprochen, was immer dies bringen mochte.
Tatsächlich hatte es eine Weile den Anschein, es brächte nur sehr wenig. Auf die Bekanntgabe kam so gut wie keine Reaktion von anderen Wissenschaftlern, von der breiten Öffentlichkeit ganz zu schweigen. Darwin selbst hatte die Sitzung der Linnean Society nicht besucht, und Wallace, immer noch drüben im Osten, wusste nicht einmal etwas davon. An den Anwesenden ging die Bedeutung des Gesagten fast völlig vorbei. Vorrangig hatte das Ereignis zur Folge, dass es Darwin anspornte, aktiv zu werden. Das Ganze zwang ihn zu der Erkenntnis, dass die Aussicht, obwohl er nach wie vor Bedenken wegen der öffentlichen Präsentation seiner Theorie hegte, das Rennen um den ersten Platz zu verlieren und jemand anderen als den Entdecker der Evolution durch natürliche Zuchtwahl anerkannt zu sehen, gefiel ihm noch weniger. Deshalb ließ er das halbfertige Buchmanuskript liegen und begann von Neuem zu schreiben, diesmal knapp und prägnant und – schnell.
Die knappe Darlegung quälte ihn, da er so viele seiner Beweise ausließ, die er in mehr als zwanzig Jahren gesammelt hatte; er ließ Fußnoten und Quellenangaben weg, die, wie er dachte, notwendig gewesen wären, um dem Werk wissenschaftliche Glaubwürdigkeit zu verleihen. Er entschuldigte die Unterlassungen mit dem Hinweis in seinem neuen Manuskript, das dünne Buch sei nur ein »Auszug«, ein verkürzter Abriss des großen Buches, an dem er geschrieben hatte. Er jammerte mehrfach, in seiner Einleitung und an anderen Stellen, dass der fehlende »Platz« ihn daran hindere, sein gesamtes Material vorzulegen und all seine Quellen anzuführen. Das eigentliche Problem allerdings war die fehlende Zeit, da er schnell etwas veröffentlichen wollte, bevor er das Urheberrecht an der Theorie gänzlich verlor. Nach zehn Monaten hektischer Arbeit hatte er einen Entwurf fertig.
Darwin wollte das Buch ›An Abstract of an Essay on the Origin of Species and Varieties through Natural Selection‹ nennen, doch sein Verleger John Murray überzeugte ihn, dass ›An Abstract‹ todlangweilig klinge. Dann musste Darwin die Druckfahnen korrigieren, die holprigeren Passagen umschreiben und ein Register erstellen. Im September 1859 hatte er von dem Ganzen die Nase voll. »So viel zu meinem grässlichen Buch«, schrieb er an einen Freund, »das mich so viel Mühe gekostet hat, dass ich es beinahe schon hasse.« Doch Anfang November, als er ein erstes gedrucktes Exemplar in Händen hielt, änderte sich seine Einstellung. »Ich bin unendlich froh und stolz«, sagte er zu John Murray, »über das Erscheinen meines Kindes.« Der endgültige Titel hatte (ein klein wenig) mehr Pep als die »Auszug«-Version, obwohl er noch immer im viktorianischen Stil lang und gewunden war: »On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle of Life«. Drei Wochen später teilte Murray Darwin die gute Nachricht mit: Die gesamte Auflage (1250 Exemplare abzüglich ein paar Dutzend für Werbezwecke) war am ersten Tag im Großhandel ausverkauft.
Fünf weitere, jeweils von Darwin überarbeitete Auflagen sollten zu seinen Lebzeiten folgen. Für die dritte Auflage 1861 stellte er die ›Historische Skizze der Fortschritte in den Ansichten über den Ursprung der Arten‹ als eine Art Vorwort dazu. Diese Abhandlung (hier als Anhang auf S. 514–525) listet einige zuvor publizierte Thesen eines noch nicht gefestigten Gedankengebäudes zur Evolution (und sogar einige Vorwegnahmen der natürlichen Zuchtwahl) auf. Dass er die Ideen bis auf Aristoteles zurück und danach über Jean-Baptiste Lamarck, Alfred Wallace und andere nachzeichnete, war eine Reaktion auf die Kritik, Darwin habe mehr Originalität für sich beansprucht, als ihm zustehe. In der fünften Auflage 1869 fügte er die Wendung »Überleben des Tüchtigsten« ein, die er der Anschaulichkeit halber von dem Philosophen Herbert Spencer übernahm. In der sechsten Auflage 1872 ließ er im Titel »Über die« weg und vereinfachte ihn zu ›Entstehung der Arten‹.
Darwin starb am 19. April 1882 mit 73 Jahren an einem Herzleiden. Aber das Buch lebte weiter.
Die Rezeptionsgeschichte von Darwins Theorie nach ihrer ersten vollen Darlegung (1859), den späteren Bearbeitungen (die nicht alle Verbesserungen darstellten) und ihrer anschließenden Kommunikation, Übersetzung, Interpretation, Fehlinterpretation, Popularisierung, Vereinfachung und Verzerrung durch andere ist ein kompliziertes Thema, auf das ich hier nicht eingehen werde. Das gehört nicht nur zur Biographie von Charles Darwin und die Geschichte seines berühmtesten Buches, sondern zur Historie der Evolutionsbiologie in den letzten 150 Jahren. Sie können sie, wenn Sie möchten, in Büchern wie ›Die Entwicklung der biologischen Gedankenwelt‹ von Ernst Mayr oder in ›Die Entdeckung der Evolution‹ von Uwe Hoßfeld und Thomas Juncker sowie vielen anderen finden. Und Sie können in Ihrer nächstgelegenen Universitätsbibliothek ganze Regale voll zu dem Thema finden. Ich bezwecke hier etwas anderes: Ihre Aufmerksamkeit auf die tatsächlichen Worte, Sätze und Kapitel des einen Buches zu lenken, mit dem alles anfing.
Die Lektoren bei Sterling Publishing Co. und ich haben entschieden, Ihnen den Text der Erstausgabe vorzulegen, da er die frischeste, dramatischste, gewagteste und folgenreichste aller Versionen war, die Darwins Feder entsprangen. Es ist der Text, der im November 1859 in London in die Buchhandlungen kam und zu dem revolutionären Umdenken führte, wie wir Menschen unseren Platz im Universum und unsere Verwandtschaft mit allen Lebewesen auf der Erde sehen. Zweifelsohne haben Sie schon viele Bemerkungen über Phänomene gehört, die »darwinistisch« seien, und wurden Sie mit Gedankengebäuden konfrontiert, die »Darwinismus« darstellen sollen. Lassen Sie sich nicht von Ersatzspielern in die Irre führen. Geben Sie nichts auf Hörensagen. Wenn Sie wissen wollen, was Charles Darwin gesagt und gedacht, wofür er gestanden hat – dann lesen Sie dieses Buch.
Die ›Entstehung der Arten‹ wurde nicht für Fachleute geschrieben. Es wurde für alle geschrieben, die lesen, nachdenken und Fragen stellen. Der Stil ist ab und an anstrengend, aber oft auch elegant; die Details sind spannend; die Logik ist luzide; und der Tonfall ist der eines leutseligen Gentleman.
Doch Sie werden zwischen diesen beiden Buchdeckeln noch mehr finden als nur den Text von Darwins großem Buch. Wir haben uns erlaubt, zu Ihrem Vergnügen und Ihrer Information dem Hauptgang einige literarische Beilagen und optische Aromen zur Seite zu stellen. Darwins Reise an Bord der Beagle, welche die Entwicklung seiner Theorie so stark beschleunigte, wird auf zweierlei Weise nachgezeichnet: mit Auszügen aus seinem Reisebericht (erschienen 1839 als ›Reise eines Naturforschers um die Welt‹ und später unter anderen Titeln, deren bekanntester ›Die Fahrt der Beagle‹ ist) sowie Bildern von den Orten, die er besuchte, den Geschöpfen, die er sah (und einigen, die er hätte sehen können, aber nicht gesehen hat), und vom Schiff selbst. Aus seinem sonstigen Leben servieren wir Ihnen Auszüge aus seiner Autobiographie, die er in ruhigen Augenblicken zwischen 1876 und 1881 entwarf und die für seine Familie gedacht war und erst nach seinem Tod publiziert wurde. Schließlich nahmen wir einige Gedanken und Briefe aus dem Band ›Leben und Briefe von Charles Darwin‹ auf, den sein Sohn Francis 1887, fünf Jahre nach Charles’ Tod, herausgab. Daneben haben wir eine Chronologie (S. 144–148) gestellt, die Darwins Leben bis zur Veröffentlichung der »Entstehung« nachzeichnet, und zahlreiche andere faszinierende, malerische und aussagekräftige Bilder mit einem Bezug zu ihm als Mensch und zur »Entstehung«. Das ist immerhin eine illustrierte Ausgabe von Darwins großem Werk – vielleicht die einzige im Augenblick.
Die visuelle Komponente unseres Buches führt schon für sich genommen in die wissenschaftlichen Ideen der »Entstehung« und den historischen Hintergrund ihrer Veröffentlichung ein. Es ist eine reiche Galerie von Fotografien, Ölporträts, alten Holzschnitten, Skizzen und anderen Reproduktionen, darunter viele der wunderbaren kolorierten Lithographien (von Elizabeth Gould, der Ehefrau des Ornithologen John Gould, und anderen), die ursprünglich in den Bänden von ›The Zoology of the Voyage of H.M.S. Beagle‹ erschienen. So finden Sie z.B. auf Seite 3 ein schönes Porträt von Erasmus Darwin, dem Großvater von Charles, der im 18. Jahrhundert selbst ein bekannter Intellektueller und früher Theoretiker über das Thema Evolution war. Die Seiten 12 und 13 zeigen Ihnen einen erstaunlichen Vogelfalter aus Neuguinea; andere lebendige Bilder sind u.a. das Wasserschwein im heutigen Uruguay (S. 67), die Galapagos-Riesenschildkröte (S. 177) und weitere endemische Spezies des Archipels, die Lemuren auf Madagaskar (S. 184), die bizarr angepassten Baumkängurus in Australien und Neuseeland (S. 460) usw.
Auf der historischen Ebene bieten wir Ihnen einen Blick auf die Länder, Institutionen und Schauplätze, die in Darwins Leben wichtig waren, und auf die Menschen, die ihm privat und wissenschaftlich nahestanden. Das Haus, in dem er aufwuchs (The Mount, S. 53), erinnert uns daran, dass er aus einer begüterten Familie stammte – ein entscheidender Umstand für Darwins berufliche Laufbahn, da er sich nie von der Forschung abwenden musste, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Das Bild seines Studentenausweises (S. 76) der medizinischen Fakultät in Edinburgh, die er nach zwei Jahren angewidert verließ, erinnert uns daran, dass er als junger Mann – wie so viele junge Männer – verwirrt und unentschlossen war und den Weg zu seiner eigentlichen Berufung nicht auf Anhieb fand. Das sind beredte visuelle Artefakte. Dann sind da noch die Personen, die ihn unterstützten, die Männer (und ein paar Frauen), die ihm halfen, zu dem zu werden, der er war, und das zu tun, was er tat: Robert Fitzroy, der Kapitän der Beagle (der auf S. 20 so gebieterisch dreinblickt); John Stevens Henslow, sein großherziger Mentor in Cambridge (S. 95); Charles Lyell, der Modernisierer der Geologie und Darwins erster bedeutender wissenschaftlicher Freund und Gönner nach der Beagle-Reise (S. 178); die Bulldogge Thomas Huxley, der öffentlich für Darwins Theorie die Schlachten schlug, für die Darwin selbst zu schüchtern war (S. 317); sein engster akademischer Vertrauter Joseph Hooker (S. 322, auf einem wunderbaren Gemälde, das den stets jungen und geschmeidigen Verstand hinter dem grau werdenden Bart andeutet); und schließlich Darwins Ehefrau Emma (auf S. 212 zur Zeit ihrer Heirat und auf S. 485 in späteren Jahren).
Eines dieser nachhallenden Bilder möchte ich Ihnen besonders ans Herz legen: Darwin selbst, gemalt von John Collier nach dem Tod des Forschers (S. 487). Der Künstler hat, wie ich finde, in diesen Augen etwas Wahres und Wichtiges eingefangen. Er erfasste den festen Blick eines sanften, aber grundehrlichen Mannes, eines Mannes, der die Welt nicht in Aufruhr versetzen wollte, aber auch nicht davor zurückschreckte zu sagen, was er über die Ursprünge der Anpassung, Diversität und Komplexität bei den Lebewesen auf unserer Erde für richtig hielt.
»Kulturelle Bildung« ist ein Begriff, mit dem u.a. anderen etwas vorgeschrieben wird, und unter diesem Banner sollte niemand angegangen oder herablassend behandelt werden. Niemand kann genau sagen, welche paar großartigen Bücher für die Selbstverwirklichung und Bildung anderer Menschen unbedingt notwendig sind. Wir müssen nicht alle dieselben Dinge wissen. Der Physiker und Romancier C. P. Snow, der glaubte, die heutige Ausbildung trenne zu stark zwischen Wissenschaft und Kunst und die Leute auf der Kunstseite neigten zu Selbstgefälligkeit, argumentierte 1959 in seinem Vortrag »Die Zwei Kulturen« treffend, dass beispielsweise die völlige Unkenntnis des Zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik (der über die Entropie) eine nicht weniger eklatante Lücke darstellt wie die völlige Unkenntnis der Werke Shakespeares. Natürlich könnte man Snow als englischen Grantler abtun, und es ist heutzutage durchaus möglich, in Amerika (und wohl auch in Britannien oder Deutschland) sein Examen zu machen, ohne auch nur den Hauch einer Ahnung von der Entropie und Hamlet zu haben. Dennoch, und auf die Gefahr hin, selbst als Grantler zu erscheinen, traue ich mich, anderen etwas vorzuschreiben: ›Die Entstehung der Arten‹ ist ein Buch, das jeder gebildete Mensch lesen sollte.
Und genauso wichtig: Es ist ein Buch, das für jeden gebildeten Menschen ein Genuss ist.