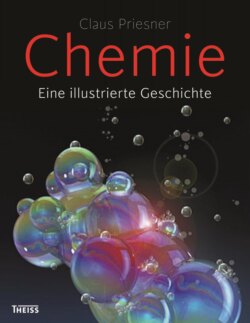Читать книгу Chemie - Claus Priesner - Страница 27
Lederbereitung und Gerberei
ОглавлениеWann die Menschen auf den Gedanken kamen, die Haut erlegter Tiere als Kleidung zu benutzen, ist nicht bekannt, da Leder als organisches Material im Lauf der Zeit zerfällt. Wir kennen aber aus Knochen gefertigte Kratzer, die zum Entfernen der Haare von Fellen benutzt wurden und der Altsteinzeit zuzurechnen sind. Auch auf altsteinzeitlichen Felszeichnungen tragen die abgebildeten Personen Hosen oder Röcke aus Fellen oder Leder. Es ist anzunehmen, dass Menschen in kälteren Regionen irgendwann versuchten, die Häute als Decke oder Umhang zu verwenden. Dabei werden sie bemerkt haben, dass eine naturbelassene Haut – ob mit oder ohne Haaren – bald anfängt zu faulen und beim Eintrocknen steif, hart und spröde wird. Um sie haltbar, weich und elastisch zu erhalten, musste sie sowohl mechanisch wie chemisch behandelt werden.
Tierfelle. Felsgravierungen am Monte Bego, um 2000 v. Chr.
Die tierische Haut besteht aus drei unterschiedlichen Schichten: der Oberhaut, der Lederhaut und der Unter- oder Fetthaut. Die Oberhaut (Epidermis) trägt das Fell bzw. die Behaarung; die Haarwurzeln reichen dabei bis in die Lederhaut (Corium). Die Unterhaut (Subcutis) stellt die Verbindung der oberen Hautschichten mit dem Körpergewebe her. Für die Lederherstellung ist einzig die Lederhaut geeignet; wird sie zusammen mit der Epidermis gegerbt, spricht man von Pelz. Die Lederhaut besteht aus langen Fasern von Collagen, einem hochpolymeren Protein. Die Fasern sind zu Bündeln verdrillt, die wiederum zu einem netzartigen Gewebe verbunden sind und die Festigkeit bzw. Elastizität der Lederhaut bedingen. Die chemischen Prozesse bei der Gerbung dieser Lederhaut sind komplex und immer noch nicht in allen Einzelheiten erforscht. Man nimmt heute an, dass einerseits eine physikalische Adsorption (Anlagerung an eine feste Phase) der Gerbstoffe durch die Collagen-Struktur erfolgt und zudem auch chemische Bindungen zwischen den Proteinen und den Gerbmitteln entstehen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es viele chemisch sehr unterschiedliche Gerbmittel gibt, sodass man nicht von einem einheitlichen Reaktionsverlauf ausgehen kann.
Zunächst muss die Lederhaut freigelegt werden. Damit sich die beiden anderen Schichten relativ leicht abtrennen lassen, wird die komplette Haut zunächst mit Wasser eingeweicht. Nach einigen Tagen lassen sich dann die auf einen halbrunden »Schabebaum« gespannten Häute mit einem Schabmesser von der Unterhaut befreien. Die Entfernung der Haare der Epidermis ist schwieriger, da die Haare mitsamt den in der Lederhaut steckenden Haarwurzeln entfernt werden müssen. Ursprünglich handelte es sich bei diesem Schritt um eine Fäulnis, ausgelöst durch Wärme und Fäulnisbakterien, die in der Luft vorhanden sind und sich auf einem geeigneten Substrat rasch vermehren. Da das Wässern und Faulen der Häute mit beachtlichem Gestank verbunden war, wurden die Gerbereien außerhalb der Wohnbereiche und flussabwärts angelegt. Im Laufe der Zeit entwickelten sich auch raschere und weniger stinkende Verfahren, zu denen vornehmlich das Einlegen der Häute in ein Bad aus »Kalkmilch« (eine Lösung bzw. Aufschlämmung von Calciumhydroxid, Ca(OH)2, in Wasser), vermischt mit noch ungelöstem Kalk, gehört. Wann dieses als »Äscherung« bezeichnete Verfahren aufkam, ist nicht bekannt, es war aber im europäischen Mittelalter bereits in Gebrauch. Die Schwierigkeit bestand in der Optimierung der Prozessdauer: Die Haare sollten sich leicht aus der Lederhaut lösen, diese selbst durfte aber nicht nennenswert angegriffen werden.
»Der Läderer«, Holzschnitt von Jost Amman, Eygentliche Beschreibung aller Stände auff Erden hoher und nidriger, geistlicher und weltlicher, aller Künsten, Handwerken und Händeln … (Ständebuch), mit Versen von Hans Sachs, 1568.
Nun erst kann das eigentliche Gerben erfolgen. Die früheste Gerbmethode war die Fettgerbung, bei der die Lederhaut mit Fett, Tran oder Öl behandelt wurde. Dieses schon in der Altsteinzeit angewandte Verfahren basiert vermutlich auf der Beobachtung, dass eine durch Trocknen steif gewordene Tierhaut durch mehrmaliges Einfetten und Walken wieder weich und anschmiegsam wird. Die Fettgerbung, auch Sämischgerbung genannt, wird auch heute noch verwendet, wenn keine pflanzlichen Gerbmittel zur Verfügung stehen, etwa von den Inuit der Arktis.
Später, möglicherweise bei der Suche nach heilend wirkenden Pflanzenteilen, entdeckte man die gerbenden Eigenschaften adstringierender Pflanzenextrakte, und die Gerbung mit Eichenrinde oder Sumach (auch Färberbaum, Hirschhornbaum oder Essigbaum genannt) löste in jenen Gegenden, wo diese Pflanzen gediehen, die Fettgerbung im Lauf der Zeit ab. Sumach war ursprünglich in Südeuropa und am Ostrand des Mittelmeers beheimatet, breitete sich aber durch Anbau auch nördlich der Alpen aus. Bei dieser »Loh-« oder »Rotgerbung« schichtete man die vorbereiteten Häute in gemauerten Gruben oder Kästen in der Weise auf, dass zwischen zwei Häute immer eine etwa 3 cm dicke Schicht Lohe, d.h. kleine Stücke Eichenrinde gebreitet wurde. Je nach Größe der Gruben konnten hier im 19. Jh. mehrere hundert Häute übereinandergelegt werden. Nach der Beschickung wurde die Grube oder der Kasten mit Wasser ausgefüllt und dann wartete man erst mal einige Wochen, um der Gerbsäure Zeit zu geben, in die Narbe einzudringen und sich mit ihr zu verbinden. Dann setzte man die Häute um, d.h., man kehrte die Reihenfolge um, so dass die unteren Häute nun oben lagen und umgekehrt und ersetzte zugleich die verbrauchte Eichenrinde durch frische. Anschließend wurde wieder mit Wasser aufgefüllt und erneut gewartet. Dieser Vorgang wurde je nach Dicke der Lederhaut mehrmals wiederholt, bis nach 3–6 Monaten das Leder »gar« war. Neben Eichenrinde verwendete man auch gehäckseltes Sumachholz, auch die Rinde von Nussbäumen, Fichten, Erlen und anderen Bäumen kam zum Einsatz.
Ägyptische Lederwerkstatt. Ein Pantherfell wird in einem großen Topf eingeweicht (links), Häute werden mit Schabmessern gereinigt (Mitte) und über einen Bock gespannt (rechts), Wandmalerei in einem Grab in Theben, etwa 1450 v. Chr.
In Gebieten, in denen zum Gerben taugliche Pflanzen selten oder gar nicht vorkamen, entwickelte sich die »Weißgerberei«, die mit Alaun erfolgte und ein Leder von sehr heller Farbe lieferte. Alaun ist ein Doppelsalz, d.h., in seinen Kristallen treten zwei einfache Salze additiv zusammen, nämlich Kalium- und Aluminiumsulfat (der Name Aluminium leitet sich von der lateinischen Bezeichnung des Alauns »alumen« ab). Alaun besitzt die chemische Formel KAl (SO4)2•12 H2O. Es ist leicht in Wasser löslich und die Lösung ist schwach sauer. Wie die viel komplizierter gebauten Gerbsäuremoleküle lagern sich auch die Ionen des Alauns (Kalium-, Aluminium- und Sulfationen) in das vernetzte Proteingerüst der Lederhaut ein und modifizieren dieses. Das Ergebnis ist ein weiches, haltbares Leder. Alaun wird heute großtechnisch aus Bauxit oder Tonerde mit Schwefelsäure hergestellt, in früheren Zeiten laugte man alaunhaltige Erden oder Gesteine wie den Tonschiefer aus. Alaun wurde schon in der Antike auch als Arzneimittel und in großem Umfang zur Textilfärberei benutzt. Der Alaun wirkt dabei durch seine saure Reaktion als schwaches Ätzmittel (»Alaunbeize«), das die Faser gewissermaßen »aufraut« und somit für die Haftung der Farbstoffe sorgt.
Die Weißgerberei spielt heute keine große Rolle mehr, da anstelle des Alauns andere synthetische Gerbmittel zur Verfügung stehen, sofern man nicht mit einer pflanzlichen Lohe arbeitet. In der Antike war die Alaungerberei hingegen sehr verbreitet und wurde in Ägypten, Assyrien, Babylonien, Phönizien und in Griechenland verwendet. Welche Methode man auch verwendete, die Umwandlung einer rohen Tierhaut in haltbares, weiches, wärmendes und schützendes Leder war ein langwieriger und komplizierter Prozess – und dennoch handelt es sich dabei um eine der ganz frühen Kulturtechniken der Menschheit.