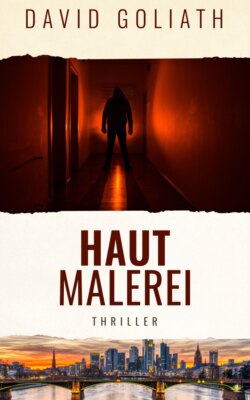Читать книгу Hautmalerei - David Goliath - Страница 6
Nacht & Nebel
ОглавлениеM wie Manie. Macht. Martyrium.
M wie Melancholie und Monotonie.
M wie Metamorphose und Mutation.
M wie Maskerade und Massaker, Mortalität und Meisterwerk.
M wie Maler. Misanthrop. Monstrum. Mephisto.
M wie Mörder.
M wie Meinereiner.
Ich blicke in den dreckigen, gesprungenen Spiegel. Eine flackernde Glühbirne über mir kämpft gegen die Schatten, vor allem gegen den Schatten, der in meinem Gesicht liegt, geschützt von der Kapuze des Pullovers. Der Rest der heruntergekommenen Einzimmerwohnung im Souterrain ist dunkel. Fenster fehlen. Mehr als die Nacht wäre ohnehin nicht hereingekommen. Ein Keller mit einem abgewetzten Schlafsofa und einem schmierigen Waschbecken, daneben ein Eimer für die Notdurft.
Da sind wir wieder.
Ich ziehe einen Mundwinkel nach oben, ein schiefes, bösartiges, einseitiges Grinsen. Kaum zu erkennende Schemen.
Es hat mir gefallen.
Ich wasche meine Hände. Das Wasser spült fremdes Blut, schwarze Tinte und Camouflage-Make-up von meiner Haut, die selbst mit schwarzer Tinte gefüllt ist. Ein verformtes Stück Seife hilft bei hartnäckigen Stellen. Das Becken färbt sich schwarz, rot, gelb. Immer wieder protestiert der Wasserhahn. Immer wieder folgen braune Ablagerungen einem Stakkato an Strahlunterbrechungen. Trotzdem reibe ich meine eingeseiften Hände unter dem Schmutzwasser in einem konditionierten Muster – als hätte ich es jahrelang trainiert, verinnerlicht, automatisiert. Innen. Außen. Fingerknöchel, Fingerknochen, Fingerspitzen. Nägel, Nagelbetten. Handgelenke. Unterarme. Nach dem minutenlangen Ritual und mehreren Nachschlägen bei der Seife drehe ich den Hahn zu. Zuletzt hatte sich das Wasser durchweg braun verfärbt. Das löchrige Handtuch wischt die Nässe trocken, saugt sie auf, verschmiert sie. Ich hänge es zurück an den krummen Haken, der sich langsam aus dem Fliesenspiegel löst. Er wackelt, als ich das Handtuch an seinen angestammten Platz bringe, hält aber wacker die Stellung. Danach fixiere ich mein unbehelligtes Antlitz in den verästelten Bruchfragmenten des Spiegels.
Endlich. Ich habe es vermisst.
Ich fasse mit der linken Hand nach der flackernden Glühbirne über mir und ziehe sie zu mir. Meine gewaschene Hand ist durchzogen von Tinte: ein feixender Totenkopf auf dem Handrücken, umgeben von Blutrinnsalen, die weiter den Arm hochkraxeln, und lateinische Phrasen der Länge nach auf jedem Finger.
Malum in se – „Übel in sich“. Auf dem Daumen. Er zeigt auf die Person, die das Böse in sich trägt. Er zeigt auf mich. Meinereiner.
Das Licht fällt auf den Spiegel, der die Strahlen reflektiert und mein Gesicht beleuchtet, soweit es die Kapuze zulässt. Die Augen bleiben im Verborgenen. Ein glattrasierter Kiefer. Fremde Blutspritzer haften darauf. Ein unscheinbarer Mund. Speichel, Schweiß und Sekret haben das Cover-Make-up partiell abgetragen, was die darunter versteckte Schwärze hervorblitzen lässt. Doch im Ganzen kann man die Zierde noch nicht sehen.
Recte faciendo neminem timeas – „Tue Recht und scheue niemand“. Auf dem Zeigefinger. Erhoben zur Warnung, erhoben zur Anklage. Zeigt auf denjenigen, der die Strafe verdient.
Ich bin müde. Es war eine lange Nacht. Meine Gelenke schmerzen. Mir fehlt die Kraft der Jugend. Ich muss mir meine Energie einteilen, bin nicht mehr so agil wie vor ein paar Jahren. Trotzdem ist der Durst wieder geweckt – und gestillt, fürs Erste.
Demon est deus inversus – „Der Teufel ist die Kehrseite Gottes“. Auf dem Mittelfinger. Den kann ich in die Höhe recken und zeigen, was ich von Gott und der Welt, vom Mensch und seinem Irrweg halte.
Ich streife die Kapuze nach hinten, mit der rechten Hand. Auch dort, Tätowierungen. Allerdings ein weinender Totenkopf auf dem Handrücken, im schaurigen Kontrast zu seinem Genossen links, und skelettierte Finger. Der Ärmel des Pullovers verbirgt weitere Details, aber im Ansatz erkennt man brennende Erde.
Rigor mortis – „Totenstarre“. Auf dem Ringfinger der linken Hand, die die Glühbirne umfasst. Der unbeweglichste aller Finger als Sinnbild für den nach dem Tod erstarrten Leib, den ich für meine Kunst benutze. Manchmal auch noch nicht erstarrt – je nachdem, wo ich bin und wie viel Zeit mir bleibt, mein Kunstwerk zu vollenden.
Im Schein des hinter einer Glasphiole glühenden Drahtes offenbart sich mein Konterfeit, das unergründlich in den Spiegel starrt. Blutspritzer zieren Kinn, Wangen und Nase. Bis auf Augenbrauen und Wimpern fehlen meinem Kopf weitere Haare - Schädel und Bart sind glattrasiert. Meine Haut wirkt blass, porös, künstlich. Eingetrocknete Schweißperlen waren beim Versuch das Geheimnis zu lüften gescheitert. Sie konnten lediglich ein paar Ansätze offenlegen, die wie Dreckpartikel aussehen.
Mortua manus – „tote Hand“. Der kleine Finger bildet den Abschluss, das Ende. Die in die Haut gravierten Zeilen stigmatisieren mich bis in den Tod und darüber hinaus. Erst der unrühmliche Verfall wird die Schrift mit der Haut zersetzen. Auf meinen Knochen werden dann nur noch die Spuren der Nadelstiche zu finden sein, die zu tief eingedrungen sind.
Ich löse den Griff von der Glühbirne. Das Stromkabel von der Decke holt sich ihr Eigentum zurück und bremst den flackernden Auswuchs pendelnd, während das warme Birnenglas Striemen auf der Innenfläche meiner linken Hand hinterlassen hat. Dann drehe ich den Wasserhahn wieder auf, forme meine Hände wie ein Gefäß, sammele Nässe, beuge mich über das Waschbecken und schwappe sie in mein Gesicht. Mehrmals. Fremdes Blut und Make-up lösen sich. Schließlich tauche ich wieder vor dem Spiegel auf. Wasserperlen laufen mir von der Fratze, die das Nass offenbart hat. Nase und Ohren sind vollkommen schwarz tätowiert. Flüchtig könnte man meinen, sie existieren nicht. Auf den Lippen prangen eingespritzte Zahnreihen, breiter als die ursprüngliche Anatomie. Ein farbloser Skelettmund. Das Rot der Sinnesorgane abhandengekommen, ausgelöscht. Meine Augen ähneln schwarzen Höhlen – ein Oval zwischen Braue, Jochbein und Nasenbein. Wäre die weiße Sklera nicht zwischen Tintenklecks und Pupille, könnte man sich in den Tiefen der Finsternis verlieren. Ich fasse hinein, nehme etwas zwischen Daumen und Zeigefinger in die Schraubzwinge und hole es aus meinem Auge. Die Kontaktlinse verhält sich wie Wackelpudding auf meinen Fingern, als würde sie darum betteln wieder zurück in die feuchte Höhle zu dürfen. Dabei ist es keine Wohltat. Es fühlt sich an wie ein Sandkorn und reibt in mir, während es mich in den Wahnsinn treibt. Zudem schränkt es mein Sichtfeld ein, was für Pirsch und Jagd nicht unbedingt zuträglich ist, aber notwendig, um meine Identität zu schützen. Als ich das andere Sehorgan von der artifiziellen Applikation befreit habe, blicke ich mit gänzlich schwarzen Augen in den Spiegel. Die weiße Sklera wurde bereits vor sehr langer Zeit mit schwarzer Tinte geschwängert. Die Nadeln fliegen in jährlichem Zyklus über mich hinweg, damit die verbleichende Schwärze neue Intensität erlangt.
Ich lösche das Licht. Meine spärlichen Habseligkeiten liegen nicht im Weg herum. Ich finde mein Nachtlager blind, streife die Klamotten ab und lege mich nackt in mein durchgesessenes Schlafgemach. Mit geschlossenen Lidern und vor der Brust ineinander abgelegten Händen liege ich auf dem Rücken. Die vollkommene Dunkelheit umschließt mich. Es fühlt sich wohlig, geborgen und sicher an. Ein Maulwurf in seinem Tunnel. Ein Straußenkopf im Sand.
Diesem Bastard habe ich die Abreibung verpasst, die er verdient hat. Zwar nicht mein bestes Werk, aber für meine Auferstehung, meine Renaissance, nicht schlecht. Eine Fingerübung zum Warmwerden. Dieser Kick war einfach unglaublich. Wie sie mich angeschaut haben, diese fremdelnden, unschlüssigen Menschen. Wie sie an mir vorbeigeschlichen sind, unsicher, ob sie ihrem Drang nach Voyeurismus nachgeben sollten. Unsicher, ob sie die Polizei rufen sollten. Unsicher, ob sie mutig nachfragen sollten, wie es dem Mann, der bäuchlings auf der Brüstung der Brücke lag, ging, und was ich denn hier mache. Sie sahen nicht, dass dem Mann unablässig Wasser aus dem Mund tropfte. Wasser, das außen an der Brüstung hinunter in den Fluss tropfte. Sie sahen nicht, dass der Mann längst erlöst war.
Doch sie alle schlichen vorbei. Keiner machte ein Foto. Keiner traute sich, das Mobiltelefon mit der hochauflösenden Kamera zu zücken. Sie alle waren erschrocken über die Offenherzigkeit, die ich an den Tag legte – oder vielmehr in die Nacht. Die dezent ausgeleuchtete Alte Brücke verschaffte mir Schatten, in denen ich mich austoben konnte. Historisch romantische Beleuchtung nennen die Stadtplaner die wenigen Laternen, die an die graue Vorzeit erinnern sollen. Schummeriges Licht mit altem Stein im Kontrast zu den Glasfassaden und Flutlichtern der Hochhäuser des Bankenviertels in Sichtweite. Spaziergänger – Touristen und einheimische Nachtschwärmer – sollen auf dem Pflaster der Vergangenheit für gut 200 Meter die Hektik der Moderne vergessen, verdrängen oder ausblenden, selbst wenn sie sich die Passage mit vier Fahrspuren teilen müssen, zwischen pulsierenden Stadtvierteln voller Vergnügen, Laster und Sünde.
Und dann sahen sie mich, wie ich einem Mann die Haut auf dem entblößten Rücken mit 6000 Nadelstichen pro Minute verschönerte. Das kunstvolle Muster entging ihnen natürlich, wegen der seltsamen Wahl von Ort und Zeit. Ich hatte mich für einen abstrakten Reichsadler entschieden, dessen Kopf, Klauen und je ein Flügel gekreuzt abgewinkelt in alle vier Richtungen deuteten – eine Swastika sozusagen, oder Hakenkreuz. Neben diversen völkischen und antisemitischen Motiven auf dem Körper des Mannes fühlte sich der Vogel recht wohl. Meine versierte Vorgehensweise im Halbdunkel und das Selbstverständnis, das ich versprühte, verblüfften die Menschen so sehr, dass sie mein Handeln nicht in Frage stellten. Sie gingen einfach weiter, wunderten sich über diesen merkwürdigen Straßenkünstler und den bereitwilligen Mann, der das hell erleuchtete Panorama der Großstadt genoss, während man seinen Rücken malträtierte. Die glanzlosen Augen des Rassisten konnten die blitzlichtaffinen Schlitzaugen nicht sehen, da lediglich der Hinterkopf grüßte.
Manchmal lächelte ich einen dieser Menschen an, aus Spaß. Ich wollte die Reaktion testen. Die meisten erschraken, senkten den Kopf und huschten schnell an mir vorbei. Einer lächelte zurück. Ich sah seine glasigen Pupillen, die mich nicht fixieren konnten, stattdessen um mich herumschwirrten wie Fliegen um einen Freiluftabort. Torkelnd und lallend passierte er mich, ohne mich zu belästigen. Vielleicht hatte er die ratternde, akkubetriebene Tätowiermaschine in meiner Hand zucken sehen und vibrieren hören oder war irritiert von den Blutspritzern, die mein Gesicht besprenkelten, oder den schwarzen Tintenbächen, die von Werkzeug und Latexhandschuhen herunter platschten. Oder er war schlicht von Sinnen, fokussiert auf den Gehweg, ständig am Lächeln.
Vorbeifahrende Autos hielten nicht an. Die Insassen beachteten mich nicht. Zu dieser späten Sunde staute sich der Verkehr auch nicht mehr an beiden Ufern. Es gab also keinen Grund den Bürgersteig fernab von Übergängen unter die Lupe zu nehmen. Selbst Polizeistreifen ließen mich achtlos liegen. Straßenkunst kennt in dieser Stadt so viele komische Formen, dass man es vermeidet, sich mit allen Abartigkeiten zu belasten. Einmal winkte ich dem Einsatzfahrzeug sogar, ohne Resonanz zu erhalten. Die Nacht schützte mich sehr gut.
Als ich fertig war, stellte ich mich lässig an die Brüstung, um mein Umfeld zu beobachten. Ich hatte keine Lust die Beine in die Hand zu nehmen, weshalb ich einen günstigen Moment abpasste, in dem mich bauliche Wölbung der Alten Brücke, Uneinsehbarkeit durch Vegetation und abebbendes Nachtgewimmel für einen Moment zur einsamsten Person auf der Flussüberquerung machten. Dann warf ich einen letzten Blick auf das Tattoo – so wie er es wollte, dachte ich – und den Bastard in den Main. Neben dem Ruderverein plumpste er ins kalte Wasser und verschwand in der Tiefe. Ich wartete noch ein paar Minuten, lauschte dem Verkehr, dem entfernten Rauschen aus Nachtleben, Glockenspiel und Sirenen, das der seichte Wind zu mir trug. Niemand hatte den Sturz gesehen. Niemand hatte den Aufschlag vernommen. Also packte ich meine Sachen zusammen, klappte den Rollstuhl auseinander, mit dem ich den Körper geschoben hatte, setzte mich hinein und kurvte gemütlich von dannen, mit sauberen Händen an den Greifreifen, denn die Handschuhe hatte ich - die schmutzige Seite ineinander gestülpt - ausgezogen und eingesteckt. Passanten schenkten mir mitleidige Blicke – mir, meinen schlaffen Beinen, auf denen ich einen leeren Eimer balancierte, und dem ächzenden Rollstuhl. Ich lugte unter der Kapuze hervor, an der Kamera für Verkehrsüberwachung und öffentliche Sicherheit vorbeirollend, die mich als blinden Fleck aufzeichnete. Mein Adrenalinrausch näherte sich der Klimax und nährte sich von Geltungssucht, Sadismus, Exhibitionismus und Selbstjustiz.