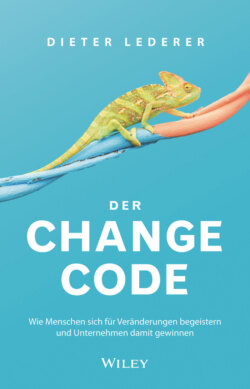Читать книгу Der Change-Code - Dieter Lederer - Страница 10
1.1 Warum Gewohnheiten bequem sind
ОглавлениеGewohnheiten retten Leben, so könnte man es ausdrücken. Letzen Endes ist unser ganzes Leben von Gewohnheiten durchzogen, bis hin zu den Basisfunktionen unseres Körpers, die völlig selbstverständlich und ohne bewusstes Zutun in gewohnter Manier ablaufen. Tun sie das nicht, empfinden wir das als massive Störung und versuchen, die bekannte Ordnung schnellstmöglich wiederherzustellen. Auf Gewohnheiten ist Verlass, sie umzusetzen braucht wenig Energie. Denken Sie an Sport- oder Essgewohnheiten: Einmal eingeübt, sitzen sie wie intensiv gepaukte Vokabeln und können mit traumwandlerischer Sicherheit eingehalten werden. Minimale Anstrengung bei maximalem Nutzen, wer wollte das nicht? Sicherheit, Schnelligkeit, Effizienz – die Liste der Vorteile von Gewohnheiten ist lang und wir vertrauen zu Recht darauf. Wenn der Notfallmediziner zum Unfallort kommt, die Feuerwehr zum Brand, Piloten oder Zugführer vor dem Start die Systeme prüfen: Immer dann sind wir heilfroh über deren eingeschliffene Routinen. Darin steckt ein hohes Maß an Erfahrung, Optimierung und Verlässlichkeit. Die Neurophysiologie spricht in diesem Zusammenhang von Bahnung und meint damit, dass Wiederholungen die vermehrte Bildung und Verstärkung von Synapsen im Gehirn nach sich ziehen8. Dies führt dazu, dass gewohnte Wahrnehmungs-, Denk- und Verhaltensmuster leicht abrufbar sind – etwa in der Weise, wie eine gut ausgebaute Straße viel leichter befahrbar ist als ein kaum genutzter Feldweg. Es muss also nicht verwundern, dass uns der Umgang mit Gewohnheiten besonders leichtfällt, wenn wir ihnen folgen, und schwer, wenn wir sie ändern möchten oder müssen.
Kritisch wird es, wenn die althergebrachten Muster nicht mehr tragen.
Kleine Schritte für großen Wandel?
Kritisch wird es nämlich, wenn die althergebrachten Muster nicht mehr tragen. Dann werden Gewohnheiten schnell zur Behinderung, denn das Verlassen bekannter Pfade ist unbequem und braucht viel mehr Energie, als stur geradeaus weiterzugehen. Diesen veritablen Sog zurück ins Alte zu überwinden, herauszukommen aus dem stabilen Modus des Bequemen, etwas Neues zu probieren, und sei es nur temporär, das ist die wahre Herausforderung, die viel häufiger misslingt als glückt. Das kann derart weit gehen, dass wir lieber missliche Zustände in Kauf nehmen, als die Gewohnheit zu durchbrechen. Sie kennen wahrscheinlich Menschen, die in unglücklichen Beziehungen verharren, oder solche, für die es kaum denkbar ist, eine andere Gaststätte als das seit zehn Jahren frequentierte Lieblingsrestaurant aufzusuchen. Früher oder später aufstehen, einen anderen Weg zur Arbeit nehmen, den Kaffee ohne Zucker trinken oder statt an die Nordsee an den Atlantik reisen? Für viele Menschen kaum denkbar, gleichwohl nichts wirklich Bedeutendes damit verbunden ist. Umso schwieriger, wenn etwas daran hängt – unser Renommée zum Beispiel: »Wie kann es sein, dass sie oder er sich auf so etwas Neumodisches einlässt? Das hätten wir nie erwartet.« Oder unser Erfolg: »Das neue Verfahren kann schiefgehen, wie dumm stehe ich dann da?« Oder unsere Sicherheit: »Ich weiß ganz genau, dass ich das alte Tool beherrsche, doch wie ist es mit dem neuen?«
Lieber missliche Zustände in Kauf nehmen, als Gewohnheiten durchbrechen?
Die Gewohnheitsforschung weiß um die Anziehungskraft gebahnter Verhaltensweisen und versucht deshalb, diese mit sogenannten »tiny habits« auszutricksen (Fogg, 2019). Das Prinzip ist einfach: Man überlege sich kleine Schritte, die zu einem gewünschten Ziel führen, und hänge diese an alte Gewohnheiten. Fünf Liegestützen nach der morgendlichen Dusche, ein Glas Wasser nach jeder Tasse Kaffee, das Handy für zehn Minuten in die Schublade nach dem Hochfahren des Rechners, die Datei mit einem Änderungskommentar wieder einchecken nach dem Bearbeiten, die Notiz zum Kundentelefonat erstellen nach seiner Beendigung usw. Das Verknüpfen mit bestehenden Gewohnheiten ist elegant, das Herunterspielen der Änderung ebenfalls. Wir vermitteln unserer Wahrnehmung, dass im Vergleich zu vorher fast alles beim Alten ist. Ob damit der Weg von der Sportniete zum Marathon-Ass, vom überkommenen zum zeitgemäßen Geschäftsmodell, zu digitalisierten Prozessen oder zur disruptiven Innovation beschritten werden kann, ist fraglich. Mutmaßlich lässt sich mit »tiny habits« nur ein Teil der in Unternehmen erforderlichen Transformationsprozesse umsetzen. Einen Vorteil jedoch haben sie: Häufig eingesetzt, lassen sich Menschen damit an das regelmäßige Vorkommen und die Bewältigbarkeit von (kleinen) Veränderungen gewöhnen. Das macht flexibel und vermag den Boden für größeren Wandel zu bereiten.
Keine Emotionen, keine Bewegung
Hier noch ein anderer Blick auf Gewohnheiten. Kennen Sie Menschen, die abnehmen, mit dem Rauchen aufhören, mehr Sport machen oder der Prokrastination ein Ende setzen wollten, es jedoch nicht getan haben? Dabei geht es nicht um in der Gefühlsschwere der Silvesternacht schnell noch gefasste Vorsätze fürs neue Jahr, sondern um überlegte und durchdachte Schritte. So wie bei einem meiner Freunde, der durchschnittlich groß, jedoch weit überdurchschnittlich schwer ist. Beim Autofahren muss er viel Bauch zwischen Sitz und Lenkrad unterbringen, in der Wahl seiner Kleidung ist er eingeschränkt, da vieles sich nicht mit seiner Körperfülle verträgt, Kreislauf und Gelenke machen immer mal wieder Beschwerden. Also auf zum Abnehmen, schließlich gibt es eine Reihe sehr guter Argumente dafür. Das will er auch, glaubt man seinen Bekundungen, und zwar seit Jahren, nein, inzwischen schon seit Jahrzehnten. Er weiß genau, was er dafür tun oder lassen müsste, kennt die neuesten ernährungsphysiologischen Trends und Diäten in- und auswendig, hat diverse Pläne schwarz auf weiß und immer mal wieder angefangen, sich danach zu richten. Doch gehalten hat es bisher kein einziges Mal. Seine Gewohnheiten sind stärker als jeder Versuch, die Pfunde purzeln zu lassen: Zum Frühstück ordentlich reinhauen, ein kräftiges Mittagessen, zwischendurch etwas Süßes, Abendessen mit Bier und nahezu keine Bewegung – dieser Ablauf ist über viele Jahre hinweg eingeübt, läuft ohne Zutun von selbst, ist hoch verlässlich und routiniert. Niemand im Familien- und Freundeskreis glaubt ihm mehr, wenn es mal wieder ums Abnehmen geht, seine Situation scheint verfahren. Doch wider Erwarten hat sich jüngst etwas getan, das nach der unglaublich langen Zeit der Stagnation Hoffnung gibt: Er hat eine Frau kennengelernt und ist nunmehr seit drei Monaten sehr darauf bedacht, sein Gewicht in den Griff zu bekommen. Die ersten Erfolge haben sich schon eingestellt, dieses Mal könnte es nachhaltig klappen. Was ist anders? Nicht mehr und nicht weniger als der zentrale Antrieb für Transformation und das Überwinden von Gewohnheiten: Gefühle. Er weiß und fühlt ganz genau, wofür er abnimmt. Hatte er früher medizinische und praktische Gründe für seine Diät angeführt, tritt heute stattdessen ein Glanz in seine Augen. Die Pläne und die erforderliche Disziplin unterscheiden sich nicht, wohl aber die intrinsische Motivation. War früher auf rationaler Ebene alles klar, so kommt heute die emotionale Bejahung des Abnehmens als die eigentliche Triebfeder hinzu.
Verändern fällt um ein Vielfaches leichter, wenn es mit positiven Gefühlen verknüpft ist.
Aus der Hirnforschung kennen wir die Hintergründe für diese Zusammenhänge: Lernen und damit auch Verändern fallen uns um ein Vielfaches leichter, wenn es um etwas geht, das uns wirklich wichtig und folglich mit positiven Gefühlen verknüpft ist (Hüther, Was wir sind und was wir sein könnten, 2011). Bei Kindern werden regelrechte »Begeisterungsduschen« im Gehirn ausgelöst, wenn sie Schritt für Schritt erst ihren Köper erkunden und beherrschen lernen und dann ihre Umwelt. Bei Erwachsenen ist der Mechanismus immer noch genau derselbe, doch wir haben uns meist schon viel zu sehr daran gewöhnt, uns in »trockenen«, rationalen, nahezu emotionsfreien Kontexten zu bewegen. Dann sind Begeisterungsduschen die Ausnahme und entsprechend zäh werden viele Aufgaben und Projekte – bis hin zum Abarbeiten nur unter hohem Druck kurz vor der Deadline oder gar Verweigern, wie das Beispiel vom Abnehmen zeigt. Dazu kommt, dass unser Gehirn dafür prädestiniert ist, in Bildern und Geschichten zu denken. Zahlen, Daten, Fakten und strikt rationale Sachargumentation spielen eine untergeordnete Rolle. Konkrete bildhafte Vorstellungen regen eine Vielzahl unterschiedlicher neuronaler Netzwerke an und führen zu einer Verknüpfung mit Gefühlen und Ausschüttung neuroplastischer Botenstoffe, somit zu einem ganz anderen, intensiveren Einprägen und Erinnern. All das unterbleibt bei rein abstrakter Sachlogik, die deshalb meist den kürzesten Weg durch den Kopf nimmt: zum einen Ohr hinein und zum anderen wieder hinaus.
Beim Unternehmenswandel ist es genauso: Ohne Begeisterung oder zumindest Vertrauen, ohne eine bildliche Vorstellung davon, wo die Reise hingeht, ohne bejahende Emotionen bewegen sich Menschen gar nicht oder nur bei großem extrinsischem Druck. Dann sind maximal freudlose Disziplin, emotionsloses Pflichterfüllen und rein funktionales Abarbeiten erreichbar. Große Sprünge sind damit nicht zu machen, das Überwinden von Gewohnheiten ebenso wenig. Es läge also nahe, große Transformationsprogramme so aufzuziehen, dass sie einen emotionalen Sog entwickeln. Doch trotz des Wissens darum ist eher geflissentliches Ignorieren an der Tagesordnung. Lieber zum x-ten Mal mit säuberlich ausgearbeiteten Tabellen die nächste Einsparungsrunde begründen und mit der Gießkanne Budgets kürzen, als die Mitarbeiter durch einen Exzellenz-Wettbewerb zum Einbringen ihrer Erfahrungen aufzurufen, um dysfunktionale und unnötig teure Abläufe abzustellen. Lieber einen Chief Digital Officer mit der Ausarbeitung von Digitalisierungskonzepten betrauen und diese nach einem Vorstandsbeschluss ausrollen, als Bottom-up-Ansätze evaluieren und damit Buy-in bei den Mitarbeitern bekommen. Lieber zum Erstellen feingranularer Prozesse gemäß einem regelungswütigen Prozessmodell aufrufen, die am Ende in der Schublade verstauben, als unter Vorgabe einfacher Basisprinzipien zu pragmatischer Handhabung zu kommen. Wie viel Begeisterung geht davon aus? Dabei ist die Sache ganz einfach: Wenn der Wurm dem Fisch nicht schmeckt, beißt er nicht an. Die Mehrheit der Change-Würmer schmeckt nicht, um im Bild zu bleiben.
Rechnen Sie damit, dass Ihnen das Durchbrechen von Gewohnheiten einen gehörigen Strich durch die Rechnung beim Unternehmenswandel macht.
Wir sind Gewohnheitstiere
Wir lieben unsere vertraute Ordnung, wir lieben Verlässlichkeit und Kontinuität, wir lieben Gewohnheiten. Es ist folglich naheliegend, dass uns Neues häufig nicht nur unbequem, sondern bedrohlich erscheint. Die schnellsten Reflexe dazu kommen aus unserem Hirnstamm, auch »Reptiliengehirn« genannt, und sind ca. 500 Millionen Jahre alt: Angriff, Flucht oder Totstellen (Cannon, 1915). Sie zünden durch, wenn wir uns überrascht, in die Enge getrieben oder angegriffen fühlen, gleichwohl wir als moderne Menschen auch andere Optionen zur Verfügung hätten, wie etwa Verhandeln, Klären, Kompromisse schließen und Ähnliches. Rechnen Sie also damit, dass Ihnen das Durchbrechen von Gewohnheiten einen gehörigen Strich durch die Rechnung beim Unternehmenswandel macht. Das ist nichts Persönliches oder sonderlich Individuelles, es liegt vielmehr in unserer menschlichen Grundstruktur. Günstig ist es folglich, mit Veränderungen so umzugehen, dass sie als erstrebenswert, emotional zu befürworten und beherrschbar sowie weder als übertölpelnd noch als bedrohlich wahrgenommen werden. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit erheblich, dass uns die lieben alten Gewohnheiten weniger in die Quere kommen, als wir es heute noch viel zu oft erleben. Mehr dazu im zweiten Teil dieses Buchs.