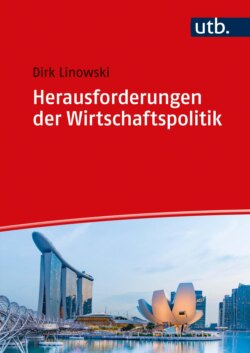Читать книгу Herausforderungen der Wirtschaftspolitik - Dirk Linowski - Страница 6
1 Zum ethisch-moralischen Rahmen in Zeiten des Umbruchs 1.1 Wendezeit? Versuch einer geopolitischen Einordnung
ОглавлениеDie deutsche Gesellschaft steht in einer sich rapide verändernden Welt vor gewaltigen Herausforderungen, die, da alles mit allem verbunden ist, nicht monokausal beantwortet und ebenso nicht auf Deutschland isoliert bezogen, sondern zunächst im Kontext der Mitgliedschaft Deutschlands in der Europäischen UnionEuropäische Union und nachfolgend im „Weltmaßstab“ analysiert werden müssen.
Inzwischen ist schon wieder fast vergessen, dass vor Beginn der Corona-Krise aus Griechenland und aus Spanien bis zum Beginn des Jahres 2020 hoffnungsvolle Signale zur Wirtschaftsentwicklung kamen: Die Europäische Union befindet sich aber nicht wieder, sondern immer noch in einer langandauernden veritablen Krise. Man darf hier durchaus das Jahr des Ausbrechens der letzten großen Finanzkrise, 2008, als einen sinnvollen Bezugspunkt wählen.
Die staatliche und private VerschuldungVerschuldung hatte bereits vor der Corona-Krise in vielen Ländern (nicht nur in der EU) ein Vielfaches der Jahreswirtschaftsleistung angenommen. „Staatstragende“ Parteien waren vielerorts in der Defensive bzw. verschwunden. Dies betrifft nicht nur Griechenland, sondern ebenso Spanien, Großbritannien, Polen und Frankreich (dort wurde der Schritt der Pulverisierung der Altparteien bereits mit den Präsidentschaftswahlen im Mai 2017 vollzogen), um nur einige „größere“ europäische Länder zu nennen. Trotz ihres Wiedererstarkens während der Hochphase der Corona-Seuche im Frühjahr 2020 ist überhaupt nicht klar, ob und wie CDU und CSU in den kommenden Jahren ihre Rollen als mit Abstand stärkste deutsche Volksparteien verteidigen können.
Zu den zahlreichen Wirtschaftswissenschaftlern, die die Hauptverantwortlichkeit des Staates darin sehen, BeschäftigungBeschäftigung für die arbeitsfähige und -willige Bevölkerung zu schaffen, zählen Nobelpreisträger Joseph Stiglitz und ebenso die deutschen Ökonomen Peter Bofinger und der besonders prominente „Ordnungspolitiker“ Hans-Werner Sinn. Unterschiedlich sind allerdings zum Teil die Vorschläge, wie dies zu erreichen sei. Wenn Sie diese Maxime ebenso ernst nehmen wie die genannten Ökonomen, werden Sie schnell zu dem Schluss kommen müssen, dass zahlreiche Staaten in der EU ihren zentralen Aufgaben schon seit Langem nicht oder nur unzureichend nachkommen.
Die europäische Dauerkrise, die durch hohe ArbeitslosigkeitArbeitslosigkeit, international vielfach nicht wettbewerbsfähige ProduktivitätenProduktivität und damit sinkenden Wohlstand charakterisiert ist, stärkt einerseits „populistische“ Parteien. Diese werden hier so gefasst, dass von ihnen (zu) „einfache“ Lösungen für die äußerst komplexen miteinander verwobenen Problemkreise angeboten werden. Ebenso gestärkt werden andererseits separatistische Bewegungen wie z.B. in Schottland, in Norditalien, im Baskenland und in Katalonien. Grundsätzlich ist mittelfristig weder die EU, wie wir sie kennen, noch der Bestand der Gemeinschaftswährung Euro garantiert.
Wir befinden uns derzeit in einer dritten Phase der aktuellen europäischen Krise: Zuerst wurden Finanzinstitute gerettet, dann Staaten. Nun werden die politischen (Rück-)Wirkungen sichtbar, wobei bei Weitem nicht klar ist, ob sich alle unsere europäischen Partner in demokratischer Art und Weise reformieren werden können.
Alle diese Probleme sind mit der Entwicklung der Bevölkerungen verbunden. Aus diesem Grunde werden wir unsere Betrachtungen mit einer Darstellung und Analyse der demografischen Entwicklung der Bevölkerung in Deutschland eröffnen.
Wir stehen in Deutschland und in der EU vor den folgenden zentralen Herausforderungen:
1 Eine schleichende EntsolidarisierungEntsolidarisierung der Gesellschaften. Diese beginnt auf dem Niveau der Familien und steht damit im Zusammenhang zur „modernen Arbeitswelt“, berührt Fragen der Generationengerechtigkeit, geht weiter über „egoistische“ Spartengewerkschaften, die Mitglieder vertreten, deren Arbeit für unsere Gesellschaft schwer verzichtbar ist, und betrifft ebenso Staaten. Diese Entsolidarisierung ist direkt mit den Schwierigkeiten verbunden, die Funktionsfähigkeit des Rechtsstaats, wie wir ihn kennen und schätzen, aufrechtzuerhalten.Hoffnung macht hier der Ende 2020 tatsächlich noch gelungene Vertrag über einen geordneten Austritts Großbritanniens aus der EU in Folge des Ergebnisses des Mitte 2016 abgehaltenen Referendums.Hier ist Zurückhaltung angebracht, Solidarität „nur“ von den anderen EU-Mitgliedstaaten einzufordern. Die Entscheidungsfindung deutscher Bundesregierungen in den vergangenen ca. 20 Jahren wurde und wird in unseren Nachbarländern oft mit derjenigen von „Big Gorilla” USA verglichen; mit anderen Worten: Deutschland trifft unilaterale Entscheidungen und die kleinen Länder bzw. deren Regierungen müssen folgen, ob sie wollen oder nicht. Dies betrifft die nach dem Unfall von Fukushima im Frühjahr 2011 abrupt eingeleitete „Energiewende“ sowie die Entscheidung der deutschen Bundesregierung im Sommer 2015, die deutschen Grenzen mit der Begründung, eine humanitäre Katastrophe zu verhindern, zu öffnen. Unabhängig davon, ob diese Sichtweise zahlreicher Nachbarn stimmt oder nicht: Es gilt das aus dem Englischen kommende Sprichwort Perception is Reality (wobei diese „Erkenntnis“ u.a. bereits im alten China gewonnen und von Menzius formuliert wurde).
2 Entwicklung von Strategien, mit MigrationMigrationsströmen innerhalb der EU und insbesondere aus Nordafrika und dem Nahen Osten kommend umzugehen: Ende 2020 existierte weder ein Konsensus noch eine schlüssige Strategie, wie diese Flüchtlingsströme (und die Sicherung der EU-Außengrenzen) für die europäischen Empfängerstaaten beherrschbar gemacht werden können. Die südeuropäischen Staaten, die seit mehr als 10 Jahren am meisten unter der Wirtschaftskrise leiden, werden mit diesem Problem auch finanziell von den reichen und stabilen Nordländern, die keine relevanten Außengrenzen der EU haben, zu sehr allein gelassen. Hier existiert in mehrerlei Hinsicht ein Bezug zur globalen Umweltkrise.
3 Entwicklung von (gesamteuropäischen?) Strategien zum Umgang mit Russland: Mehrere osteuropäische Staaten wie Polen, Estland, Lettland und Litauen fühlen sich von Russland permanent bedroht, auch wenn Russland behauptet, keinerlei Angriffsgelüste gegenüber der NATO zu verspüren. RusslandRussland bzw. seine politische Elite fühlt sich wiederum von der NATO, die ihrerseits behauptet, nur Verteidigungsaktivitäten zu verfolgen, bedrängt und bedroht. Tatsächlich finden wir uns inzwischen in einer gefährlichen Gemengelage wieder, bei der ein Zufall durchaus zu einer Eskalation zwischen dem Westen und Russland führen kann: eine Situation, die noch vor wenigen Jahren kaum jemand für möglich gehalten hätte. Auch hier gilt für jede der unterschiedlichen Perspektiven: Perception is Reality.
Filmtipp:
Diese Sicht der Dinge ist im Film „Rashomon“ des japanischen Regisseurs Akira Kurosawa aus dem Jahre 1950 meisterhaft dargestellt. Kurosawa geht noch einen Schritt weiter: Seine Akteure haben nicht nur unterschiedliche Sichtweisen der Realität, sondern sie erfuhren unterschiedliche Realitäten.
Diese drei Eckpunkte wären Anfang 2014 vermutlich für die Mehrzahl der in diesem Text vorgestellten politischen Argumentationen hinreichend gewesen. Tatsächlich stellt sich das Gesamtbild sieben Jahre später deutlich komplizierter dar. Zusätzlich zu den drei erstgenannten prägen weitere sechs Entwicklungen seit Kurzem unser Bewusstsein und unsere Wahrnehmung einer instabiler gewordenen Welt:
1 Die Preise von Rohstoffen, insbesondere Erdöl (vgl. den Langfrist-Rohölchart in Abb. 1.1), Erdgas, Industrie- und Edelmetallen, aber auch von Agrarrohstoffen und Halbprodukten wie Stahl schwanken seit dem Ausbrechen der Finanzkrise teils dramatisch. So sind diese in den Jahren 2014 und 2015 sehr stark gefallen, bevor sie sich im Verlauf des Jahres 2016 wieder moderat erholten, um zu Beginn des Jahres 2020 wieder zu kollabieren, um sich kurz darauf wieder zu erholen… Niedrige Rohstoffpreise sollten uns als Importeure von Rohstoffen nicht zum Jubeln verleiten, sondern mögliche politische Krisen in rohstoffexportierenden und von den betreffenden Erlösen abhängigen Staaten antizipieren lassen. Kurz- und mittelfristig dürften am wenigsten Russland (vgl. Kapitel 12), dafür aber zahlreiche Golfstaaten, darunter Saudi-Arabien, ebenso Venezuela, Nigeria, Brasilien und diverse andere Schwellenländer stärker betroffen sein.
Abb. 1.1:
Rohölpreisentwicklung der Sorte BRENT von 1985–2020 in US-Dollar pro Barrel1 (Eigene Darstellung: Daten von Refinitiv)
1 Terrorism is back. Die durch die terroristischen Attacken im November 2015 in Paris geprägte westliche Wahrnehmung, ist, weil stark zeitpunktbezogen und europazentriert, irreführend. Die Angriffe von Paris waren „nur“ ein schreckliches Ereignis innerhalb von wenigen Monaten bzw. Jahren in einer Kette terroristischer Anschläge, die bereits Jahrzehnte andauern. Sie sind in eine Reihe von mörderischen Anschlägen weltweit (in der Türkei, Tunesien, auf russische Touristen in Ägypten, im Libanon, in der Yunnan-Provinz in China u.v.m.) einzuordnen. Den wirtschaftlichen Konsequenzen der Anschläge in Tunesien im Jahr 2015, die praktisch den Zusammenbruch der Haupteinnahmequelle des Landes, des Tourismus’, zur Folge hatte, steht in Europa bisher nichts annähernd Gleichartiges gegenüber. Als Folge werden politische Allianzen im Nahen Osten seit ca. drei Jahren neu gedacht (vgl. Punkt 3 und Punkt 6).
2 Der im Dezember 2010 beginnende sogenannte Arabische Frühling war offensichtlich deutlich mehr Hoffnung als Realität: Der gesamte Nahe Osten (englisch: Middle East) und große Teile Nordafrikas werden entweder (wieder) von diktatorischen Regimes „regiert“ oder sie sind in Anarchie und Bürgerkrieg abgeglitten. Allianzen sind, sofern überhaupt vorhanden, oft kurzlebig und zweckgebunden. Zu den „Überraschungen“ der vergangenen Jahre zählten die wechselseitigen (temporären?) Annäherungen zwischen Saudi-Arabien, Israel und Russland. Die geopolitische Situation im Nahen Osten und hier insbesondere der seit dem Jahr 2011 andauernde Syrienkonflikt ist wiederum direkt mit der Flüchtlings- bzw. Migrationsproblematik und der RusslandRusslandpolitik der EU bzw. ihrer Nationalstaaten verwoben.
3 Anfang des Jahres 2020 war der US-Dollar fraglos die Weltleitwährung Nummer eins. Die Schwankungen des Wechselkurses von US-Dollar und Euro, der zweitwichtigsten Weltwährung, waren in den vergangenen Jahrzehnten aber immens (s. Abb. 1.2). So verlor der US-Dollar gegenüber dem Euro z.B. von 2002 bis 2008 innerhalb von ca. 6 Jahren fast die Hälfte seines Wertes, um sich danach wieder auf relativ niedrigem Niveau zu erholen (vgl. Exkurs zu Kapitel 14).
Abb. 1.2:
Wechselkurs US-Dollar pro Euro 1985–2020 (Eigene Darstellung: Daten von Refinitiv)
Tatsache ist, dass die Dominanz der US-Währung mittelfristig zur Disposition steht: So wurde die Währung der Volksrepublik China, der Renminbi (RMB), im Jahre 2016 fünfte Reservewährung des Internationalen Währungsfonds (IWF). Dies hatte zunächst einen eher symbolischen Wert, da China bereits einen Großteil seiner Handelsgeschäfte, und das nicht nur mit Entwicklungsländern, in RMB abschließt. Zusammen mit der Ankündigung der chinesischen Zentralregierung, Chinas Währung schrittweise frei konvertierbar zu machen, wird dies Auswirkungen auf die internationale politische Machtbalance haben. Währung ist Macht: Im günstigen Fall dürfen wir langfristig die Herausbildung eines stabilen Oligopols zwischen US-Dollar, Euro und RMB erwarten.
1 Mit dem Brexit hat Anfang 2021 eine der wirtschaftlich und militärisch stärksten Nationen die EU verlassen. Es wird im optimistischen Fall nur einige wenige Jahre dauern, bis sich zwischen Großbritannien und der (Rest-)EU ein „normales“ und hoffentlich freundschaftliches Nachbarschafts- und Arbeitsverhältnis herausgebildet haben wird. Deutschland als bevölkerungsstärkstes Land und wirtschaftliches Zentrum der Europäischen Union wird teilweise für die EU-Nettozahlungen Großbritanniens einstehen und zudem zusätzliche Ausgaben in den Verteidigungshaushalt einstellen müssen, um der Selbstverpflichtung, in Zukunft zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung zu investieren, wenigstens mittelfristig zu genügen. In diesem Kontext wird häufig der Ruf nach einem Kerneuropa und damit verbunden nach der Stärkung bzw. „(Re-)Vitalisierung“ der von de Gaulle und Adenauer initiierten deutsch-französischen Achse laut.[2] Diese Diskussion ist jedoch nicht neu, sondern derzeit weit hinter dem zurück, was Charles de Gaulle angedacht hatte, als er als französischer Präsident Anfang der 1960er Jahre auf die Deutschen zuging.
2 Die EU wird grundsätzliche Fragen beantworten müssen, um ihren Zerfall zu verhindern: Dazu zählen jenseits von technisch relativ einfach lösbaren Wiederaufbauhilfen nach Corona primär die Gewährleistung der Sicherheit der Außengrenzen der EU, die Entwicklung von Konzepten, wie der Dauer von (Jugend-)Arbeitslosigkeit in weiten Teilen Süd- und Osteuropas begegnet werden soll, und die Frage, wie sie sich gegenüber den großen Nachbarn Türkei und Russland positionieren will. Insbesondere kann die weitere Entwicklung der EU nicht sinnvoll losgelöst von der seit 2008 schwelenden Eurokrise betrachtet werden, die zwar derzeit nicht mehr im Fokus der Medienberichterstattung steht, die aber nichtsdestotrotz nicht vollständig überwunden ist. In diesem Zusammenhang lohnt es sich, die Entwicklung der Positionen der Bundesregierung und des französischen Präsidenten und ihrer jeweiligen „Follower“ bezüglich einer Aufwertung des European Stability Mechanism (ESM) zu einem European Monetary Fund zu verfolgen. Die deutsche Bundesregierung hat im Frühjahr 2020 aus guten Gründen (und nicht zu früh und nicht zu spät) offensichtlich einer Teilvergesellschaftung von Schulden unter dem Schlagwort Corona-Wiederaufbau zugestimmt und damit den EU-Gipfel im Juli 2020 wesentlich mitbestimmt.Die nicht überwundene Krise der Europäischen Währungsunion und die Absenz einer stringenten Strategie der Bundesregierung zu ihrer Überwindung stellt eine, wenn nicht die zentrale Ursache für die Schwäche Europas dar, die sich durch hohe Arbeitslosigkeit, niedrige Produktivitätszuwächse, wachsende Schulden u.v.m. manifestiert. Deutschland ist als „Zahlmeister“ ohne nennenswerte Rechte in den meisten Nachbarstaaten weiterhin willkommen, sein moralischer Ruf aber nicht nur in Italien angekratzt und seine Durchsetzungskraft gering. Als das Land, „das (sich) mangels eigener konstruktiver Pläne an das Bestehende klammert, auf den Buchstaben der Verträge [die bereits über 160 Mal ohne Sanktionen gebrochen wurden] pocht und sich damit als Aufseher stilisiert, erzeugt es Widerstand, ohne etwas zu erreichen.“[3] Spätestens seit der Wahl von Donald Trump zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika im November 2016 ist in fundamentaler Art und Weise klar, dass das Verhältnis von Deutschland und Europa zu den Vereinigten Staaten neu austariert werden wird. Das zentrale Versprechen Donald Trumps war das Schaffen von (Industrie-)Jobs in den USA, wobei Trumps Politik mit der US-Unternehmenssteuerreform aus dem Jahre 2017 und der Androhung von Zöllen für Importe genau darauf abzielten. Vor allem Letzteres steht in bewusstem Gegensatz zum Paradigma des Freihandels, dem sich Deutschland verpflichtet fühlt und von dem es als Exportnation profitiert. Die zweite uns betreffende, zentrale Aussage von Donald Trump ist die Forderung an Europa bzw. an die NATO-Mitglieder, sich finanziell deutlich stärker an den Ausgaben des Bündnisses zu beteiligen. Sein Nachfolger Joe Biden dürfte hier kaum anders denken. Trump lehnte – vor allem aus ökonomischen Gründen – ab, dass die USA weiterhin die Rolle der (einzigen) Supermacht, die die Welt ordnet, ausfüllen. Dies korrespondiert mit einer prinzipiellen Ablehnung von „Demokratisierungsversuchen abroad“ und dem von den Demokraten verhinderten Versuch einer Neuausrichtung der US-amerikanischen Politik gegenüber Russland, um sich auf den „strategischen Rivalen“ China konzentrieren zu können. Die erneute „Aufteilung“ in eine aus zwei Einflusszonen bestehende Welt ist wieder denkbar geworden. Erste einflussreiche Stimmen, wie z.B. der Springer-Aufsichtsratsvorsitzende Mathias Döpfner, fordern bereits, dass wir uns zwischen den USA und China (für die USA) entscheiden müssen.[4] Die Setzung von Technologiestandards (Stichwort Huawei) ist hier von zentraler Bedeutung (vgl. Kapitel 10 und 13).
In Kulmination der genannten Punkte 1 bis 9 steht der Westen, wie er sich seit dem Ende des II. Weltkrieges darstellte und wie wir ihn kennen, zur Disposition.
Das sehr lesenswerte und kontrovers diskutierte Buch des in Großbritannien lehrenden Historikers Christopher Clark „Die Schlafwandler“, das das „Hineinstolpern“ der europäischen Großmächte in den I. Weltkrieg äußerst detailliert beschreibt, wurde von seinem Autor 100 Jahre nach dessen Ausbruch sehr wohl mit Blick auf Analogien zu möglichen neuen globalen Krisen geschrieben (damit war nicht nur Europa, sondern ebenso Ost- und Südostasien gemeint).
Die Beziehungen zwischen China und den meisten seiner Anrainerstaaten, insbesondere mit Japan (zu dem es keine echte Aussöhnung nach dem II. Weltkrieg gegeben hat), sind mit „angespannt“ zumeist noch freundlich beschrieben. Perception remains Reality. Während viele Nachbarn Chinas einem wirtschaftlich und militärisch starken China skeptisch gegenüberstehen, gibt es in China wiederum historisch begründete „Einkreisungsängste“ (vgl. Kissinger, 2012, Kapitel 1).
Tatsächlich befinden wir uns heute, im Gegensatz zur Ausnahmesituation einer Bipolarität im sogenannten Kalten Krieg, der von ca. 1947 bis 1990 währte, in einer „unübersichtlichen“ Globalsituation (die zudem durch neue Methoden der Kommunikation und Überwachung gekennzeichnet ist), deren Entwicklung zu einer neuen Bipolarität zwar nicht zwingend, aber möglich ist. Mit anderen Worten: Geschichte wiederholt sich, wenn, nicht als Tragödie, sondern als Farce (frei nach Karl Marx in „Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte“).
Kein europäischer Staat, von RusslandRussland einmal abgesehen, hat so viele Nationalstaaten als Nachbarn wie Deutschland, kein anderes europäisches Land erreicht auch nur annähernd die deutsche Wirtschaftskraft. Der historische „Fluch“ des jüngeren Deutschlands von der 2. Reichseinigung im Jahre 1871 bis zum Ende des II. Weltkriegs in Europa im Jahre 1945 war es, groß und wirtschaftlich stark in der Mitte Europas zu stehen, und dabei einerseits zu klein zu sein, um Europa dominieren zu können (als man das noch wollte!); dass andererseits aber ohne Deutschland „nichts in Europa ging“ und geht. Dieser „Fluch“ sollte mit der politischen und wirtschaftlichen Einbindung Deutschlands in die EU gelöst werden.
Heute hat Deutschland mit ca. 83 Millionen von etwas über 500 Millionen Menschen in der Europäischen Union (inklusive Großbritannien) einen Anteil von etwa einem Sechstel der Gesamtbevölkerung (bzw. ca. einem Neuntel der Bevölkerung von Gesamteuropa), steht aber für mehr als ein Fünftel der Wirtschaftsleistung der EU. Während der Anteil der Industrie am BIP in der EU im Jahre 2017 bei nur ca. 16% lag (Großbritannien und Frankreich noch deutlich darunter), waren es in Deutschland immer noch über 22%. Daran hat auch die seit 2018 andauernde Rezession der deutschen Automobilindustrie qualitativ (noch) nichts geändert.
Abb. 1.3:
Anteil des verarbeitenden Gewerbes an der Bruttowertschöpfung in den jeweiligen EU-Mitgliedstaaten 2007 vs. 2017 (Quelle: Bundesministerium der Wirtschaft[5])
Damit lag der deutsche Anteil an der der EU-Industrieproduktion bei ca. 30% und bei ca. 6% der Weltindustrieproduktion. Keine andere große Volkswirtschaft – Stichwort Exportweltmeister2 – ist so mit dem Rest der Welt verwoben.
Nicht nur in diesem Zusammenhang sei Ihnen die Abschiedsvorlesung von Hans-Werner Sinn aus dem Jahre 2015 sehr empfohlen, die Sie sich z.B. auf YouTube ansehen können.[6]
Damit verbunden ist ein sowohl ökonomisches und soziologisches „Megathema“: der Einfluss der Niedrigzinsen der Europäischen ZentralbankEuropäische Zentralbank (EZB) und weiterer großer Nationalbanken wie der Fed, der Bank of Japan und der Bank of England, sowie der People’s Bank of China, auf unser individuelles Verhalten und auf die Investitionstätigkeit von Unternehmen und damit auch auf unser Gemeinwesen (s. auch Kapitel 6).
Dies betrifft nicht nur die Entwicklung der Vermögensverteilung, sondern ebenso die der Kapitalanlagen, es betrifft die AltersvorsorgeAltersvorsorge und auch die Konzentration wirtschaftlicher und politischer Macht. Die Nichtexistenz einer risikofreien Anlage in dem Sinne, dass die Nominalzinsen und die Realzinsen null oder sogar leicht negativ sind, treibt private wie geschäftliche Investoren nicht selten in Projekte, die bzw. deren assoziierte Risiken sie nicht verstehen.3
Niedrige oder negative Zinsen begünstigen somit auch die Übernahme- und Fusionswelle bei Unternehmen; sie sind ebenso ein wesentlicher Grund für die schnelle Erholung der Aktienkurse nach dem „Corona-Einbruch“ im März 2020. Die Barreserven der größten (zumeist US-amerikanischen) Unternehmen betrugen Ende 2020 viele Hunderte Milliarden US-Dollar, wobei mangels Anlagealternativen der Druck zu Übernahmen – und damit zu Konzentration – massiv zunimmt. Gesellschaftlich relevante Beispiele waren die im Spätherbst 2015 (angekündigte aber schließlich gescheiterte) Übernahme von Allergan durch den US-amerikanischen Pharmariesen Pfizer, das Zusammengehen der Medienunternehmen Walt Disney mit der 21st Century Fox im Jahr 2017, die 2017 vollzogene Fusion von Dupont und Dow Chemical zum weltgrößten Chemieunternehmen sowie die Übernahme der Pharmafirma Celgene durch Bristol-Myers Squibb im Jahre 2019.
Wenn in Relation zu Sachwerten und möglichen sinnvollen Investitionen zuviel Geld vorhanden ist, „sucht dieses verzweifelt profitable Anlagemöglichkeiten.“ Dazu korrespondiert auch der massive Abzug von Finanzmitteln der entwickelten Staaten (bzw. deren Finanzinstitutionen) aus den sogenannten Emerging Markets zu Beginn der Finanzkrise, der Wiederanlage und dem erneuten Abzug im Zuge der Corona-Krise.
Abbildung 1.4 verdeutlicht, dass unsere wichtigsten Handelspartner im Gegensatz zu den meisten europäischen Partnerstaaten nicht nur in Europa liegen. Wenn man von der EU als Ganzes abstrahiert, war China 2019 bereits das vierte Mal in Folge Deutschlands wichtigster Handelspartner.
Während das lange heiß diskutierte Transatlantic Trade and Investment Partnership-Handelsabkommen (TTIP) auf absehbare Zeit erledigt zu sein scheint, bleibt es für Deutschland von besonderem Interesse, zu erahnen, welche Auswirkungen das Ende 2020 unterzeichnete Regional Comprehensive Economic Partnership-Abkommen (RECP) und eine mögliche Wiederbelebung des ebenfalls totgesagten Trans-Pacific-Partnership-Abkommen (TPP) haben können.
Abb. 1.4:
Exporte und Importe der wichtigsten Handelspartner Deutschlands 2019 in Mrd. Euro (Quelle: Statistisches Bundesamt[7])
Tatsächlich sind die USA relativ gesehen gering in den Welthandel integriert. Daran ändern auch die Militärexporte, die amerikanische Ölindustrie, weltbekannte und geschätzte Marken wie Microsoft, Apple, Google, Facebook, Coca Cola, Levi Strauss, Hollywood und Mickey Mouse und die Diskussion zum Außenhandelsüberschuss Chinas nichts. Die Summe von Importen und Exporten dividiert durch das BIP betrug im Jahre 2017 lediglich 27,54% im Vergleich zu 86,53% für Deutschland bei einem Weltdurchschnitt von 58,02%. M.a.W.: Die USA können es sich bei ihrer geografischen Größe, vorhandenen Rohstoffen und ihren Streitkräften noch am ehesten leisten, aus der Weltwirtschaft weitgehend „auszusteigen“.4[8]
Bemerkung:
Handelspolitik ist auch oder vor allem Machtpolitik. Das Paradigma des weltweiten Freihandels, repräsentiert durch die World Trade Organization (WTO), wurde in den letzten Jahren weitgehend aufgegeben. So waren die USA in die bis dato gescheiterten Abkommen TTIP und TPP involviert, während China (neben Russland und Indien) an keinem der beiden Verträge teilhaben sollte. Ende 2020 war es schließlich China,unter dessen unbestrittener Führung das RECP unterzeichnet wurde. Jenseits der bis dato gescheiterten beiden großen Verträge sind das Zustandekommen von Freihandelsverträgen der EU mit Vietnam, Schwellenland mit über 90 Mio. Einwohnern, im Jahre 2015, Kanada im Jahre 2017, der weltweit drittgrößten Volkswirtschaft Japan im Jahre 2019 und Mexiko im April 2020 für Deutschland als Teil der EU sehr erfreulich.
Wir müssen uns, wenn wir mögliche zukünftige Pfade der gesellschaftlichen (und damit natürlich der wirtschaftlichen) Entwicklung Deutschlands erahnen wollen, auf historische wie juristische, wirtschaftliche, soziale und machtpolitische Argumentationen einlassen.
Eine bzw. die große Unbekannte stellt dabei die rasante TechnologieentwicklungTechnologieentwicklung und die dazu korrespondierende Machtkonzentration von Individuen, Unternehmen und Staaten dar (Stichworte Big Data, soziale Netzwerke, Autonomie des Individuums, öffentliche Sicherheit).
Noch vor weniger als einer Generation5 gab es keine Smartphones, kaum Internet, damit auch keine internetbasierten sozialen Netzwerke, kein GPS u.v.m.: Wir können also nicht wissen, welche technischen Innovationen unser Leben zukünftig verändern werden. Fahrerlose Züge und selbstlenkende Lkws erscheinen in näherer Zukunft wahrscheinlich, anders sieht dies (noch?) mit autonomem Fahren von Pkws aus. Abgesehen davon, was Nassib Taleb das unbekannte Unbekannte nannte, wovon wir noch überhaupt nichts ahnen! Letztlich kann sich moderne Technologie durchsetzen, wenn sie hinreichend skalierbar ist und die rechtlichen Rahmenbedingungen bzw. die Absenz von Verboten gegeben sind. Sie muss sich dann aber nicht durchsetzen.
Schauen Sie sich zum Beispiel in Ost- wie Westdeutschland verlegte Comics aus den 1950er Jahren an, in denen es jeweils von atomgetriebenen selbstlenkenden Autos u.v.m. wimmelt. Sehr zu empfehlen ist diesbezüglich auch die Filmtrilogie „Zurück in die Zukunft“, deren 1. Teil im Jahr 1985 präsentiert wurde.
Wenn man sich grafische Darstellungen der Entwicklung des Welthandels vor Augen führt, die in den letzten 10 bis 20 Jahren erstellt wurden, so suggerieren diese ein ungebremstes zukünftiges Ansteigen des Welthandels (mit einer „kleine Delle“, die zum Ausbruch der Finanzkrise korrespondiert), das mit unserem heutigen Wissen in dieser Form nicht eintreten wird (vgl. z.B.[9]).
Unklar sind die mittel- und langfristigen Auswirkungen der DigitalisierungDigitalisierung als wichtigster Treiber von Technologie auf den Arbeitsmarkt. Während die DigitalisierungDigitalisierung von Dienstleistungen naturgemäß Grenzen hat, zeichnet sich bereits ab, dass der WelthandelWelthandel insgesamt rückläufig werden muss, wenn zahlreiche Güter zukünftig vor Ort z.B. aus einem 3D-Drucker kommen. Ob und inwieweit die Anwendung der Blockchain-Technologie (derzeit sind etwa die Hälfte der Kosten im internationalen Handel mit Zolldokumenten und weiterer Bürokratie verbunden) diesen zur kostengetriebenen Hyperglobalisierung gegenläufigen Trend verlangsamen oder aufhalten kann, bleibt abzuwarten (vgl. Kapitel 10).
Übertriebenes Beispiel?!
Bekannt ist, dass die durchschnittliche Körperlänge der deutschen Bevölkerung im 20. Jahrhundert pro Generation (annahmegemäß 25 Jahre) um 3,8 cm zunahm. In diesem Zusammenhang lesen wir die fiktive Behauptung einer gedachten deutschen Boulevardzeitung „Deutsche im Jahr 3000 4 Meter lang!“
Lassen Sie uns zunächst über die zahlreichen Annahmen und die Art des Zustandekommens der Behauptung nachdenken. Nicht gegeben ist hier, ob es sich um Aussagen zur männlichen, zur weiblichen oder zur Gesamtpopulation handelt. Nehmen wir einmal an, dass es sich um die deutsche Gesamtbevölkerung handelt. (Auch hierzu sollten Ihnen bereits einige weitere Fragen einfallen.6)
In der fiktiven Schlagzeile sind weder die durchschnittlichen Körperlängen im Jahre 1900 noch im Jahre 2000 gegeben. Nehmen wir nun an, dass die das 20. Jahrhundert betreffende Aussage stimmt. Dann reicht es uns, einen dieser beiden Eckwerte zu kennen. Wenn die deutsche Gesamtbevölkerung im Jahre 2000 fiktiv durchschnittlich 175 cm lang war, dann war sie im Jahre 1900 175 cm – 3,8 ∙ 4 cm = 159,8 cm lang oder anders herum.
Die 159,8 cm Durchschnittslänge im Jahre 1900 und die 175 cm im Jahre 2000 gehören also zusammen. Mehr wissen wir erst einmal nicht. Nur, dass die Durchschnittslänge der Deutschen von 1900 bis 2000 um 15,2 cm gestiegen ist. Oder glauben Sie, dass 1925, 1950 und 1975 so genau gemessen wurde? Die Teilung durch die Anzahl der Generationen (deren gewählte Länge, wenn man den Begriff wörtlich nimmt, mit fortschreitender Zeit nichtlinear länger geworden sind) ist ebenso willkürlich.
Im 20. Jahrhundert gab es zwei Weltkriege mit insgesamt mehr als 70 Millionen Toten allein in Europa und darauf folgenden Hungersnöten und Grippen (das bekannteste Beispiel ist die Spanische Grippe nach dem I. Weltkrieg). Glauben Sie wirklich, dass die Deutschen im Durchschnitt kontinuierlich gewachsen sind? Ihnen fallen sicher noch viele weitere Fragen ein …
Die „Analytik“ ist nun, wenn wir die bereits gestellten Fragen verdrängen, ziemlich simpel. Die geschätzte Körperlänge im Jahr 3000 ergibt sich hier als Körperlänge im Jahre 2000 in cm + Anzahl der Generationen von 2000–3000, also 40, mal 3,8 cm. Damit sind wir bei 175 cm + 40 ∙ 3,8 cm = 327 cm (das sind „großzügig“ nach oben aufgerundet 4 Meter).
Die wirkliche „Frechheit“ ist, dass Sie aus einer kurzen Beobachtungsperiode (bzw. nur aus deren Eckpunkten), bei der mit Sicherheit kein lineares Wachstum der Körperlänge vorlag, auf eine viel längere Schätzzeit linear extrapolieren.
Überprüfen Sie sich selbst, inwieweit Sie den „Betrug“ bereits am Anfang bemerkt haben und erinnern Sie sich ggf. an dieses „Beispiel“, wenn Sie in den Medien bzw. im Beruf mit Behauptungen konfrontiert werden, bei denen die Annahmen nicht korrekt erläutert wurden und die demzufolge statistisch „wackelig“ begründet werden. Ganz allgemein gilt jedenfalls, dass (lineare) Extrapolationen auf die Zukunft mit großer Vorsicht zu genießen sind.