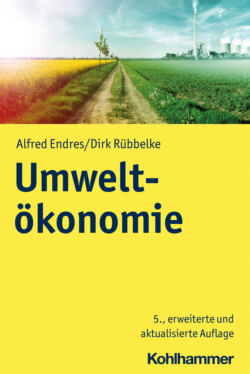Читать книгу Umweltökonomie - Dirk Rübbelke - Страница 11
V. Die Internalisierung externer Effekte zur »Wiederherstellung« der »verlorenen« Optimalität des Marktgleichgewichts
ОглавлениеMit der Charakterisierung des Gleichgewichts einerseits und des Optimums andererseits und der Feststellung ihrer Divergenz ist ein Problem aufgezeigt, aber noch kein Weg zu seiner Lösung gewiesen. Fassen wir, ehe wir uns den Lösungswegen zuwenden, noch einmal die oben gewonnen Einsichten über die Optimalität des Konkurrenzgleichgewichts im idealtypischen Modell und seine Suboptimalität im Modell mit externen Effekten zusammen:
a) Das Geheimnis der Optimalität des Konkurrenzgleichgewichts im idealtypischen Modell besteht darin, dass jeder Entscheidungsträger, der knappe Ressourcen in Anspruch nimmt, die von ihm bei anderen geschaffenen Knappheitsfolgen selber tragen muss: Der Käufer einer Einheit des knappen Gutes x verursacht mit seiner Kaufentscheidung simultan zwei Verdrängungseffekte. Er verhindert, dass die für die Produktion dieser Einheit eingesetzten Produktionsfaktoren in einer anderen Verwendung nutzbringend eingesetzt werden können und er hindert jeden anderen potentiell an der Einheit x interessierten Konsumenten daran, diese zu verbrauchen. Dasselbe gilt regelmäßig für Entscheidungsträgerinnen, Käuferinnen und Konsumentinnen. Wir erwähnen das im Folgenden nicht gesondert, um den Sprachfluss nicht unangemessen zu behindern. Diese negativen Folgewirkungen der Entscheidung unseres Konsumenten werden am Markt über die Produktionsgrenzkosten von x bzw. die marginale Zahlungsbereitschaft des rivalisierenden Konsumenten bewertet. Es ist nun zentral für das Verständnis der Optimalität des Marktgleichgewichts im einfachen Modell, dass der Marktpreis für x im Gleichgewicht diese beiden Verzichtskomponenten simultan widerspiegelt.45 Wir sehen an dieser Stelle der Erörterung, dass das in der Umweltpolitik (wenigstens vom Anspruch her) einschlägige Verursacherprinzip keineswegs als Erfindung ökonomiekritischer Ökologinnen und Ökologen gelten kann. Das Prinzip ist vielmehr ein Grundelement des Marktmechanismus selbst. Dort, wo er optimal funktioniert, beruht seine Optimalität gerade darauf, dass der Verursacher von Knappheiten mit den von ihm bei anderen verursachten Knappheitsfolgen unmittelbar finanziell belastet wird. Dadurch wird er veranlasst, diese vollständig in seine Entscheidungen einzubeziehen.
b) Das Marktversagen bei Vorliegen externer Effekte wird von der Durchbrechung des Verursacherprinzips konstituiert. Per definitionem zeichnet sich der negative externe Effekt dadurch aus, dass ein Dritter vom Entscheidungsträger beeinträchtigt wird, ohne dass diese Entscheidungsfolgen auf den Urheber zurückfielen. Mit der Internalisierung externer Effekte soll das Verursacherprinzip als Wesensmerkmal des Marktmechanismus auf diesen Bereich ausgedehnt werden. Es ist also wichtig zu verstehen, dass mit der Internalisierung externer Effekte kein ökologischer Fremdkörper in die Welt der Ökonomie getragen wird, sondern dass es sich vielmehr um eine konsequente Anwendung ökonomischer Prinzipien zur Wiederherstellung der Optimalität des Marktmechanismus handelt.46 In diesem (engen) Sinne wird der Begriff der Internalisierung externer Effekte im Folgenden verstanden. Es geht darum, dem Verursacher die per definitionem vom Markt zunächst einmal nicht erfassten negativen Handlungsfolgen finanziell anzulasten.47
Die Begriffe »Optimalität« und »Internalisierung« haben in der Literatur sehr häufig zu dem Missverständnis geführt, es handle sich dabei um das Gemälde einer »heilen Welt«, in dem eine Harmonie vorgegaukelt werde, die der von Konflikten geprägten Realität Hohn spreche. In Wahrheit kennzeichnet jedoch das ökonomische Optimum keinen Zustand der Harmonie, in dem alle Beteiligten (oder auch nur einer) unbedingt glücklich wären. Es ist vielmehr so, dass das ökonomische Optimalitätskonzept den Punkt identifiziert, in dem die Interessengegensätze zwischen den Beteiligten unüberbrückbar werden. Ist das Optimum noch nicht erzielt, können (definitionsgemäß) die bestehenden Anspruchskonkurrenzen um die knappen Ressourcen noch durch Reallokationen entschärft werden, bei denen sich mindestens einer verbessert, ohne dass die anderen sich verschlechtern, oder bei entsprechend klugen Umverteilungen sogar alle Beteiligten verbessern. Ist das Optimum dann realisiert, so heißt dies nicht, dass ein Zustand allgemeiner Glückseligkeit erreicht ist, sondern nur, dass jede Änderung, die einen besserstellt, einen anderen schlechterstellen muss. So sagt das optimale Gleichgewicht in Abbildung 1 nichts darüber aus, ob Konsument k arm ist und gerne reich wäre, oder ob nicht beide Konsumenten tief unglücklich darüber sind, dass sie nicht mehr als bzw. von dem geliebten Gut erhalten. Ebenso wenig charakterisiert die optimale Situation x** in Abbildung 2 eine Situation der Eintracht zwischen dem Verursacher des externen Effekts und dem Geschädigten. Vielmehr mag der Geschädigte bitter darüber Klage führen, dass er noch x** Einheiten des externen Effekts ertragen muss, während der Verursacher untröstlich darüber ist, dass er den externen Effekt von x* auf x** zurückführen musste. Der ökonomisch optimale Zustand kann die Interessengegensätze zwischen den Entscheidungsträgern nicht beseitigen, weil er das Problem der Knappheit nicht beseitigen kann. Er kann lediglich (und das ist schon viel!) die Interessengegensätze bis auf das durch die Knappheit der vorhandenen Ressourcen definierte Mindestniveau herunterführen. Suboptimale (ineffiziente) Zustände verursachen mehr Konflikte als bei gegebener Ressourcenausstattung nötig.
Zur Internalisierung externer Effekte, d. h. zur Anlastung der externen Grenzkosten beim Verursacher stehen verschiedene theoretische Varianten zur Verfügung. Die wichtigsten sind:
a) Verhandlungen über das Niveau des externen Effektes zwischen den Beteiligten im Sinne des von R. Coase (1960) entwickelten Paradigmas.
b) Die Schaffung von Institutionen, mit denen geregelt wird, inwieweit und unter welchen Bedingungen der Verursacher des externen Effekts dem Geschädigten den Schaden ersetzen muss (Haftungsrecht).
c) Die Belastung des Verursachers mit den in der sozial optimalen Situation verursachten externen Grenzkosten über eine Steuer nach dem Paradigma von A.C. Pigou (1932).
Wir haben oben Marktversagen als Folge von externen Effekten erklärt und widmen uns im anschließenden Zweiten Teil dieses Buches seiner Korrektur durch den Einsatz von Internalisierungsmaßnahmen. Dabei ist unterstellt, dass der Verursacher des externen Effekts diesen nicht bei der Entscheidung über Ausmaß und Qualität seiner Aktivität berücksichtigt, solange er nicht mit Internalisierungsstrategien konfrontiert wird. Insbesondere leistet er keinen Beitrag zur Umweltschonung aus bloßem Respekt vor der Natur. Auch das Wissen darum, dass sein Umweltverzehr das Wohlbefinden anderer Menschen beeinträchtigt, bleibt ohne Einfluss auf seine Entscheidungen. Er kann zur Einbeziehung der externen Effekte also nur extrinsisch motiviert werden.48
Die Unterstellung, dem Entscheidungsträger seien die Wirkungen seiner Aktivitäten auf das Wohlbefinden anderer gleichgültig, ist natürlich wieder mal so eine der unrealistischen Annahmen der neoklassischen Wirtschaftstheorie. In Wirklichkeit weiß doch jedes Kind, dass die Nutzen von Menschen interdependent sind. Also: Das Leben ist reich, die Neoklassik ist arm.49
Seitenblick 3: 50 Claudia und Gunhild Witzig führen ein pralles Leben jenseits der neoklassischen Dürre