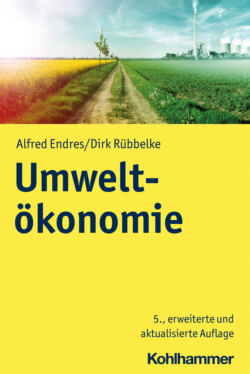Читать книгу Umweltökonomie - Dirk Rübbelke - Страница 8
II. Das Gleichgewichtskonzept in der mikroökonomischen Theorie
ОглавлениеDas Konzept des Gleichgewichts ist für die Umweltökonomie als angewandte Mikrotheorie von erheblicher Bedeutung. Seine Darstellung kann im Folgenden dennoch recht kurz erfolgen, da für die Erörterung des hier gestellten Themas nur die »Essentials« benötigt werden. Nähere Einzelheiten können in jedem mikroökonomischen Lehrbuch nachgelesen werden.12
Besonders eilige Leserinnen und Leser mögen den Wunsch verspüren, die Auseinandersetzung mit der weiter unten diskutierten Abbildung 1 zu vermeiden. Wir tragen diesem Wunsch mit dem folgenden Seitenblick 1 Rechnung. Vielleicht ermöglicht die Betrachtung der Kalligraphie ein intuitives (und damit äußerst zeiteffizientes) Verständnis des Gleichgewichtsbegriffs.
Seitenblick 1: 13 Na, – alles im Gleichgewicht?
Für eine etwas ausführlichere Auseinandersetzung mit dem Gleichgewichtskonzept ziehen wir Abbildung 1 zu Rate. Hier ist der Markt für ein beliebiges Produkt x von vorgegebener Qualität stilisiert dargestellt.14
Auf diesem Markt herrsche vollständige Konkurrenz.15 Die Angebotsseite des Marktes werde durch zwei Firmen, die Nachfrageseite durch zwei Haushalte gebildet.16 Die Angebots- bzw. Nachfrageentscheidungen der Akteure bezüglich des Gutes x werden wie folgt über den Markt miteinander koordiniert:
Für die Firmen i bzw. j entstehen bei der Produktion des Produktes x Grenzkosten in Höhe von GKi bzw. GKj.17 Es lässt sich zeigen, dass die Grenzkostenkurve einer jeden Firma der individuellen Angebotskurve dieser Firma entspricht.18 Aus den individuellen Angebotskurven der einzelnen Firmen ergibt sich über die horizontale Aggregation die Angebotskurve, A, für das Produkt x auf dem Markt. Für die beiden Haushalte ist je eine monoton fallende individuelle Nachfragekurve Nk bzw. Nl angenommen. (Nur zur Vereinfachung der Darstellung ist zusätzlich Linearität unterstellt.) Aus ihrer horizontalen Aggregation ergibt sich die Nachfragekurve, N, für den Markt.
Das Marktgleichgewicht ist bekanntlich durch den Schnittpunkt von Angebots- und Nachfragekurve charakterisiert, d. h. es stellt sich in der Abbildung 1 eine Gleichgewichtssituation mit dem Preis p* und der Menge x* ein.19 Zum Gleichgewichtspreis produziert die Firma i die Menge , die Firma j die Menge . Für diese Mengen ist die Gleichgewichtsbedingung für eine nach Gewinnmaximierung strebende Firma unter der Marktform der vollständigen Konkurrenz, »Preis = Grenzkosten«, erfüllt.
Zum Gleichgewichtspreis p* fragt der Haushalt k die Menge nach, der Haushalt l fragt die Menge nach. Die Gleichgewichtssituation eines Haushalts bei gegebenem Preis für ein Produkt ist dadurch charakterisiert, dass die marginale Zahlungsbereitschaft des betreffenden Haushalts für das Produkt dem Preis für das Produkt gleichkommt. Diese Bedingung ist für die auf der Mikroökonomie aufbauende Umweltökonomie sehr folgenreich und soll daher etwas näher erklärt werden:
Wichtig für das Verständnis des Haushaltsgleichgewichts ist es zunächst einmal, dass die Höhe der Bereitschaft des Haushalts, für eine (marginale) zusätzliche Einheit des Produkts zu zahlen, für jede Anfangsausstattung mit dem Produkt x als Ordinatenwert der entsprechenden Nachfragekurve abgelesen werden kann.
Abb. 1
Den Ordinatenwert der Nachfragekurve bezeichnen wir als »Nachfragepreis«, pN. So ist z. B. die Bereitschaft des Haushalts k, wenn er im Besitz der Menge ist, für eine zusätzliche (beliebig kleine) Versorgung mit dem Gut x zu zahlen, gerade als Ordinatenwert der Nachfragekurve über , nämlich , abzulesen.20 Wir behaupten, der Nachfragepreis sei mit der marginalen Zahlungsbereitschaft identisch, d. h. es gelte
Um dies zu verstehen, stellen wir uns einmal vor, es verhielte sich anders:21 Nehmen wir an, die Zahlungsbereitschaft des Haushalts für eine marginale über die Anfangsausstattung hinausgehende Einheit läge unter dem Ordinatenwert der Nachfragekurve beim Abszissenwert , d. h. sie sei kleiner als . Dann würde der Haushalt die letzte Einheit nicht zu einem Preis in Höhe von kaufen. Er würde ja sonst mehr für die Einheit ausgeben (nämlich ) als er auszugeben bereit ist (nämlich MZB). Dieses Ergebnis widerspräche der Annahme eines rationalen nach Nutzenmaximierung strebenden Individuums – und nur das Verhalten solcher Individuen wird mit dem hier vorgestellten Modell erklärt. Die marginale Zahlungsbereitschaft kann daher nicht unter dem Nachfragepreis liegen.
Nehmen wir nun an, die marginale Zahlungsbereitschaft des Haushalts läge über dem Nachfragepreis. Wenn dies so wäre, so wäre es nicht zu erklären, dass der Haushalt schon bei einem geringfügigen Anstieg des Preises von x über den zur Menge gehörenden Nachfragepreis, , reagiert, indem er auf den Kauf der letzten Einheit verzichtet. Dies tut er aber, wie in der Abbildung 1 aus der Bewegung vom Punkt P1 zum Punkt P2 ersichtlich ist. Die marginale Zahlungsbereitschaft kann daher nicht über dem Nachfragepreis liegen.
Da wir festgestellt haben, dass die marginale Zahlungsbereitschaft eines Haushalts weder unter noch über dem Nachfragepreis liegen kann, müssen wir schließen, dass marginale Zahlungsbereitschaft und Nachfragepreis ein und dasselbe sind. Wir können also die marginale Zahlungsbereitschaft eines Haushalts an der Nachfragekurve ablesen.
Aus dieser Erörterung folgt eine wichtige Eigenschaft des in Abbildung 1 skizzierten Konkurrenzgleichgewichts: Im Konkurrenzgleichgewicht wird der Konflikt zwischen den beiden Nachfragern k und l um das Gut x durch die Institution des Marktes so ausgetragen, dass eine Aufteilung der insgesamt produzierten Menge x* auf die Interessenten herbeigeführt wird, bei der die marginalen Zahlungsbereitschaften der beiden Individuen gleich dem Marktpreis sind. Da der Marktpreis (im hier unterstellten Konkurrenzmodell) für alle Konsumenten gleich ist, sind die marginalen Zahlungsbereitschaften der verschiedenen Nachfrager im Gleichgewicht auch untereinander gleich.
Ähnlich wie oben für die Nachfrageseite recht ausführlich geschehen, lässt sich für die Angebotsseite argumentieren. Hier konkurrieren die beiden Firmen i und j um Produktionsfaktoren, die zur Produktion des Gutes x notwendig sind.22 Jede Firma bekommt über den Markt die Menge an Produktionsfaktoren »zugewiesen«, die sie in die Lage versetzt, eine Endproduktmenge herzustellen, für die der Preis gleich den individuellen Grenzkosten ist. Da der Preis im Modell vollständiger Konkurrenz für alle Anbieter identisch ist, sind im Gleichgewicht auch die Grenzkosten der Anbieter einander gleich. Im Konkurrenzgleichgewicht ist also sowohl auf der Nachfrage- als auch auf der Angebotsseite die »Grenzausgleichsbedingung«23 erfüllt.