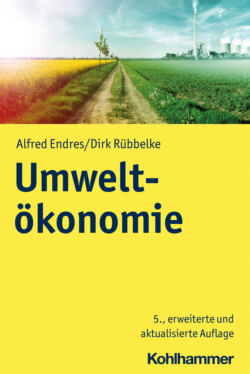Читать книгу Umweltökonomie - Dirk Rübbelke - Страница 16
IV. Konsequenzen
ОглавлениеBetrachten wir die Konsequenzen des Gesagten für die Internalisierung als Leitbild der Umweltpolitik. Die Internalisierung dient dem Ziel, eine optimale Allokation von Ressourcen herzustellen. Insbesondere soll die Unfähigkeit des unkorrigierten Marktmechanismus, optimale Umweltqualitätsniveaus hervorzubringen, korrigiert werden. Entgegen weit verbreiteter Literaturmeinung ist das anzustrebende Optimum aber kein »naturgesetzlich« zu definierender Zustand mit unveränderlichen Eigenschaften. Es handelt sich vielmehr um ein schillerndes Konzept. So ist die Lage eines optimalen Emissionsniveaus von vielerlei Einflussgrößen abhängig.
Aus dem oben Gesagten folgt, dass z. B.
a) die Präferenzen der von den Emissionen Betroffenen,
b) die Präferenzen der Konsumentinnen und Konsumenten für Güter, bei deren Herstellung die Emissionen entstehen,
c) der Wert, den Produktionsfaktoren, die zur Emissionsreduktion eingesetzt werden können, in anderen Verwendungen haben,
d) der jeweils geltende Stand der Technik
wichtige Determinanten des Optimums sein können. Entsprechend kann sich die Lage des Optimums mit jeder Änderung der Determinanten verschieben.
Abb. 3
Abbildung 3 zeigt, wie das durch den Schnittpunkt der Kurven GS1 und GVK1 charakterisierte optimale Emissionsniveau von fällt, wenn – z. B. infolge umwelttechnischen Fortschritts – die GVK-Kurve von GVK1 auf GVK2 sinkt.59 Steigt zusätzlich die Grenzschadenskurve von GS1 auf GS2, z. B. weil das Realeinkommen der betroffenen Individuen gestiegen ist (und die Abwesenheit des entsprechenden Schadstoffes ein superiores Gut ist), so wandert das optimale Emissionsniveau weiter zurück auf . Natürlich sind auch Bewegungen in die entgegengesetzte Richtung denkbar. So mag ein besonders aufrüttelnder Bericht über den neuen »Schadstoff des Monats«, y, den in der Abbildung repräsentierten Schadstoff, x, im öffentlichen Bewusstsein in den Hintergrund drängen und die Zahlungsbereitschaft für seine Abwesenheit senken. Entsprechend sinkt die Grenzschadenskurve ab. Damit erhöht sich der optimale Emissionswert. Eine Erhöhung des optimalen Emissionswertes könnte ebenso durch einen Anstieg der GVK-Kurve verursacht werden. Dieser könnte z. B. auf eine Verteuerung eines Produktionsfaktors zurückzuführen sein, der für die x-vermeidende Technik wesentlich ist. Diese Verteuerung kann ohne weiteres völlig unabhängig von der auf den Schadstoff x gerichteten Umweltpolitik sein. Sie könnte z. B. darauf zurückzuführen sein, dass die Nachfrage nach einem Produkt außerhalb des umwelttechnischen Sektors, in dem derselbe Produktionsfaktor benötigt wird, steigt.
Anhand dieser wenigen Beispiele wird deutlich, dass das optimale Emissionsniveau (die optimale Umweltpolitik) keine für Wirtschaft und Gesellschaft exogene Größe ist, sondern selbst endogen durch die Interaktion ungezählter Einflussgrößen in einem hoch komplexen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Prozess definiert ist. Mit der Internalisierung externer Effekte wird also ein äußerst bewegliches Ziel angesteuert.60
Weiter komplizierend kommt hinzu, dass wichtige der eben genannten Einflussgrößen sich nicht nur unabhängig von der Umweltpolitik ändern und diese also auf exogene Einflüsse reagieren muss, sondern selber von der Umweltpolitik beeinflusst werden. So verändert die Umweltpolitik zweifellos die für die Lage des Emissionsoptimums einflussreiche Einkommensverteilung.61 Außerdem ist die Wahl umweltpolitischer Strategien entscheidend für Ausmaß und Richtung des umwelttechnischen Fortschritts, der seinerseits, wie oben erläutert, die Lage des Optimums mitbestimmt.62 Schließlich wirkt das für die Lage der GS-Kurve (und damit des Emissionsoptimums) bedeutende Umweltbewusstsein der Bevölkerung nicht nur auf Intensität und Qualität der Umweltpolitik ein, sondern wird seinerseits von dieser beeinflusst.
Neben diesen grundsätzlichen Problemen ist darauf hinzuweisen, dass Optimalität im beschriebenen Sinne nur erreicht werden kann, wenn alle Kosten und Nutzen, die mit der betrachteten Emissionsreduktion verbunden sind, vollständig und korrekt erfasst werden. Dies bedeutet z. B., dass sämtliche von der Emission verursachten Schadensarten (z. B. Material- und Gebäudeschäden, ästhetische Einbußen oder Gesundheitsschäden) bei allen Betroffenen, ganz gleich, in welcher Entfernung von der Emissionsquelle sie leben, erfasst werden müssen. Die Forderung erstreckt sich auch auf erst in der Zukunft betroffene Individuen. Ebenso müssen natürlich auch die Kosten der Emissionsreduktion vollständig erfasst werden. Insbesondere müssen sie zu den Werten angesetzt werden, die ein idealtypischer Marktmechanismus ansetzen würde. Diese »Schattenpreise« der zur Emissionsreduktion verwendeten Opportunitätskosten unterscheiden sich durchaus von den tatsächlich gezahlten (z. B. von Marktmacht oder staatlicher Intervention verzerrten) Preisen.63 Es gibt zwar eine Reihe von Ansätzen zur Lösung all dieser Probleme, die Schwierigkeiten sind jedoch beträchtlich.