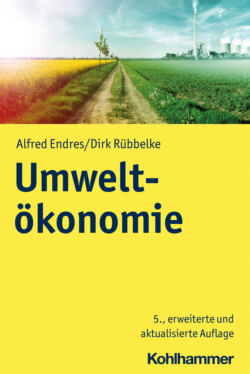Читать книгу Umweltökonomie - Dirk Rübbelke - Страница 17
V. Dennoch: Die Internalisierung externer Effekte als unverzichtbarer Bestandteil umweltpolitischer Vision
ОглавлениеDie oben beschriebenen schwerwiegenden konzeptionellen und praktischen Probleme einer Internalisierung externer Effekte dürfen unseres Erachtens keinesfalls dazu führen, diesen Ansatz als umweltpolitisch unbrauchbar zurückzuweisen. Häufig wird gemeint, statt des »ökonomischen« Internalisierungsansatzes müsse sich die Umweltpolitik an außerökonomischen Kriterien orientieren. Dabei wird jedoch übersehen, dass die oben skizzierten Schwierigkeiten, mit denen die Internalisierung zu kämpfen hat, zweifellos auch bei anderen umweltpolitischen Konzepten auftauchen. So muss jede demokratisch legitimierte Umweltpolitik, heiße sie nun »ökonomisch« oder nicht, damit leben, dass die Menschen unvollkommen informiert sind und ihre Ansichten über die Werte knapper Güter (Umweltgüter und marktfähige Güter) einem ständigen Wandel unterliegen.
Es ist auch unsinnig, dem »ökonomischen Ansatz« in der Umweltpolitik den »offenen gesellschaftlichen Diskurs« über umweltpolitische Ziele als Alternative entgegenzustellen, wie dies in der Fachdiskussion gelegentlich geschieht. Ein offener umweltpolitischer Diskurs verbessert auch die Erfolgsbedingungen für den Einsatz ökonomischer umweltpolitischer Strategien. Je besser informiert und je kritikfähiger64 die einzelnen Entscheidungsträger sind, desto besser funktioniert die auf der Grundlage der Autonomie des Individuums beruhende ökonomisch angelegte Politik.
Letztlich sind die Probleme des Optimalitätsbegriffs der Ökonomie auf die Schwierigkeit zurückzuführen, in einer hoch entwickelten pluralistischen Gesellschaft Ziele zu formulieren, die für die Gesellschaft als Ganzes gelten sollen. Schließlich besteht eine derartige Gesellschaft aus vielen Millionen Mitgliedern, die jedes Einzelne für sich schon unter Zielkonflikten leiden und erst recht untereinander vieldimensionale Interessengegensätze aufweisen und darüber hinaus in einem nicht mehr überschaubaren Geflecht von Interdependenzen miteinander verbunden und voneinander abhängig sind. Es ist unumgänglich, dass ein für eine komplexe inhomogene Gesellschaft geltender Zielbegriff prinzipiell problembeladen, praktisch schwer operationalisierbar und im Zeitablauf dem Wandel unterworfen ist. Darunter leiden »ökonomische« Denkansätze ebenso wie »außerökonomische«. Das in der Ökonomie entwickelte Ziel der Optimalität der Ressourcenallokation ist in Anbetracht der herkulischen Natur der Aufgabe einer gesellschaftlichen Zielformulierung durchaus präsentabel.
Überdies darf nicht vergessen werden, dass die Politikalternative nicht darin besteht, das Ziel ökonomischer Optimalität entweder, koste es, was es wolle, zu verfolgen, oder es zu missachten. Vielmehr sind pragmatische, d. h. theoretisch unvollkommene, aber praktisch handhabbare Formulierungen des Ziels möglich. Beispiele bieten die Bewertungsverfahren der Nutzen-Kosten-Analyse.65
Außerdem muss neben dem hier bisher gewürdigten Zielelement der Internalisierung auch ihr Instrumentencharakter in die Bewertung einbezogen werden. Das Ziel der Optimalität der Ressourcenallokation wird bei der Internalisierung dadurch angestrebt, dass dem Verursacher externer Kosten diese angelastet werden. Selbst wenn die Höhe der externen Kosten nicht genau festgestellt werden kann, die Verursacher nicht sämtlich ermittelt werden können und die Anlastung der ermittelten externen Kosten bei den ermittelten Verursachern nur unvollkommen möglich ist, kann es dennoch gelingen, starke marktanaloge Kräfte in den Dienst des Umweltschutzes zu stellen. Im Dritten Teil dieses Buches wird dargelegt werden, dass der Einsatz umweltpolitischer Instrumente, die streng genommen keine Internalisierung externer Effekte erreichen, aber doch von diesem Grundgedanken abgeleitet sind, anderen Instrumenten bezüglich ihrer Effizienz und ihrer Fähigkeit, den umweltfreundlichen Erfindergeist anzuregen, überlegen sind. Vielleicht sollte man die umweltpolitische Bedeutung von Internalisierungsstrategien weniger daran messen, ob sie in der Tat geeignet sind, »Optimalität« herzustellen, sondern vielmehr den praktischen Beitrag der aus ihnen entwickelten umweltpolitischen Instrumente in den Vordergrund der Beurteilung stellen.
Im anschließenden Zweiten Teil werden die wichtigsten Internalisierungsstrategien vorgestellt und gewürdigt. Dabei gehen wir stets davon aus, dass die jeweils in Rede stehende Strategie allein zur Internalisierung des externen Effekts eingesetzt wird. Der simultane Einsatz verschiedener Strategien und/oder die Interaktionen einer Strategie mit anderen umweltpolitischen Regulierungen sind nicht Gegenstand der folgenden Erörterung.
Bei der folgenden Darstellung der Internalisierungsstrategien (und dort, wo nichts anderes gesagt wird, auch in allen anderen Teilen dieses Buches) werden wir zur Vereinfachung davon ausgehen, dass der Umweltschaden von der Menge der verursachten Emissionen eines bestimmten Schadstoffs abhängt. Damit folgen wir der in der vorstehenden Erörterung und (bei weitem überwiegend auch) in der gesamten einschlägigen Lehrbuchliteratur geltenden Konvention. In Wirklichkeit wird der Schaden jedoch auch davon abhängen, an welchem Ort die betrachtete Emission verursacht wird. Eine Berücksichtigung geografischer Gegebenheiten bei der Umweltpolitik kann zu erheblichen Effizienzgewinnen führen. Auf die Modellierung dieses Aspekts wird jedoch im Folgenden verzichtet, um den einführenden Charakter der Darstellung nicht zu sprengen. Näheres z. B. bei Antweiler (2017), Fowlie/Muller (2019), Fraas/Lutter (2012), Krysiak/Schweitzer (2010) und Muller/Mendelsohn (2012).
3 Vgl. Becker (1993) sowie z. B. Coyle (2010), Homann/Suchanek (2005), Kirchgässner (2008). Gary Becker wurde im Jahre 1992 für seine Beiträge zur Weiterentwicklung der Ökonomie zu einer allgemeinen Theorie des menschlichen Verhaltens mit dem Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaft ausgezeichnet.
4 Die Nutzung der Luft als Aufnahmemedium für Schadstoffe schränkt die Möglichkeit ein, die Luft in einer für die Atmung günstigen Qualität zu nutzen. Dagegen schränkt das Atmen nicht die Emissionsmöglichkeit ein. Diese Aussagen dürfen natürlich nicht mit der Behauptung verwechselt werden, ein den Anwohnern verliehenes Recht auf das Atmen sauberer Luft schränke die Aktionsmöglichkeiten der Emittenten nicht ein. Mit der Zuweisung eines solchen Rechts wäre jedoch der Rahmen des Allokationsmechanismus »Gesetz des Dschungels« gesprengt. Wenn im Text behauptet wird, unter diesem Gesetz setze sich die Nutzungsabsicht der Verursacher des externen Effektes durch, so wird von der Möglichkeit abgesehen, dass die Geschädigten die Emissionen gewaltsam verhindern.
5 Vgl. Kap. A. des Zweiten Teils, unten.
6 Vgl. Kap. B.III des Dritten Teils, unten.
7 Die Formulierung »Anlass, … nachzudenken« ist bewusst vorsichtig gewählt: Daraus, dass der Markt einen optimalen Zustand nicht herstellen kann, folgt keineswegs, dass ein anderer Allokationsmechanismus dazu in der Lage wäre.
8 Manche freilich finden auch die ökonomische Modelltheorie ermüdend und fruchtlos.
9 Diese werden bisweilen in einzelnen »Fallstudien« unter Anwendung der allgemeinen Theorie einbezogen.
10 Mit diesen Bemerkungen soll auch der weit verbreiteten Meinung entgegengewirkt werden, Ökonomen seien naturgemäß herzlose Verstandesmenschen, denen (eben deshalb!) wesentlicher Einfluss bei der Beantwortung zentraler Lebensfragen der menschlichen Gesellschaft auf keinen Fall eingeräumt werden dürfe. Richtig ist vielmehr, dass einen guten Ökonomen neben einem scharfen Intellekt auch eine hohe Sensibilität auszeichnet. Wer dies für einen Widerspruch hält, sei wie folgt gewarnt: Im Japanischen wird für »Gefühl« und »Verstand« ein und dasselbe Kanji-Zeichen verwendet. (Gefunden bei Todd Shimoda, Ewiger Mond, Berlin, (List Verlag), 2006, S. 74.)
11 Das Ergebnis des terminologischen Substitutionsprozesses (Ökonomen lieben Fremdwörter!) kann sich sehen lassen: Da haben wir schon schlechtere Modelldefinitionen gelesen. Themenvorschlag für das abendliche Kamingespräch (kann auch ein Blog sein): Warum weisen Romane und ökonomische Modelle Gemeinsamkeiten auf? Wo endet die Analogie?
12 Das Portefeuille mikroökonomischer Lehrbücher ist sehr umfangreich und vielfältig. Da müsste eigentlich für (fast) jeden Geschmack etwas zu finden sein. Vgl. z. B. Breyer (2020), Herdzina/Seiter (2015), Kolmar (2017), Sturm/Vogt (2014), Varian (2016), Von Böventer/Illing (2018). Ein am Firmament der Ökonomie-Lehrbücher besonders hell und klar strahlender Stern ist Endres/Radke (2018). Hier werden die Grundzüge der Mikro- (und Makro-)ökonomie mit besonderem Blick auf das aufbereitet, was in der Umweltökonomie gebraucht wird.
13 »Gleichgewicht« von L.J.C. Shimoda gefunden bei Todd Shimoda, Ewiger Mond, Berlin (List Verlag) 2006, S. 164. Der Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung der Künstlerin.
14 Auch die Qualität ist natürlich eigentlich nicht vorgegeben, sondern endogen zu bestimmen. Aus Vereinfachungsgründen verzichten wir jedoch hier auf die Darstellung dieses Aspekts. Modelle, in denen Firmen die Qualität ihrer Produkte festlegen, finden sich z. B. in Antoniades (2015), Bekkers (2016), Feenstra/Romalis (2014).
15 Das Wesentliche der Marktform der vollständigen Konkurrenz besteht darin, dass kein einzelner Anbieter oder Nachfrager den Marktpreis beeinflussen kann.
16 Die Beschränkung auf jeweils zwei Akteure erfolgt lediglich, um die nachstehende grafische Darstellung so einfach wie möglich zu halten. Die Allgemeinheit der Aussagen wird dadurch nicht berührt. Deshalb ist auch der mögliche Einwand, die hier angenommene Marktform der vollständigen Konkurrenz sei mit der Annahme einer so geringen Zahl von Marktteilnehmern nicht kompatibel, in diesem Zusammenhang uninteressant.
17 Die Grenzkostenkurven müssen nicht monoton (und schon gar nicht linear) mit der produzierten Menge ansteigen, wie in der Abbildung eingetragen, sondern können auch einen anderen (z. B. u-förmigen Verlauf) annehmen. Auch monoton fallende Grenzkostenverläufe sind natürlich denkbar, sprengen jedoch das hier zugrunde gelegte Modell der vollständigen Konkurrenz. (Vgl. die Passagen zum natürlichen Monopol, z. B. bei Fritsch (2018), Kerber (2019), Schmidt (2019), Weimann (2009)).
18 Genauer gesagt, entspricht die Angebotskurve der Grenzkostenkurve in deren steigendem Teil vom Minimum der (in der Abbildung nicht eingetragenen) Durchschnittskostenkurve an. Diese relativierende Aussage ist bei u-förmigen Grenzkostenverläufen besonders wichtig. Für eine genauere Analyse wäre in diesem Kontext die Unterscheidung zwischen einer langfristigen und einer kurzfristigen Kostenkurve bedeutend. Im Erörterungskontext können wir jedoch auf diese Differenzierung verzichten und uns mit einem Verweis auf die einschlägigen mikroökonomischen Lehrbücher begnügen.
19 Die Autoren freuen sich darüber und sind auch ein wenig stolz darauf, mit diesen Zeilen einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, »das kapitalistische Rätsel schlechthin … das der Preisbildung« zu lösen. Zitat: Michel Houellebecq, Karte und Gebiet, deutsche Ausgabe, Köln (DuMont), 2012, S. 98.
20 Die hier angesprochene Bereitschaft, für eine geringe zusätzliche Ausstattung mit einem Gut Geld auszugeben, wird als »marginale Zahlungsbereitschaft« bezeichnet.
21 Der Leser/ Die Leserin ahnt schon, dass hier die Technik des »Beweises durch Widerspruch« zum Einsatz kommt.
22 Für eine ausführliche Darstellung dieses Konflikts wäre die explizite Einbeziehung von Faktormärkten in die Betrachtung notwendig. Wegen der Analogie zu dem eben für den Konflikt zwischen den Haushalten auf dem Gütermarkt Gesagten unterbleibt diese Erörterung hier jedoch aus Platzgründen.
23 Mit diesem Term wird der von Hartwick und Olewiler (1998) geprägte Begriff der Equimarginal Condition (S. 200) eingedeutscht.
24 Siehe dazu auch Endres/Radke (2018).
25 Die hier gemeinten Probleme werden in der wohlfahrtsökonomischen Literatur unter den Stichwörtern Soziale Wohlfahrtskriterien (Pareto-Kriterium, Kaldor-Hicks-Kriterium, Scitovsky-Kriterium) und Soziale Wohlfahrtsfunktion (Arrow-Theorem, Black’sches Theorem) behandelt. Vgl. Sohmen (1976). Dieses Buch ist nun wirklich eine echte Antiquität. Es lotet aber die Untiefen der Wohlfahrtsökonomie so gründlich aus, dass es im Erörterungszusammenhang noch heute lesenswert ist. Neuer (und auch schön): Feldman/Serrano (2006), McCain (2019).
26 In der angewandten Wohlfahrtstheorie (insbesondere im Bereich der Nutzen-Kosten-Analyse) wird der Willingness to pay (Zahlungsbereitschaft) die Willingness to accept (Kompensationsforderung) gegenübergestellt. Häufig werden auch die Begriffe Compensating Variation und Equivalent Variation verwendet. Eine ausführliche Darstellung beider Konzepte findet sich z. B. in Buchholz/Rübbelke (2019). Die Unterscheidung zwischen Kompensationsforderung und Zahlungsbereitschaft wird bei der Diskussion von Verhandlungen als Internalisierungsstrategie (Kap. A. des Zweiten Teils dieses Buches) noch eine wesentliche Rolle spielen.
27 Die Identität von sozial optimaler und marktgleichgewichtiger Allokation sowie die Einfachheit ihrer Demonstration über die Erfüllung der »Grenzausgleichsbedingungen« leben davon, dass wir monoton fallende marginale Zahlungsbereitschaften und (zumindest in der Nähe der Lösung) monoton steigende Grenzkosten unterstellt haben. Beide Annahmen gehören zur Folklore der Volkswirtschaftslehre. Zu Abweichungen und ihren Konsequenzen für die Optimalität von Marktgleichgewichten vgl. z. B. Fritsch (2018).
28 Mit dem Ausdruck ( − ε) ist der in der Grafik eingetragene Punkt − ε, 0) gemeint. Diese abgekürzte Schreibweise wird bei der Erläuterung aller Grafiken analog verwendet.
29 Wegen seiner Komplexität wird das Gebiet der allgemeinen Gleichgewichtstheorie in einführenden mikroökonomischen Lehrbüchern meist nicht behandelt. Endres/Martiensen (2007) sind (dem bekannten Einstein’schen Motto verpflichtet) um eine Darstellung bemüht, die die Theorie so einfach wie möglich abbildet, aber nicht einfacher! In der umweltökonomischen Forschung kommt der Verwendung von rechenbaren allgemeinen Gleichgewichtsmodellen (computable general equilibrium models) erhebliche Bedeutung zu, vgl. z. B. Böhringer/Carbone/Rutherford (2018), Duscha/Peterson/Schleich/Schumacher (2019), Schenker/Stephan (2017).
30 In Abschnitt II. des folgenden Kapitels B. begeben wir uns erneut in das Spannungsfeld zwischen Kardinalität und Ordinalität des mikroökonomischen Nutzenkonzepts.
31 Lebenserfahrene Leserinnen und Leser wissen, dass der Globus des menschlichen Lebens aus zwei Zonen besteht. In der einen (klein!) gilt das Motto »The best things in life are free.« In der anderen (groß!) heißt es dagegen »There ain’t no such thing as a free lunch.« Offensichtlich gehört die ökonomische Modellbildung in die zweite Zone. Das sollte uns auch nicht weiter wundern, denn - so schön sie zweifellos auch ist - zu den besten Dingen des Lebens zählt sie wohl doch nicht.
32 Heißer Tipp: Endres/Martiensen (2007), S. 673-675.
33 Als »Lemons« werden in den USA Produkte (insbesondere Gebrauchtwagen) schlechter Qualität bezeichnet.
34 Quelle: Steinmann/Westfalenpost. Der Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Urhebers.
35 Natürlich können verschiedene Abweichungen zwischen einfachem Modell und Realität interagieren. Dem Rechnung zu tragen, ist für die Analyse wichtig, kompliziert sie aber erheblich. Die Konsequenzen eines simultanen Auftretens von externen Effekten und Marktmacht werden in Kapitel C. des Vierten Teils behandelt. Ein Beispiel für die Internalisierung externer Effekte bei asymmetrischer Information wird in Abschnitt B.IV. des Zweiten Teils im Kontext von Umwelthaftungsversicherungen erörtert. Eine ähnliche Interaktion wird in Kapitel D. des Vierten Teils behandelt. Dort geht es um Internalisierungsverhandlungen bei asymmetrischer Information.
36 Wenn nichts anderes gesagt wird, unterstellen wir im Folgenden, dass sich das Emissionsniveau strikt proportional zum Produktionsniveau verhalte. Da wir die Messeinheit der Emissionen so normieren können, dass der Proportionalitätsfaktor den Wert 1 annimmt, verwenden wir für Output und Emission ein und dasselbe Symbol, x. Weiter unten (im Dritten Teil und in Kapitel B. des Vierten Teils) wird es jedoch bisweilen gerade darauf ankommen, dass Output und Emission nicht in einer festen Koppelbeziehung zueinander stehen. Dies ist besonders wichtig, wenn die Anreize für den Verursacher erörtert werden, Vermeidungstechnologien einzusetzen oder Inputsubstitutionen vorzunehmen. In diesen Zusammenhängen wird dann für Emissionen das Symbol »E« eingeführt, für den Output das Symbol »x« beibehalten.
37 Dass externe Effekte monetär bewertet werden können, ist alles andere als trivial. Zu den konzeptionellen, methodischen und empirischen Aspekten der Monetarisierung gibt es reichlich Literatur. Vgl. z. B. Bartczak/Chilton/Czajkowski/Meyerhoff (2017), Bartkowski/Lienhoop/Hansjürgens (2015), Bento/Roth/Waxman (2020), Braun/Rehdanz/Schmidt (2016), Hampicke (2020) und Stephan/Ahlheim (2013).
38 Die Beschränkung auf einen Haushalt erfolgt wieder ohne Beeinträchtigung der Allgemeinheit der Aussage.
39 Eine Aufhebung dieser Annahme kompliziert die Argumentation, ohne den Gehalt der Aussage wesentlich zu verändern. Wir behalten die Annahme daher (zunächst) bei.
40 Stellen wir uns die Aggregation der Kurve über eine große Anzahl von Firmen vor, so weist die Kurve (so gut wie) keinen Knick auf.
41 Die Grenzschadenskurve ist monoton steigend eingezeichnet. Auf die Konsequenzen, die sich aus Abweichungen von dieser Annahme ergeben, kann hier aus Platzgründen nicht eingegangen werden. Vgl. z. B. Burrows (1995), Perman et al. (2011), Ch. 5.11.
42 Der von der Emission verursachte externe Effekt ist gerade dann internalisiert, wenn das optimale Niveau der Emission (über eine Anlastung der externen Kosten) erreicht wird.
43 Die optimale Emissionsmenge wurde hier mit Hilfe von Marginalgrößen (über die Erfüllung einer »Grenzausgleichsbedingung«) charakterisiert. Gleichwertig wäre die Darstellung in Totalgrößen: Die optimale Emissionsmenge liegt dort, wo die Summe aus totalen Vermeidungskosten und totalen Schäden minimal ist. Dass es bei alternativen Funktionsverläufen auch Optima gibt, die die im Text erklärten Marginalbedingungen nicht erfüllen, soll hier der Vollständigkeit halber zwar erwähnt, aus Platzgründen aber nicht näher erörtert werden.
44 Die Theorie des Marktversagens nimmt in der modernen wirtschaftswissenschaftlichen Literatur einen breiten Raum ein. Neben den im Erörterungszusammenhang dieses Buches zentralen externen Effekten werden dort auch Marktmacht, asymmetrische Information, Netzwerkeffekte und andere Gründe für Marktversagen ausführlich erörtert. Vgl. den äußerst informativen Überblick bei Fritsch (2018). Eine stärker wirtschaftstheoretisch orientierte ausführliche Darstellung verschiedener Formen des Marktversagens und der in der Literatur vorgetragenen Lösungsansätze bieten Endres/Martiensen (2007), Teil 6 sowie Bernheim/Whinston (2013). Speziell zu den Netzwerkeffekten vgl. Varian/Farrell/Shapiro (2004). Furton/Martin (2019) beschreiben Fälle sowohl von Markt- als auch von Staatsversagen.
45 Vgl. Abbildung 1, in der gilt: p* = GK(x*) = MZB(x*).
46 Diese Aussage ist natürlich nicht mit der Erwartung zu verwechseln, die Begeisterung »der Wirtschaft« über den Einsatz von Instrumenten zur Internalisierung externer Effekte sei groß. Die Einstellungen von Interessengruppen zur Umweltpolitik in ihren verschiedenen Ausprägungen untersucht die Neue Politische Ökonomie. Vgl. z. B. Buchholz/Peters/Ufert (2014), Gawel/Lehmann/Strunz/Heuson (2018), Kemfert (2017), Kombat/Wätzold (2019), Potrafke (2018), Tol (2017).
47 Natürlich gibt es eine Reihe von Methoden, den Verursacher externer Effekte zur Verhaltenskorrektur zu bewegen, die nicht im obigen strengen Sinne »Internalisierungsmaßnahmen« darstellen. Diese Maßnahmen einer »Internalisierung im weiteren Sinn« reichen vom Druck der öffentlichen Meinung bis hin zu staatlichen Ge- und Verboten. Zur ökonomischen Analyse umweltpolitischer Instrumente, die im engen Sinne keine Internalisierungsstrategien darstellen, vgl. den Dritten Teil, unten.
48 Zur Ökonomie intrinsischer Motivation und der Gefahr ihrer Verdrängung durch extrinsische Anreize, vgl. z. B. Chao (2017), Festré/Garrouste (2015), Goeschl/Perino (2012), Kits/Adamowicz/Boxall (2014), Rommel/Buttmann/Liebig/Schönwetter/Svart-Gröger (2015). Weitere Ausführungen hierzu finden sich im Vierten Teil dieses Buches, in dem die Verhaltensökonomik behandelt wird.
49 Jetzt aber mal im Ernst: Interdependente Nutzenfunktionen sind in der traditionellen Wirtschaftstheorie zwar Sidestream, aber doch unübersehbar. Es gibt eine Fülle von Ansätzen, z. B. Becker (1974), Bergstrom (2006) und Mercier Ythier (2010). Zum Verzicht auf Engstirnigkeit bei der Interpretation der Figur des Homo Oeconomicus vgl. z. B. Kirchgässner (2008), Endres/Martiensen (2007), Teil I. Einen Blick auf die Herausforderungen in diesem Kontext aufseiten der Verhaltensökonomik werfen bspw. Kesternich/Reif/Rübbelke (2017).
50 Quelle: Steinmann/Westfalenpost. Der Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Urhebers.
51 Allerdings ist die Wirtschaftstheorie ein so weites (und »biologisch« äußerst dynamisches) Feld, dass stets der Satz gilt: »Es gibt nichts, was es nicht gibt.« Zur ökonomischen Theorie endogener (also gerade nicht als gegeben vorausgesetzter) Präferenzen vgl. z. B. Chesterley (2016) und v. Weizsäcker (2002, 2014) zur Unterscheidung zwischen exogenen Präferenzen und endogenem Geschmack.
52 Dass man dies auch völlig anders sehen kann (muss?!?), erhellt schlaglichtartig der Untertitel von Frey/Benz/Stutzer (2004): »Not only What, but also How Matters.« Vgl. auch Chlaß/Güth/Miettinen (2019) und Stutzer (2020).
53 Vgl. Selten (1990). Nobelpreisträger Kahneman beschreibt seine (gemeinsamen) Forschungen (mit Amos Tversky) als die Suche nach einer Karte für begrenzte Rationalität. Siehe Kahneman (2003).
54 Vgl. z. B. die einführende Darstellung bei Varian (2016).
55 Diese Unterscheidung wird unten, insbesondere bei der Diskussion von Verhandlungen als Internalisierungsstrategie, noch eine wesentliche Rolle spielen.
56 Ein Zuruf aus der (gar nicht allzu) fernen Wirtschaftspraxis: »Der Wert von Kunst ermisst sich letztlich an dem, was ein bestimmter Mensch bereit ist, dafür zu bezahlen« – so der New Yorker Kunstexperte und -händler Michael Findlay in Die Zeit, Nr. 16 vom 12.04.2012, S. 57.
57 Die ökonomischen Prinzipien der Bewertung von Umweltgütern mit Hilfe des Zahlungsbereitschaftskonzepts und die zugehörigen Methoden der empirischen Sozialforschung werden in diesem Buch aus Platzgründen nicht näher erörtert. Ein Überblick findet sich z. B. in der in Fußnote 37, oben, angegebenen Literatur.
58 Um die hier zu Grunde liegenden Konzepte des Utilitarismus und des normativen Individualismus hat es in der Literatur reichlich Streit gegeben. Ein Beispiel hierfür ist die Kritik von Binmore (2005), die aber ihrerseits auf Widerspruch gestoßen ist, siehe z. B. Gintis (2006).
59 Für das Verständnis von mit technischem Fortschritt sinkenden Vermeidungskosten empfiehlt es sich, von der vereinfachenden Vorstellung abzugehen, die Emissionen seien strikt proportional zum Output. Wir stellen uns stattdessen vor, die Emissionen könnten (zusätzlich zum Mittel der Outputreduktion) durch Maßnahmen des technischen Umweltschutzes gesenkt werden. Diese können additiv (z. B. Filterinstallation (dann aber auch: einschalten!)) oder integriert (z. B. Erhöhung des Verbrennungsgrades) ausgerichtet sein.
60 Die obige Darstellung sei durch den Hinweis entdramatisiert, dass auch aus ökonomischer Sicht nicht jede Änderung des Optimums automatisch eine Anpassung der nach Internalisierung strebenden Umweltpolitik nötig macht. Hier müssen den Nutzen des Politikwechsels die Politikkosten (im weitesten Sinne) gegenübergestellt werden. Es wäre interessant zu untersuchen, inwieweit sich die Kosten des Politikwechsels bei verschiedenen Internalisierungsstrategien unterscheiden.
61 Die Zusammenhänge zwischen Verteilung und Lage des Allokationsoptimums werden im Zweiten Teil, Kapitel A.II.1 ausführlich erläutert.
62 Auf diesen Zusammenhang gehen wir unten in Abschnitt C.II., des Dritten Teils ausführlicher (und in Kapitel E. des Vierten Teils noch ausführlicher) ein.
63 Näheres zum Konzept der Schattenpreise und seiner Bedeutung für die Nutzen-Kosten-Analyse im Umweltschutz z. B. bei Young (2005), Molinos-Senante/Hanley/Hernández-Sancho/Sala-Garrido (2015).
64 Mit »Kritikfähigkeit« ist hier (anders als dies häufig in der umweltpolitischen Diskussion verstanden wird) nicht nur die Fähigkeit zur Kritik an »der Industrie« gemeint. Vielmehr geht es um die Fähigkeit zu erkennen, inwieweit in der Öffentlichkeit vorgetragene Argumente von Interessen geleitet sind. Dazu gehört das Interesse des Industrievertreters an der Verharmlosung der externen Kosten seiner Produktion ebenso wie das Interesse der Journalistin/des Journalisten (der Wissenschaftlerin/des Wissenschaftlers!) an Aufsehen erregender Berichterstattung oder das Interesse der Politikerin/des Politikers an der eigenen Profilierung.
65 Vgl. z. B. Atkinson/Mourato (2015), Feess/Seeliger (2021), Hansjürgens/Lienhoop (2015), Johansson/Kriström (2018) und Markandya (2016).