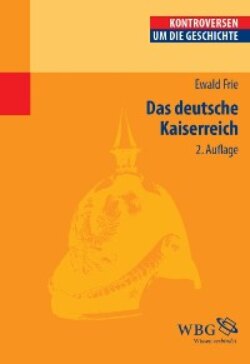Читать книгу Das deutsche Kaiserreich - Ewald Frie - Страница 11
3. Kaiserreichgeschichte nach Kriegsniederlage und Revolution
ОглавлениеWeimarer Republik
Die Debatte wurde eine im eigentlichen Sinne historische, als Kriegsniederlage, Revolution und Gründung der Weimarer Republik das Kaiserreich zu einer abgeschlossenen Epoche machten. Sie kam nicht mehr – wie bei Sybel und Treitschke – von ihrem Anfang her in den Blick. Auch ging es nicht mehr – wie bei Schäfer und Brandenburg – um aktuelle Gefährdung und zukünftige Aufgaben des Reiches. Gefragt wurde vielmehr vom Ende her. Wie hatte es zu Weltkrieg und Zusammenbruch kommen können? Wer trug die Verantwortung? Wie war das republikanische Gemeinwesen der Gegenwart im Vergleich zum untergegangenen Reich zu bewerten? Die Gesamtdarstellungen der 1920er-Jahre bewegten sich zwischen den Polen einer kritischen Distanzierung vom Kaiserreich, die häufig mit Hinnahme bzw. Befürwortung der Weimarer Republik zusammenhing, und bedingungsloser Verteidigung des Kaiserreiches, von dem sich dann die aus einer Revolution hervorgegangene Weimarer Republik schwächlich und verachtenswert abhob (16; 49). Personifizieren lassen sich die Pole, zwischen denen es viele vermittelnde Positionen gab, durch die Historiker Johannes Ziekursch und Adalbert Wahl.
Johannes Ziekursch
Ziekursch begann seine dreibändige „Politische Geschichte des neuen deutschen Kaiserreiches“ mit einem weiten geistesgeschichtlichen Rückgriff. Er sollte zeigen, dass die Ideen der Aufklärung mit ihren Kindern Liberalismus und Sozialismus das 19. und frühe 20. Jahrhundert beherrscht hatten. „Dem Geist der Zeit entgegen wurde die stolze Burg des neuen deutschen Kaiserreichs erbaut“, fuhr er fort, und brachte damit im protestantischen Leserkreis das lutherische Kirchenlied „Eine stolze Burg ist unser Gott“ zum Schwingen. Doch diese trotzige Tat Bismarcks habe das tragische Schicksal des Reiches bereits besiegelt. Politische Gegner kann man besiegen, die Zeit nicht. „An den unausgeglichenen Widersprüchen zwischen dem alten Preußen und dem neuen Deutschland, den unerfüllbaren Aufgaben, die dem Herrscher die Verfassung stellte, und der Leistungsfähigkeit |6|der Dynastie, zwischen der bevormundenden Verfassung und dem die Welt erfüllenden demokratischen Zeitgeist ist Bismarcks Reich, nur ein halbes Jahrhundert nach seiner Begründung, durch Blut und Eisen, dem es seinen Ursprung verdankte, in einem Heldenkampfe sondergleichen wieder zugrunde gegangen. Bismarcks Werk lehrt, was der politische Genius im Widerspruch mit seiner Zeit zu leisten vermag, aber auch, wie die Zeit den Stärksten überwindet.“ (73, Bd. 1, S. 3 u. 4)
Kaiserreich als Bollwerk gegen die Zeit
Eines der drei Bücher Ziekurschs befasste sich ausschließlich mit der Reichsgründung, damit die Tradition der Sybel und Treitschke noch einmal anrufend, das Kaiserreich vom Anfang her zu sehen. Doch indem er das Kaiserreich nicht mehr als Erfüllung der Zeit, sondern umgekehrt als Bollwerk gegen die Zeit beschrieb, baute er vom Anfang an eine Unheilsgeschichte, die Ziel und Zweck durch die Erklärung von Kriegsniederlage und Revolution erhielt. Nach Ziekursch hatte es wenige Möglichkeiten gegeben, die Katastrophe zu vermeiden. An einem der Krisenpunkte nach 1871 hätte das Ruder entschlossen herumgerissen werden müssen. So habe sich der junge Wilhelm II. durchaus im Recht befunden, als er Bismarck 1890 entließ. Aber er habe versäumt, „einen Bruch mit Bismarcks Staatsform“ zu vollziehen. Hätte er sein Schicksal mit dem des demokratischen Liberalismus verbunden, um Deutschland in Einklang mit dem Geist der Zeit zu bringen, hätte das Reich noch Bestand haben können. Doch „den Reichsgründer jetzt durch einen regelmäßige und anhaltende Arbeit scheuenden Vertreter des mystischen Glaubens an das Gottesgnadentum der Herrscher zu ersetzen, musste Deutschland zum Verhängnis ausschlagen.“ (73, Bd. 2, S. 447)
Reaktionen der Historiker
Ziekurschs Darstellung ist innerhalb der deutschen Historikerschaft auf wenig Gegenliebe gestoßen. Zu sehr widersprach sie den Vorstellungen einer akademischen Deutungselite, die größtenteils im Kaiserreich aufgewachsen war und dort Karriere gemacht hatte. Zwar räumte deren Mehrheit Unzulänglichkeiten Wilhelms II. ein. Aber erstens wurde dagegen Bismarck als positiver Gegenpart aufgebaut, was mit Ziekurschs Thesen unvereinbar war. Und zweitens hoffte Ziekursch, wie er am Ende des dritten Bandes – ironischerweise mittels eines Bismarck-Zitates – andeutete, auf einen neuen deutschen Aufstieg auf der Basis der Republik. In diesem Glauben wolle er die nachfolgende Generation erziehen (73, Bd. 3, S. 443). Ein solches Bekenntnis zur Weimarer Demokratie mochten die allermeisten deutschen Historiker Ende der 1920er-Jahre nicht ablegen.
Adalbert Wahl
Auf dem rechten Flügel exponierte sich seit 1926 Adalbert Wahl mit einer eigenen Gesamtdarstellung. Auch er begann mit einer geistesgeschichtlichen Einführung und stellte fest, dass das Kaiserreich dem seit der Französischen Revolution zur Herrschaft gekommenen liberalen und demokratischen Geist entgegenstand. Aber er hielt diesen Geist für eine Abirrung vom langfristigen menschlichen Entwicklungspfad und sah es daher als einen Ruhmestitel Preußen-Deutschlands im Allgemeinen und Bismarcks im Besonderen an, dass sie sich dieser Entwicklung entgegengestemmt hätten. Das Reich habe für nationale Eigenart und die Aufrechterhaltung ständischer Unterschiede, für konstitutionelle Verfassung und germanischen Föderalismus, für den Schutz der Arbeit und des Staates, für die Kräfte des Überlieferten, des Glaubens und des Gemüts gekämpft. Im |7|Reich sei zweifellos „ein Höhepunkt der Menschheitsgeschichte überhaupt zu sehen“ (66, Bd. 1, S. IX u. XI–XII). Weimar war Abstieg.
Historiker und das „Dritte Reich“
Während Ziekursch als Bezugspunkt einer kritischen Auseinandersetzung mit der Konstruktion des Reiches heute noch verwendet wird, ist Adalbert Wahl vergessen. Bereits während der 1920er-Jahre hatten seine grundsätzliche Verachtung für Demokratie und Liberalismus und seine unbedingte Hochschätzung des Kaiserreichs ihm die Kritik moderaterer Berufskollegen eingetragen. Heute hat sein Werk weniger wissenschaftlichen als wissenschaftsgeschichtlichen Wert. Weil die „Deutsche Geschichte“ erst 1936 vollendet wurde, als sich der Nationalsozialismus bereits etabliert hatte, zeigt es eine der Brücken an, über die vor allem national und konservativ gesonnene Historiker den Weg zur nationalsozialistischen Politik fanden. Die Machtergreifung wurde – vor allem in nationalprotestantischen Kreisen nicht ungewöhnlich – als Abkehr von der verhassten Demokratie begrüßt und als Rückkehr zum autoritären Machtstaat vor dem Ersten Weltkrieg begriffen. Die aggressive Außenpolitik galt als notwendig zur längst fälligen Revision des Versailler Vertrages. Dass der Nationalsozialismus etwas grundsätzlich anderes war als ein wiederbelebtes Kaiserreich, dämmerte vielen Historikern spät, zu spät. Manche merkten es gar nicht. Andere, vor allem Jüngere, unterstützten die nationalsozialistische Politik, eben weil sie keine Rückkehr zu der verknöcherten Welt des 19. Jahrhunderts wollten. Untergründig spielte sich in der Debatte um das Kaiserreich während der 1930er und frühen 1940er-Jahre ein Generationenkonflikt unter Historikern ab.
Dabei ging es wie ein halbes Jahrhundert zuvor um die Anfangsphase und um das Verhältnis von Kaiserreich und Nation. Das Reich von 1871 war ein kleindeutsches gewesen. Die Österreicher waren durch den Krieg von 1866 ausgeschlossen worden, von den deutschen Minderheiten in Mittel- und Osteuropa nicht zu reden. Wie ließ sich das mit dem Volkstumsgedanken vereinen, den die nationalsozialistische Propaganda von Anfang an hervorkehrte und der vor allem in außenpolitischen Krisen („Anschluss“ Österreichs, Sudentenkrise, Eroberung der Tschechoslowakei, Polen) eine immer größere Rolle spielte? Junge NS-Historiker kritisierten die Bismarcksche Reichsgründung als unvollendet und volkstumsfeindlich. Ältere, nationalkonservative Historiker, denen der Nationalsozialismus zunehmend fremd wurde, hoben dagegen den Realismus Bismarcks und seine Kunst der Beschränkung hervor. Linke und republikfreundliche Historiker, die schon während der 1920er-Jahre in der Minderheit gewesen waren, konnten sich seit 1933 nicht mehr frei äußern. Sie waren im Exil, hörten auf zu publizieren oder passten sich an.
Erich Marcks
Zwischen den beiden verbliebenen Lagern schlug Erich Marcks einen Mittelweg ein. „Der Aufstieg des Reiches. Deutsche Geschichte von 1807–1871/78“ (40) war das Produkt seiner lebenslangen Beschäftigung mit der deutschen Geschichte des 19. Jahrhunderts. Marcks persönliche Erinnerungen reichten noch bis in die Bismarckzeit zurück. Dennoch ließ er sich bereitwillig auf die NS-Geschichtsschreibung ein und versuchte den Brückenschlag zwischen – wie viele es Mitte der 1930er-Jahre sahen – guter deutscher geschichtswissenschaftlicher Tradition und der Herausforderung durch die moderne NS-Historiographie. Da ist zum einen eine geradezu |8|hymnische Bismarck-Verehrung: „Und die Geschichte der Reichsgründung erweitert sich oder verengt sich seit seinem Eintritte in die Macht fast allein zur Geschichte Bismarcks: dessen, der alles gewollt und alles getan hat, der dann alles verkörperte, die werdende und die erstandene Nation; dessen Staatsmannschaft sich als souveräne Gewalt über alle anderen hob und sich allem Gebilde eingeprägt hat, mit den Kräften, die sie erbte, und denen, die sie entscheidend hinzubrachte.“ (40, Bd. 1, S. XIII–XIV) Und im Schlusswort des zweiten Bandes: „Über der Zeit, nach deren beiden bisher tragenden Kräften, der bürgerlichen und der persönlichen, dieses Schlusswort fragte, schwebt damals, machtvoller noch als je zuvor, wiederum Er.“ (40, Bd. 2, S. 611) Zum anderen aber reagierte Marcks auf die Kritik der jungen NS-Historiker an Bismarck und versuchte sie durch eine Art Stufentheorie abzufangen. Bismarcks und Hitlers Staat seinen „zwei Stufen derselben einheitlichen Nationalentwicklung, jede von ihnen innerhalb der Notwendigkeiten und Möglichkeiten ihres Tages.“ (40, Bd. 1, S. XII) Der NS-Staat verdanke sich letztlich der Bismarckschen Reichsgründung und ruhe auf ihr auf. Sie innerhalb der Möglichkeiten der 1930er-Jahre weiterzuentwickeln sei ihm aufgegeben.