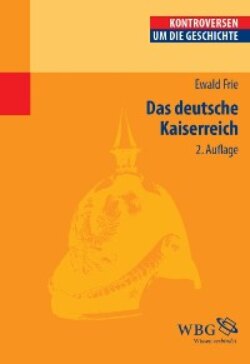Читать книгу Das deutsche Kaiserreich - Ewald Frie - Страница 13
5. Der Aufbruch der 1970er-Jahre
ОглавлениеHans-Ulrich Wehler
„Wehlers Kaiserreich“ – bald als stehender Begriff bekannt, was den hohen Bekanntheitsgrad wie die deutlich empfundene persönliche Note der Interpretation ausweist – präsentierte sich als Produkt eines Neuanfangs. Einleitend war viel von „den Darstellungs- und Interpretationskonventionen der deutschen Geschichtsschreibung seit dem 19. Jahrhundert“ (67, S. 11) die Rede, die überwunden werden müssten. Die moderne deutsche Geschichtswissenschaft, so die Botschaft, beginne erst jetzt. Wehler hatte in den USA studiert. Er hatte mit Historikern wie Hans Rosenberg zusammengearbeitet, die die NS-Zeit in den USA überlebt hatten und nun mit ihrer Mischung aus deutschen und amerikanischen Historikerschulen das intellektuelle Klima in Deutschland belebten. 1931 geboren, hatte seine Universitätslaufbahn weit nach 1945 begonnen, als sich die von Ritter bereits ihrem Ende zuneigte. Sein wichtigster akademischer Lehrer war Theodor Schieder, der erstens durch eigene Arbeiten die deutsche Geschichtswissenschaft vorantrieb, zweitens innerhalb der deutschen Historikerschaft eine wichtige Integrations- und Führungsfigur zwischen den Generationen und Schulen darstellte und drittens als Anreger und Betreuer der wohl wichtigste Mentor für die Historikergeneration war, die seit den späten 1960er-Jahren meinungsführend wurde.
Neue Kaiserreichdeutung
Wehlers Kaiserreichdeutung war in dreierlei Hinsicht bedeutsam: als Wiederaufnahme teils verschütteter, teils versandeter Traditionen, als Zusammenfassung des neuen Diskussionsstandes seit den 1960er-Jahren und als Thesenbuch, an dem sich die Forschung der nächsten Jahre abarbeitete. Wehler begann seine Schlusszusammenfassung mit einem Ziekursch-Zitat und erinnerte damit an die kritische Kaiserreich-Interpretation der Weimarer Zeit. Er berief sich bei seiner Deutung von Innen- und Außenpolitik der späten Bismarck-Jahre und der wilhelminischen Zeit auf Eckart Kehr (32), einen im Exil 1933 früh verstorbenen linken Historiker, der die Außenpolitik als Funktion der Innenpolitik gedeutet und auf die Verbindung von Wirtschaft, Militär und Politik im späten Kaiserreich hingewiesen hatte. Wehler nahm außerdem die Sonderwegsthese wieder auf, die Ritter zu beerdigen gehofft hatte, und wendete sie ins Negative. Er stellte „die Frage nach den eigentümlichen Belastungen der deutschen Geschichte“ (67, S. 11) in den Mittelpunkt seiner Darstellung, weil sich anders „der Weg in die Katastrophe des deutschen Faschismus nicht erhellen“ lasse (67, S. 12). Damit wurde wieder entdeckt und fruchtbar gemacht, was infolge des nationalliberalen bis konservativen Mainstream in der deutschen Geschichtswissenschaft lange nicht zum Zuge gekommen war.
Anschließende Debatten
Darüber hinaus erntete das Buch erste Früchte der seit der Fischer-Kontroverse aufgeregten Diskussion. Es importierte Theorien aus den Sozialwissenschaften, |11|um zu einer „problemorientierten historischen Strukturanalyse der deutschen Gesellschaft und ihrer Politik“ (67, S. 11) zu kommen. Weil es neue Fragen, Theorien und Thesen aber selektiv zusammenfasste und für eine pointierte Gesamtdeutung nutzte, regte es schließlich neue Forschungen an. Begriffe wie Modernisierung und Modernisierungstheorie (70; 64), Imperialismus und Sozialimperialismus (45; 46; 189), Organisierter Kapitalismus (71), Bonapartismus (20), „Primat der Innenpolitik“, „Deutscher Sonderweg“ (8; 19) spielten in der Kaiserreichforschung der 1970er und frühen 1980er-Jahre eine entscheidende Rolle. In zahlreichen Einzelstudien wurde das Verhältnis von Staat und Politik zur Wirtschaft, zur Kultur, zu den sozialen Schichten bzw. Klassen, zu den sozialen Verhältnissen untersucht. Damit wurde die traditionelle Konzentration der deutschen Geschichtswissenschaft auf Staat und Politik aufgebrochen. Überwunden wurde sie noch nicht, weil zwar die Beziehung zwischen Staat/Politik und anderen Lebensbereichen zum Thema wurde, noch nicht aber die Eigendynamik dieser Lebensbereiche selbst. Viele Thesen Wehlers wurden im Zuge dieser intensiven Forschungsanstrengungen modifiziert oder gar falsifiziert. Im Rückblick liegt ihr großer Wert darin, für mehr als ein Jahrzehnt die Wege der Forschung bestimmt zu haben.
Neuere Gesamtdarstellungen
In den 1980er und frühen 1990er-Jahren wurden die Ergebnisse des geschichtswissenschaftlichen Aufbruchs, der mit der Fischer-Kontroverse und Wehlers Kaiserreich verbunden wird, in neuen Gesamtdarstellungen zusammengefasst. Die Autoren Michael Stürmer (∗1938), Wolfgang J. Mommsen (∗1930), Thomas Nipperdey (∗1927, †1991) und Hans-Ulrich Wehler (∗1931) hatten sämtlich nach 1945 ihre akademische Laufbahn begonnen. Am Aufbruch seit den 1960er-Jahren hatten sie alle durch Forschung und Publikationen ihren Anteil, wenngleich sie politisch unterschiedlich orientiert waren. Sie zogen nun ihre Summe.
Michael Stürmer
Der Erste war Michael Stürmer. Er präsentierte „das ruhelose Reich“ (58) zunächst strukturgeschichtlich in seinen gesellschafts-, sozial-, wirtschafts- und kulturgeschichtlichen Umbrüchen, bevor er ereignisgeschichtlich den Gang der Innen- und Außenpolitik verfolgte. Drei zentrale Themen schlug er an: die Dynamisierung der gesellschaftlichen Strukturen, die Veränderung der Politik durch den Einfluss der Vielen, die geopolitisch enorm schwierige europäische Mittellage des Reiches. Das Kaiserreich sei die Epoche, „da Industrialisierung, Säkularisierung und Nationalismus in einen Weg ohne Wiederkehr führten, Machtstaat und Massenkonsens einander bedingten und die Geographie Europas dem Deutschen Reich eine Schlüsselrolle zuwies, die weder durch Hegemonie aufzulösen noch durch Gleichgewicht ruhig zu stellen war.“ (58, S. 10) Angesichts der Verkettung gemeineuropäischer Modernisierungsprobleme mit spezifisch deutschen innen- und außenpolitischen Vorbedingungen kam Stürmer zu dem Schluss, dass die Katastrophe des Weltkrieges letztlich wohl unabwendbar gewesen sei: „Der Weg Europas bleibt eine Tragödie zu nennen. Denn dieselben Kräfte von Wagemut und Wettkampf, von Opfer und Begeisterung, von Selbstdisziplin und Sozialorganisation, die Europa im Verlauf der Neuzeit groß gemacht hatten, trieben auch zu seiner Zerstörung. Nicht Zufall war dies und nicht Anachronismus. Die Späterlebenden möchten sich den Glauben erhalten, Hybris und Zerstörung seien vermeidbar gewesen, und |12|vieles hätte auch anders kommen können. Der Weltkrieg, gewiss, er war nicht zwangsläufig, wohl aber jene europäischen Mächtekonflikte, aus denen er entstand, und die moderne Machtstaatsidee, die ihn rechtfertigte. Zuletzt spricht vieles dafür, dass ‘Ausgleichung’ nicht denkbar war“ (58, S. 409). Die Zitate belegen nicht nur die wichtigsten Thesen. Sie sind auch Beispiele für die metaphernreiche, teils suggestive Sprache Stürmers. Er ist ein Meister der Anschaulichkeit, der Impression, des Details. Er zieht den Leser in seinen Bann, überspielt damit aber auch manche inhaltliche Unschärfen. Nicht alle Begriffe, nicht alle Begründungszusammenhänge sind klar. Das Buch hat einen breiten Leserkreis gefunden. In der Forschung ist es weniger folgenreich geblieben als die drei folgenden Gesamtdarstellungen.
Wolfgang J. Mommsen
Wolfgang J. Mommsen schrieb einige Jahre nach Stürmer eine Politikgeschichte des Kaiserreichs, die darüber hinaus vor allem die Interdependenzen zwischen Politik und sozialen Verhältnissen (politische Sozialgeschichte) und die zwischen Politik und Kultur (politische Kulturgeschichte) in den Blick nahm (43, 42). Mommsen verwarf das außenpolitische Zentralargument Stürmers von der geopolitischen Mittellage. Er stellte stattdessen die Spannung zwischen modernen und traditionalen Elementen im politischen System des Kaiserreichs in den Mittelpunkt, damit die Sonderwegsthese und die These vom Primat der Innenpolitik vorsichtig und ganz abgeschwächt fortschreibend: Das Problem des Kaiserreichs war, „dass hier ein ungeklärtes Mischungsverhältnis von konservativen und progressiven, von autoritären und demokratischen Elementen eine schrittweise Anpassung der Verfassungsordnung an die Erfordernisse des 20. Jahrhunderts erschwerte. Während das Kaiserreich im gesellschaftlichen Bereich, insbesondere mit dem Aufbau eines dynamischen industriellen Systems, den Schritt in die Moderne vollzog, blieben das politische System und die von diesem definierten gesellschaftlichen Statushierarchien weit dahinter zurück. Es ist die Spannung zwischen diesen beiden Bereichen, die den Gang der deutschen Politik maßgeblich bestimmt hat.“ (43, S. 26) Das Kaiserreich erschien so gleichzeitig als Frühgeschichte der kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Moderne, die nach Mommsen auch das späte 20. Jahrhundert noch prägte, wie als Ausgangspunkt für die Entwicklungen, die in die Katastrophen der beiden Weltkriege führten.
Wehler und Nipperdey
Während Mommsen und Stürmer dezidiert Kaiserreichgeschichte schrieben, war der erste deutsche Nationalstaat für die beiden übrigen Autoren Teil einer jeweils mehrbändigen Gesamtdarstellung, die das lange 19. Jahrhundert (Nipperdey) bzw. die deutsche Gesellschaftsgeschichte der letzten dreihundert Jahre (Wehler) umfassten. Wehler hatte 1987 die ersten beiden Bände seiner „Deutschen Gesellschaftsgeschichte“ (68) publiziert, die in insgesamt fünf Bänden die Zeit nach 1700 behandeln sollen. Gesellschaftsgeschichte bedeutete, dass Wehler das Ganze der deutschen Gesellschaft im Auge hatte, und es entlang von vier „Achsen“ zu erfassen trachtete: „Wirtschaft, Sozialhierarchie, Herrschaft und Kultur“ (68, Bd. 1, S. 13). Das war ein Mammutunternehmen, und alle Rezensenten haben die Fähigkeit bewundert, in so verschiedenen Gebieten – am wenigsten vielleicht in der Kultur – bewandert zu sein. Die schwierigste Aufgabe war, die Interdependenzen zwischen den Achsen in den Blick zu bekommen, entlang |13|derer nacheinander über Geschichte analysierend berichtet wurde. Das starre Gliederungskorsett wirkte manchmal wie eine Barriere.
Gesellschaftsgeschichte
Der dritte und hier einschlägige Band der Gesellschaftsgeschichte erschien 1995. Auf 1515 Seiten ging es um die Jahre 1849–1914. Wehler zog eine durchaus selbstkritische Bilanz der Debatten, die seit seinem „Kaiserreich“ entbrannt und ausgefochten worden waren. Er verabschiedete sich von einigen Zentralbegriffen der 1970er-Jahre wie „Bonapartismus“ und „Primat der Innenpolitik“. Den deutschen Sonderweg setzte Wehler in distanzierende Anführungszeichen. Die Frage nach den Ursachen des Nationalsozialismus müsse eine der Leitperspektiven der Kaiserreichforschung bleiben. Thematisiert wurde die Mischung aus „gemeineuropäischen Charakteristika und spezifischen Sonderbedingungen des deutschen Weges in die Moderne“ (68, Bd. 3, S. 1251). Für die Erklärung der Kaiserreichgeschichte blieb das Phänomen Bismarck zentral. Wehler versuchte es mit dem bei Max Weber entliehenen Theorem der charismatischen Herrschaft in den Griff zu bekommen. Am Ende des Bandes stand eine These, die bei aller Abschwächung im Einzelnen den Kern der Interpretation des Kaiserreichs im Rahmen einer kritischen politischen Sozialgeschichte stehen ließ: „Ausschlaggebend für den deutschen ‘Sonderweg’ war aber letztlich das politische Herrschaftssystem und die es tragende soziale Kräftekonstellation. Sie haben zusammen jene verhängnisvollen Belastungen geschaffen, welche die Deformationen der deutschen Geschichte bis 1945 ermöglicht haben.“ (68, Bd. 3, S. 1295)
Thomas Nipperdey
Nipperdeys Darstellung war die liberalkonservative Alternativdeutung zum sozialliberalen Unternehmen Wehlers. Wo Wehler analysierend zergliederte, erzählte Nipperdey. Auch seine Geschichte des Kaiserreichs – mehr als 1800 Seiten in zwei Bänden – sollte „die Totalität der Lebensweisen umgreifen …, die vielen möglichen Geschichten von Wirtschaft, Verfassung, Klassen und Klassenkampf, Industrialisierung, Alltag und Mentalität und große Kultur übergreif[en]“ (47, Bd. 1, S. 837–838). Doch dies geschah viel weniger systematisch. Charakteristisch die Kapitelanfänge: „Menschen müssen sich ernähren. Sie essen und trinken. Wie sah es damit aus?“ begann eines, „Menschen kleiden sich“ (47, Bd. 1, S. 125 u. S. 132) das nächste. Nipperdey bot im ersten Band ein Panorama von Alltag, Wirtschaft, sozialen Verhältnissen, sozialen Schichten und Klassen, Religion, Bildung, Wissenschaften, Hochkultur und Presse. Mit der Innen und Außenpolitik, dem Thema des zweiten Bandes, war diese breite Erzählung nicht wirklich verknüpft. Eine „Formel oder These, auf die sich alles bringen lässt“, fand er nicht. „Wir stehen vor dem Panorama der vielen Ergebnisse und Teilbereiche.“ (47, Bd. 2, S. 877)
„Zwiespalt der Modernität“
Die Betonung der Pluralität bedeutete jedoch nicht die Kapitulation vor der Masse und den Verzicht auf Standortbestimmung. Sie war selbst Programm. Nipperdey teilte zwar viele der methodologischen und inhaltlichen Innovationen der 1960er und 1970er-Jahre: Er sah das Kaiserreich als „aufhaltsame, gebremste und widersprüchliche Modernisierung, als Zwiespalt der Modernität“ (47, Bd. 2, S. 882), er verarbeitete die theoretischen und gegenstandsbezogenen Debatten, an denen er zum Teil selbst beteiligt gewesen war. Doch er kam zu anderen Ergebnissen. Deutlich setzte sich Nipperdey von der Sonderwegsthese ab: „Die Betrachtung der |14|Kaiserzeit nur als Vorgeschichte von Nationalsozialismus und Hitler [ist] bei allen nun obsolet geworden; auch andere Kontinuitäten knüpfen an jene Zeit an, die von Weimar und die der Bundesrepublik, die der großen sozialen und kulturellen Wandlungen unseres Jahrhunderts überhaupt. In dieser Perspektive zeigt sich auch die europäische Gemeinsamkeit, oder: nicht der deutsche Sonderweg, sondern die deutsche Variation gemeineuropäischer Vorgänge.“ (47, Bd. 1, S. 837) Auch an eine Blockade der politischen Modernisierung mit katastrophalen Folgen mochte Nipperdey nicht glauben: „Die Geschichte des Reiches von 1871 bis 1914 ist eine Geschichte gemeineuropäischer Normalität, gelungener Problemlösungen ebenso wie gescheiterter Reformbestrebungen und gehemmter Modernisierung, gewaltigen Wandels jedenfalls und gewaltiger Gewichtsverschiebungen.“ (47, Bd. 2, S. 891) Hatte sich Wehler Anfang der 1970er-Jahre noch programmatisch von den geschichtswissenschaftlichen Traditionsüberhängen des 19. Jahrhunderts abgesetzt, so beschwor Nipperdey erneut Leopold von Ranke und die Einsicht des Historismus, nach der „jede Zeit ihren eigenen Wert und Sinn hat“ (47, Bd. 1, S. 837). Es gehe „nicht darum, mit den Urgroßeltern vor dem Ersten Weltkrieg kritisch und besserwisserisch zu rechten, sondern darum, ihnen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Das ist die Tugend des Historikers“ (47, Bd. 2, S. 880).
„Grundfarbe der Geschichte ist grau“
Der zweite Band, nach den Worten Nipperdeys einer schweren und fortschreitenden Krankheit noch abgerungen und erst nach dem Tod des Autors veröffentlicht, schloss mit dem seither berühmten Satz: „Die Grundfarben der Geschichte sind nicht Schwarz und Weiß, ihr Grundmuster nicht der Kontrast eines Schachbretts; die Grundfarbe der Geschichte ist grau, in unendlichen Schattierungen.“ (47, Bd. 2, S. 905) Die englische Historiographie des 19. Jahrhunderts und die antike Mythologie schwingen hier mit. Stürmers bilderreiche deutsche Tragödie, Mommsens politische und Kulturgeschichte, Wehlers analytisch-stringente Thesengeschichte, Nipperdeys wohl durchdachtes relativierendes Panorama – es war eine reiche Ernte, die die Protagonisten des geschichtswissenschaftlichen Aufbruchs der späten 1960er und 1970er-Jahre in den 1980er und frühen 1990er-Jahren einfuhren.
Grenzen der Synthesen
Mit einigen Jahren Abstand zeigen sich jedoch auch die Grenzen dieser Synthesen. Seit den 1980er-Jahren ist die Welt jenseits der Politik und des Staates in ihrer eigenen Logik zum Thema geworden. Erst die Alltags-, dann die Kulturgeschichte haben, wie Thomas Kühne in einem großen Literaturbericht gezeigt hat, „Menschen als lebende Individuen mit subjektiven Wahrnehmungen und Eigenheiten in ihrer Umgebung, lebensweltlichen Praxis und in ihrer eigenen Sprache“ (33, S. 210) zum Thema gemacht. In den Fragehorizont der 1970er-Jahre, der bei aller Erweiterung doch den Beziehungen des politischen Systems zu Wirtschaft, Kultur und sozialen Verhältnissen verhaftet blieb, ließen sich die Ergebnisse dieser Arbeiten nicht mehr integrieren. In den Synthesen von Stürmer, Mommsen und Wehler kommen sie daher nicht vor. Nipperdey streift sie am Rande.