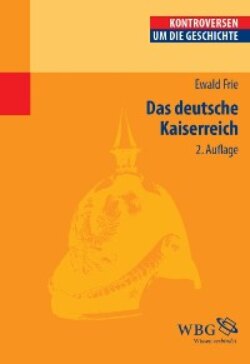Читать книгу Das deutsche Kaiserreich - Ewald Frie - Страница 14
|15|6. Jüngste Entwicklungen
ОглавлениеNeueste Gesamtdarstellungen
Bereits kurz nachdem die prägenden Historiker der 1970er und 1980er-Jahre ihre Werke vollendet hatten, sind daher neue Überblicksdarstellungen erschienen, die der Welt jenseits der Politik größeres Interesse entgegenbringen. Sie sind meist schlanker, weniger enzyklopädisch, mit mehr Mut zur Lücke verfasst. Von ihnen ist Volker Ullrichs „Die nervöse Großmacht“ (63) in Fragestellung und Stil noch am ehesten den Diskussionen der 1970er-Jahre verhaftet. Volker R. Berghahn hingegen strebt eine den Horizont der Politik weit überschreitende „history of the German society in all its respects“ an (1, S. xvi). Von der Diskussion der 1970er-Jahre über Kontinuitäten zwischen Kaiserreich und Drittem Reich verabschiedet er sich mit der ironischen Bemerkung, er halte es schon für schwer genug, herauszufinden, warum Deutschland 1914 in den Krieg gezogen sei. In David Blackbourns beeindruckendem Überblick über das lange 19. Jahrhundert kommt Politik eher am Rande vor (2). Hans-Peter Ullmann gelingt eine Synthese der verschiedenen gesellschaftlichen Bereiche und der politischen Entwicklung in seiner Darstellung des Kaiserreichs als „Gebilde ‘zwischen den Zeiten’“ (61; vgl. 62). Wenn Jörg Fisch vor Kurzem das Kaiserreich in eine Geschichte „Europa[s] zwischen Wachstum und Gleichheit 1850–1914“ (17) eingebettet hat, zeigt er eine weitere Grenzüberschreitung an: den Trend der Forschung zum internationalen Vergleich.
Abschied von alten Leitbegriffen
Was diese jüngsten Gesamtdarstellungen auszeichnet, ist ihre Offenheit. Sie verlassen den durch die Begriffe Staat, Nation, Reich und Politik abgezirkelten Raum, den Droysen in den 1850er-Jahren geöffnet hatte. Sicher, es hat seit Droysen viele Wandlungen, Auf- und Umbrüche gegeben, die sich in Gesamtdarstellungen niedergeschlagen haben: die Umdeutung des Borussianismus durch Sybel und Treitschke, den Aufbruch der Jahrhundertwende, die Debatten der Weimarer Republik, die Volksgeschichte der NS-Zeit, die grundsätzliche Infragestellung der deutschen Geschichte direkt nach 1945, die methodologisch und inhaltlich eher unfruchtbaren 1950er und frühen 1960er-Jahre, den mit der Fischer-Kontroverse und Wehlers Kaiserreich verbundenen Aufbruch der politischen Sozialgeschichte, die Resümees der 1980er und frühen 1990er-Jahre. Immer aber war es um das Kaiserreich als Bezugspunkt deutscher staatlicher Identität gegangen. Noch die Gesamtdarstellungen von Stürmer, Mommsen, Wehler und Nipperdey zeigen dies an. Heinrich August Winklers monumentale Darstellung „Der lange Weg nach Westen“, im Jahre 2000 erschienen, bildet den etwas verspäteten Schlussakkord (72; vgl. 9). Die neuesten Gesamtdarstellungen verlassen dieses sehr deutsche Kampffeld und gewinnen damit neue Beobachtungsmöglichkeiten. Vielleicht ist das Ausdruck eines neuen deutschen Selbstverständnisses im Zeichen von erreichter deutscher Vereinigung, voranschreitender europäischer Vereinigung und Globalisierung.
Abschied von der großen Erzählung
Weniger deutlich ist allerdings, wohin die Offenheit führen soll. Was den neuesten Gesamtdarstellungen fehlt, ist eine Zielperspektive, wie sie von Droysens Borussianismus an eigentlich allen Gesamtdarstellungen eigen war. Die Befunde und Beobachtungen verdichten sich nicht mehr zu |16|der einen großen Gesamtgeschichte. Das könnte ein Ausdruck für den „Abschied von der großen Erzählung“ sein, ein Schlagwort für das in den letzten Jahren vielfach festgestellte Verblassen der interpretativen Rahmen, die – meist unbewusst – den Texten der Historiker Zusammenhalt und Sinn boten: Modernisierung, Säkularisierung, Formierung der Nation o. Ä. Vielleicht aber muss eine Zentralperspektive, die die Kaiserreichgeschichte für das 21. Jahrhundert anschlussfähig macht, sich auch erst noch entwickeln. Bei der Analyse einzelner Forschungskontroversen wird darauf zu achten sein, ob sich neue Wege oder gar ein neuer Weg der Kaiserreichdeutung abzeichnen. Gesamtdarstellungen fassen das für den jeweiligen Autor Wissbare und Wissenswerte zusammen. Sie schließen eher ab als auf. Forschungskontroversen hingegen behandeln immer mehr als das Thema, um das sie vordergründig kreisen. Die nun folgenden großen Forschungskontroversen um das Kaiserreich sind daher einerseits selbst bereits historisch. Sie könnten aber auch die Perspektiven einer kommenden Kaiserreichforschung enthalten.