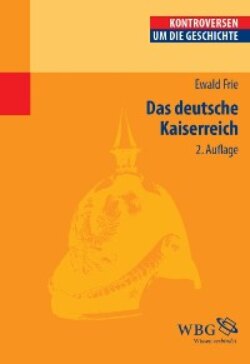Читать книгу Das deutsche Kaiserreich - Ewald Frie - Страница 12
4. Grundsatzdiskussionen nach 1945
ОглавлениеFriedrich Meinecke
Die beiden bei Wahl und Marcks zentralen Interpretationsmuster der Kaiserreichdeutung mussten die deutsche Geschichtswissenschaft nach dem Untergang des NS-Regimes in totaler Zerstörung (Bombenkrieg), totaler militärischer Niederlage (Kapitulation 8. Mai 1945) und totaler geistig-kultureller Delegitimierung (Auschwitz) in eine tiefe Krise führen. Wenn es Stufen deutscher Entwicklung gab, die über Bismarck zu Hitler führten, was bedeutete das jetzt für die Bismarck- und die Kaiserreich-Deutung? Und wie sollte der angeblich so hoch zu schätzende deutsche Sonderweg zwischen westlicher Demokratie und östlicher Autokratie nun gewertet werden, nachdem er in die Katastrophe geführt hatte? In den Jahren nach 1945 arbeiteten die berühmtesten deutschen Historiker daran, die deutsche Geschichte – und damit auch das Kaiserreich als Ankerpunkt deutscher Staatlichkeit – neu zu fundieren (55), nachdem die seit Droysen entwickelten Interpretationsgrundlagen verbrannt waren. Zwei besonders einflussreiche waren Gerhard Ritter und Friedrich Meinecke. Während aber Meinecke seinen großen Essay „Die Deutsche Katastrophe. Betrachtungen und Erinnerungen“ (41) schon aufgrund seines hohen Alters – Meinecke war 1945 bereits 83 Jahre alt – nicht mehr in eine monographische Arbeit hat umsetzen können, standen Ritters Äußerungen direkt nach Kriegsende im Zusammenhang mit einer großen Gesamtsicht auf das Kaiserreich und die deutsche Geschichte der Neuzeit insgesamt.
Gerhard Ritter
Der nationale und konservative Historiker Gerhard Ritter hatte während der Kriegsjahre Kontakte zu Widerstandskreisen unterhalten und war nach 1945 für eineinhalb Jahrzehnte eine der Führungsfiguren unter den deutschen Historikern. Er hatte seit 1941 an einer Darstellung über „Staatskunst und Kriegshandwerk“ gearbeitet, ausgehend von der Frage, „ob und wie |9|sich die Dämonie einer hemmungslos entfesselten Kriegstechnik bändigen lasse durch echte Staatsvernunft.“ Der erste Band entstand noch in der Kriegszeit „unter dem Erlebnis einer Kriegsfurie, die das Deutschland meiner Jugend, das Deutschland des Bismarckreiches einschließlich seiner politisch-geistigen Traditionen, nun vollends in Trümmern sinken ließ.“ Daher spitzte sich die allgemeine Frage für den deutschen Fall darauf zu, „wie es geschichtlich gekommen sei, dass unsere Nation zur Gefolgschaft eines so extremen Militaristen werden konnte, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hatte – eines Dämons, der den guten deutschen Namen zum Schrecken und Abscheu Europas machte.“ (53, Bd. 1, S. 9 u. 11; vgl. 48)
Militarismus
Ritter definierte Militarismus als Überwiegen des Militärischen, des Kriegshandwerks, gegenüber dem Politischen, der Staatskunst. Seit den Massenheeren der Französischen Revolution sei die Gefahr eines übersteigerten, das Eigenrecht des Politischen überwuchernden Militarismus virulent. In Deutschland habe Bismarck sie mühsam zurückgestaut, wie sich an seiner Auseinandersetzung mit Generalstabschef Moltke im Krieg 1870/71 zeige. Seinen weniger befähigten Nachfolgern sei dies unter dem Druck des Wettrüstens seit der Jahrhundertwende nicht mehr gelungen. Hitler war letztlich die Konsequenz dieses Versagens.
Nationalsozialismus und die deutsche Geschichte
Ritter verstand den Nationalsozialismus als Teil einer unguten Entwicklung, die mit der Französischen Revolution ihren Anfang genommen hatte. Er war nicht Teil des deutschen Sonderwegs. Dessen Heroen, Friedrich II. von Preußen, die preußischen Reformer, Bismarck, standen vielmehr für eine andere, in Ritters Definition nichtmilitaristische Tradition. Die deutschen Politiker nach Bismarck wurden aufgrund ihrer geringeren persönlichen Statur von einer seit Robespierre und Napoleon immer mächtiger werdenden, letztlich undeutschen militaristischen Entwicklung überwältigt. So war bei Ritter erst die zweite Hälfte des Kaiserreichs „die Inkubationszeit des viel berufenen deutschen Militarismus (in seiner spezifisch modernen Form)“. Die Weimarer Republik kam als „eine Art von Epilog … mehr aus den Nachwirkungen der vorhergehenden Epoche als aus der neuen Situation“ in den Blick. Während der nationalsozialistischen Zeit wurde dann der Militarismus seitens der politischen Führung ins Extrem getrieben. Am Ende stand die, wie Ritter mit Blick auf das Attentat vom 20. Juli 1944 schrieb, „historisch ganz neue, ja einzigartige Situation, dass es die Soldaten sind, die sich gegen den blinden Militarismus der zivilen Staatsführung zu wehren haben.“ (53, Bd. 2, S. 6–7)
Reaktionen von Historikern
Ritters insgesamt vierbändiges Werk beruhte, anders als viele Gesamtdarstellungen vorher und nachher, auf genauer und erstaunlich vielfältiger Quellenkenntnis. Seine mit dem Militarismusthema verknüpfte Kaiserreichinterpretation aber ist weithin abgelehnt worden. Erstens bekam der auf den Kampf militärischer und politischer Gewalten über die Führung der Außen- und Kriegspolitik konzentrierte Militarismusbegriff die Gesellschaft nicht richtig in den Blick, deren Militarisierung aber doch gerade ein Kennzeichen des Kaiserreichs war. Zweitens überzeugte der Versuch, die deutschen Traditionen gegen den Nationalsozialismus in Stellung zu bringen, eine nachwachsende Historikergeneration nicht mehr, die im gesellschaftlichen Aufbruchklima der 1960er-Jahre die Frage nach den längerfristigen Kontinuitäten zwischen Kaiserreich und Nationalsozialismus neu stellte. |10|Deutlich wurde diese Wachablösung in der Fischer-Kontroverse, der in diesem Buch ein eigenes Kapitel gewidmet ist. Ihren Niederschlag fand sie 1973 in der Gesamtdarstellung von Hans-Ulrich Wehler: „Das Deutsche Kaiserreich 1871–1918“ (67).