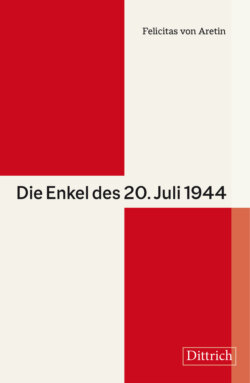Читать книгу Die Enkel des 20. Juli 1944 - Felicitas von Aretin - Страница 8
Das Leben der Witwen und Nachkommen in den Nachkriegsjahren
ОглавлениеDas »Odium des Landesverräters« wurde in den Nachkriegsjahren auf die Witwen des 20. Juli und ihre Familien übertragen, die statt Hilfe und Anerkennung zu bekommen, vielfach Unverständnis und Gehässigkeiten ausgesetzt waren. Verachtung schlug beispielsweise Erica v. Hagen nach ihrem Gefängnisaufenthalt in der Haftanstalt Köslin entgegen. Als sie von dort zurück auf das Hagensche Gut in Langen kam und den Kutscher begrüßen wollte, spielte sich eine bedrückende Szene ab: »Als der Kutscher mich erkannte, erschrak er, wendete sich ab, richtete den Blick zu Boden und ohne aufzusehen, machte er sich weiter mit der Forke beim Ausmisten des Stalls zu schaffen. Das traf mich sehr. Für ihn war ich die Frau des jungen Herrn Albrecht, der versucht hatte, den Führer zu ermorden.«78 In seinem Buch über die »Junge Generation des Widerstands« schildert Detlef Graf v. Schwerin eine typische Szene der Nachkriegszeit: »Die Atmosphäre unter den Deutschen war auch nach der Befreiung so feindselig gegenüber dem Widerstand, dass etwa die kirchliche Trauerfeier für Schwerin, an seinem ersten Todestag, als ein Gottesdienst für ›einen Gefallenen‹ bezeichnet werden musste.«79
Verständnis oder Zuspruch bekamen die oft jungen Witwen nur von politisch gleichgesinnten Verwandten und von nahen Freunden, Bekannten und Arbeitskollegen ihrer Männer, die sich bisweilen finanziell um die Witwen kümmerten. Viele Familien waren indessen in Anhänger und Gegner des Dritten Reiches gespalten. Häufig mussten die Frauen ihre Trauer, Verzweiflung und ihre Erlebnisse nach dem Attentat für sich behalten, was sie erneut in ihrer näheren Umgebung isolierte. Aus der ablehnenden Haltung ihrer Mitmenschen heraus wird verständlich, dass viele Witwen auch in späteren Jahren nicht über ihr Erleben und ihre tief sitzenden Ängste und ihre Verzweiflung sprechen konnten. So beschrieb beispielsweise Uta v. Aretin in einem Interview, wie wenig sich ihre Mutter nach 1945 über das Vorgefallene äußern konnte: »Meine Mutter konnte überhaupt nicht reden. Sie arbeitete in Göttingen bei der Eheberatung und der Telefonseelsorge. Aber über jene Zeit konnte sie sich nicht mitteilen. (…) Sie stellte sich wohl immer wieder die Frage nach Schuld und Vergebung. Seltsam, dass jene, die das Äußerste im Kampf gegen Hitler gewagt hatten, sich ununterbrochen mit dem Problem von eigener Schuld und Sühne und Vergebung auseinandergesetzt haben, während die anderen, die nichts unternommen haben, die Schuld entweder nicht wahrgenommen oder fleißig verdrängt haben.«80
Die meisten Witwen teilten ihre Erlebnisse mit niemanden und bewahrten die Briefe als Zeugnisse einer tiefen und innig empfundenen Liebe im Angesicht des nahenden Todes auf. »Die Briefe treiben mir noch heute die Tränen in die Augen«, erzählt ein Enkel von Fritz-Dietlof Graf v. der Schulenburg.81 Es verwundert nicht, dass in dieser Seelenlage die Witwen auch mit ihren Kindern kaum über den Vater sprechen und damit den Söhnen und Töchtern, in der Verarbeitung ihrer eigenen traumatisierenden Erlebnisse, nur wenig Stütze sein konnten. Im Vordergrund stand zunächst, den eigenen Kindern eine gute und sinnvolle Erziehung zu geben, ein neues Zuhause aufzubauen und finanziell wieder Boden unter die Füße zu bekommen. Denn in den Nachkriegsjahren lebten viele Widerstandsfamilien in finanziell bedrängten Verhältnissen, zumal wenn sie das Schicksal von Millionen Deutschen teilten und aus ihrer alten Heimat geflohen waren. »Meine Mutter erhielt erst 1953 eine Rente«, erinnert sich Uta v. Aretin, zuvor habe sie zahlreiche Bittgänge zu Behörden gemacht. »Ich weiß nicht, wie sie das alles ausgehalten hat, nachdem sie ihren Mann und ihren Sohn im Krieg verlor, selbst im Gefängnis saß, ihre beiden Töchter verschleppt worden waren und sie aus ihrer Heimat vertrieben war.«82
Bis Anfang der fünfziger Jahre erhielten die Witwen – je nachdem in welcher Zone sie wohnten – allenfalls eine geringe Überbrückungsrente. Am einfühlsamsten verhielt sich die Verwaltung in der französischen Zone, so dass die Witwe Stauffenbergs relativ früh eine angemessene Pension erhielt. In einer Reportage für die Süddeutsche Zeitung beschrieb die Journalistin Ursula v. Kardorff, wie schlecht viele Witwen in den Nachkriegsjahren versorgt waren. Im Sommer 1950 war Kardorff durch ganz Deutschland gereist, um verschiedene Witwen über ihre näheren Lebensumstände zu interviewen, für die sich bislang von offizieller Seite niemand interessierte.83 Danach kochte die Witwe Cäsar v. Hofackers in Tübingen für Studenten, um ihre fünf Kinder durchzubringen; die Witwe des christlichen Gewerkschaftlers Max Habermann schlug sich in Berlin mehr schlecht als recht mit einem Papiergeschäft durch; die Witwe des Rechtsanwalts Josef Wirmer machte eine Buchhandlung im Deutschen Bundestag in Bonn auf, die Witwe von Adam v. Trott arbeitete bis zu ihrem Studienbeginn bei dem ehemaligen Gefängnispfarrer Harald Poelchau.84 »Die ersten Jahre waren doch sehr hart. Nichts zu essen, kein Geld. Die rührende Kinderschwester, die immer noch bei uns war, die kriegte kein Gehalt. Und Wilhelm, der Älteste, kam dann als Knecht auf einen Hof und hat da gearbeitet, weil es noch keine Schule gab«,85 erinnerte sich Marianne Gräfin Schwerin v. Schwanenfeld an die unmittelbare Nachkriegszeit. Viele Frauen waren bei Verwandten untergekommen, da sie keine Miete zahlen konnten. Schlecht ging es auch den sechs Kindern von Hermann Maass, deren Mutter kurz nach der Hinrichtung des Vaters gestorben war. »Auch nach dem Krieg weigerten sich die Behörden, uns die Lebensversicherung unseres Vaters auszuzahlen«, erzählt Michael Maass.86
Charlotte Gräfin v. der Schulenburg fand bei einem Verwandten auf der Burg Hehlen Quartier, der ihr – obgleich sie sich nicht kannten – geschrieben hatte: »Liebe Cousine, habe gehört, dass es dir dreckig geht. Du kannst nach Hehlen kommen, die Engländer haben mein Haus freigegeben.«87 Finanziell hielt sich die Mutter von sechs Kindern mit einer geringen Überbrückungshilfe und dem Verkauf von Schmuckstücken auf dem Schwarzmarkt über Wasser. In den fünfziger Jahren arbeitete sie als Pädagogin in dem Reformgymnasium Birklehof. Nach ihrer Flucht im Mai 1946 bewirtschaftete Erica v. Hagen einen kleinen Pachthof eines Verwandten in Niedersachsen, der so wenig Geld einbrachte, dass sie als Vertreterin für Unterwäsche mit dem Fahrrad über Land fuhr, um sich und ihre beiden Kinder durchzubringen.88
Andere – wie beispielsweise Rosemarie Reichwein – wurden von den politischen Freunden ihres Mannes unterstützt. »Ich war durchaus abhängig von Hilfe. Und das muss ich heute deutlich sagen: Die Freunde meines Mannes haben mir über den Berg geholfen«,89 erzählte die damals 94-Jährige ihrem Biographen. An anderer Stelle ergänzt sie: »Ich musste sehr intensiv arbeiten, weil ich also meine Unterstützung, das heißt die Anerkennung der Pension meines Mannes und die Entschädigung für Schaden am Leben erst nach zehn Jahren bekam. Die Kriegerwitwen gingen vor. Es ging nach dem Alphabet. Und da waren einfach Kriegerwitwen schon eher versorgt als wir vom Widerstand.«90 Im November 1946 verließ Rosemarie Reichwein mit ihren vier Kindern Deutschland, um ihre Kenntnisse der Krankengymnastik aufzufrischen, Abstand von den Erlebnissen zu gewinnen und von der besseren Versorgungslage in Schweden für ihre vier Kinder zu profitieren. Die Kinder wurden dabei in Schweden verteilt. »Ein richtiges Familienleben fand nach dem Tod des Vaters zunächst nicht mehr statt«,91 erinnert sich Sabine Reichwein.
Auch Freya v. Moltke emigrierte mit ihren beiden Söhnen 1948 zunächst nach Südafrika, wo die Familie ihres Mannes mütterlicherseits herstammte.92 Als eine große Schwierigkeit erwies es sich, dass die meisten Frauen des 20. Juli vor dem Krieg keine abgeschlossene Ausbildung oder Studium absolviert hatten. Einige von ihnen holten deshalb in den fünfziger Jahren eine Ausbildung nach: So setzte Erika v. Tresckow, die Frau von Gerd v. Tresckow, ihr Medizinstudium fort und eröffnete später in Bonn eine eigene Augenarzt-Praxis. Auch Clarita v. Trott zu Solz wendete sich der Medizin zu und ließ sich später als Psychoanalytikerin in Berlin-Dahlem nieder. Rosemarie Reichwein öffnete ebenfalls in Berlin eine Krankengymnastik-Praxis und entwickelte eine wichtige Therapie für spastische Patienten.93 Marion Gräfin Yorck v. Wartenburg holte ihr zweites juristisches Staatsexamen nach und wurde Jugendstrafrichterin in Berlin. Bis weit über die Nachkriegsjahre hinaus konzentrierten sich die jungen Witwen auf den beruflichen Neubeginn und die Versorgung ihrer Kinder. Einige Witwen gingen nach dem Krieg eine neue Herzensbindung ein. Oft wuchsen die Kinder des 20. Juli jedoch ohne männliche Bezugspersonen auf. Gerade die ältesten Söhne mussten der Mutter den Ehemann und häufig den ebenfalls gefallenen älteren Bruder ersetzen, was in einigen Familien zu Schwierigkeiten führte.
Unbürokratische und schnelle Hilfe leistete in den Anfangsjahren der Bundesrepublik nur das Hilfswerk 20. Juli 194494 das unmittelbar nach Kriegsende, unter anderem von dem Ehepaar Graf Carl-Hans und Gräfin Renate Hardenberg, Walter Bauer, Elisabeth Strünck, Eugen Gerstenmaier und Fabian v. Schlabrendorff, als Selbsthilfe-Verein ins Leben gerufen wurde. Alle Gründungsmitglieder des Hilfswerks hatten schwere Schicksale hinter sich und fühlten sich auf Grund der Tatsache, dass sie überlebt hatten, zu einer besonderen Hilfe verpflichtet. Graf Hardenberg arbeitete nach dem Krieg als Bevollmächtigter der Vermögensverwaltung des Hauses Brandenburg-Preußen und war 1946 nach Nörten-Hardenberg nahe Göttingen übergesiedelt. Denn schon 1946 war absehbar, dass sein großer Besitz in Neuhardenberg in der SBZ entschädigungslos enteignet werden würde,95 obgleich sich Hardenberg,96 unmittelbar nach seiner Befreiung aus dem KZ Sachsenhausen durch die Rote Armee, dem Magistrat von Berlin in der sowjetisch besetzten Zone für den Wiederaufbau zur Verfügung gestellt hatte. Seine Frau setzte sich als erste Geschäftsführerin des Hilfswerks unermüdlich und mit großer Energie für die Sorgen der Witwen und deren Kinder ein. Auch der Fabrikant Walter Bauer, der als Mitglied des Freiburger Kreises und der Bekennenden Kirche nach dem 20. Juli inhaftiert worden war, und der Rechtsanwalt und spätere Richter am Bundesverfassungsgericht Fabian v. Schlabrendorff stellten ihr ganzes wirtschaftliches und juristisches Wissen und ihre Kontakte in den Dienst des Hilfswerks. Schlabrendorff, Ordonnanzoffizier Henning v. Tresckows, war nur durch den Tod Freislers vor der sicheren Hinrichtung gerettet worden. Eine wichtige Rolle spielte auch die Witwe von Theodor Strünck, Elisabeth, die durch ihre umfangreichen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kontakte das Hilfswerk bis zu ihrem Tod großzügig unterstützte.
Nach Kriegsende hatten sich verschiedene Selbstorganisationen von Opfern97 der nationalsozialistischen Verfolgung gegründet, wie die bereits genannte, zonenübergreifend arbeitende Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN). Auch wenn die Opferorganisationen bisweilen verschiedene Ziele verfolgten, arbeiteten die Vereinigungen in der unmittelbaren Nachkriegszeit eng zusammen, bis der Kalte Krieg dies zunichte machte. Die Zunahme politischer Spannungen ließ den VVN in den drei westlichen Zonen zunehmend in Verdacht geraten, von der Sowjetunion ferngesteuert zu werden, weshalb sich als weitere Verbände der Bund der Verfolgten des Naziregimes (BVN) und der Zentralverband der deutschen Widerstandskämpfer und Verfolgten (ZDWV) gründeten, die jeweils der CDU/CSU beziehungsweise der SPD nahe standen.
In den Anfangsjahren versuchte das Hilfswerk vor allem Gelder und Hilfsgüter aus dem Ausland zu beschaffen, unterstützte bedürftige Witwen und Waisen und beriet sie über ihre Rechte. Im Sommer 1946 kümmerte sich das Hilfswerk um 350 Personen. Eine besondere Hilfe erhielt es dabei von der Evangelischen Kirche Deutschlands unter dem Vorsitz von Eugen Gerstenmaier, der ebenfalls im Widerstand aktiv gewesen war. Auch Emigranten und Kollegen aus den USA und England halfen, in den Nachkriegsjahren die unmittelbare Not zu lindern. In England gründete beispielsweise der Bischof von Chichester einen 20. Juli Memorial Fund, der von der Journalistin Christabel Bielenberg,98 die gemeinsam mit ihrem Mann Peter Bielenberg eng mit Adam v. Trott verbunden gewesen war, unterstützt wurde.99 Peter Bielenberg hatte das Schicksal vieler seiner Freunde geteilt und war nach dem 20. Juli ebenfalls inhaftiert worden. In den USA rief ein Committee to Aid the Survivors of the German Resistance zur Hilfe auf und schickte die so genannten Care-Pakete. Je mehr Gelder eingingen, umso schwieriger wurde es für die zunächst eher wie ein Freundeskreis arbeitende Stiftung zu definieren, wer förderbedürftig sei und wer nicht. 1947 gab sich das Hilfswerk eine Satzung und richtete ein Kuratorium und einen Vorstand als Entscheidungsgremien ein. Dabei war absehbar, dass das Hilfswerk nur kurzfristige Unterstützung leisten, aber auf längere Dauer keine Renten und Pensionen für Witwen und Waisen zahlen konnte. Andere Verfolgtenverbände kämpften schon seit Ende der vierziger Jahre um eine staatliche Wiedergutmachung. »Die Wiedergutmachungsfrage wurde zur Nagelprobe für das gewachsene Selbstverständnis des Hilfswerks als einer auch politisch tätigen Interessenvereinigung«,100 resümiert Christine Toyka-Seid.
Im Jahr 1951 kam es endlich von staatlicher Seite zur Lösung der längst überfälligen Wiedergutmachungs- und Rentenfrage101 für die Witwen und Nachkommen von Widerstandskämpfern. Eine erste Etappe stellte dabei das Gesetz zur Wiedergutmachung von NS-Unrecht für Angehörige des öffentlichen Dienstes (BWGöD) dar. Da viele Männer des 20. Juli im öffentlichen Dienst gearbeitet hatten, versorgte das Gesetz eine Reihe von Witwen und Nachkommen. Außerdem bewilligte der Deutsche Bundestag im Herbst 1951 einen jährlichen Zuschuss für das Hilfswerk. So hatte Ministerialrat Ernst Wirmer im Bundeskanzleramt und Jakob Kaiser, Minister für innerdeutsche Fragen, vorgeschlagen, dass statt eines eigenen Versorgungsgesetzes für die Hinterbliebenen des Attentats die Bundesregierung dem Hilfswerk jährlich einen Zuschuss zahlen solle. Damit hatten der Bruder des hingerichteten Rechtsanwalts Josef Wirmer und der Widerstandskämpfer Jakob Kaiser erreicht, dass das Hilfswerk schnell und unbürokratisch auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Angehörigen reagieren konnte. In der Haltung der Bundesrepublik bedeutete die materielle Unterstützung indessen einen entscheidenden Wandel der offiziellen Einstellung, die sich als Erstes in der Rechtsprechung zeigte. So erklärte die Bundesregierung im Oktober 1951: »Es ist eine ›Ehrenpflicht‹ des deutschen Volkes, für die Witwen und Waisen der Männer zu sorgen, die im Kampf gegen Hitler ihr Leben für Deutschland geopfert haben (…) Die Welt empfing durch die Männer und Frauen des 20. Juli noch einmal den Beweis, dass nicht die Gesamtheit des deutschen Volkes dem Nationalsozialismus verfallen war.«102 Die staatliche Unterstützung für das Hilfswerk 20. Juli 1944 betrug zunächst 150 000 DM und wurde 1953 vom Deutschen Bundestag auf 400 000 DM erhöht.103 Für einige Angehörige besteht bis heute eine finanzielle Unterstützung durch die seit 1994 umbenannte Stiftung 20. Juli 1944.
1953 regelte die Bundesregierung zudem in einem umfangreichen Wiedergutmachungsgesetz den Schaden für Überlebende nationalsozialistischer Zwangs- und Verfolgungsmaßnahmen in dem so genannten Bundesergänzungsgesetz zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung,104 von dem auch die Nachkommen aus Widerstandsfamilien profitierten. Das Hilfswerk kritisierte das Gesetz, da es die Sippenhaft nicht berücksichtigte und NSDAP-Mitglieder von vorneherein von der Wiedergutmachung ausschloss, auch wenn sie später Widerstand geleistet hatten. So kommentierte das Kuratorium des Hilfswerks: »Es ist unerträglich, wenn auf der einen Seite die Parteizugehörigkeit wiedergutmachungsunwürdig macht, obwohl der aktive Widerstand nach der Präambel des BEG ›ein Verdienst um das Wohl des Deutschen Volkes und des Staates ist‹, auf der anderen Seite sogar Bundesminister ehemalige Parteigenossen sind.« Immerhin erreichte das Hilfswerk, dass in begründeten Einzelfällen anders entschieden wurde. Die jahrelange Diskussion um die Entschädigungsgesetze band in den ersten Jahren entscheidende Kräfte des Hilfswerks.
Häufig nützten den Angehörigen die Wiedergutmachungsgesetze wenig, da sich Beamte von nachrangigen Behörden weigerten, die Gesetze anzuwenden. Für Furore sorgte der Fall des Generalquartiermeisters Eduard Wagner,105 den die Süddeutsche Zeitung aufgriff. Danach verweigerte die zuständige Oberfinanzdirektion der Witwe Elisabeth Wagner die Auszahlung der Rente und begründete dies mit den Worten: »Ihr Mann hat überhaupt kein nationalsozialistisches Unrecht erlitten, er hat sich vielmehr selbst erschossen und ein erledigendes nationalsozialistisches Unrecht nicht abgewartet.«106 Auf Grund des Artikels in der Süddeutschen Zeitung entschuldigte sich das Bayerische Staatsministerium der Finanzen und bedauerte »die wenig glückliche Formulierung« und versprach, für Abhilfe zu sorgen. Viele Witwen machten ähnliche Erfahrungen. So kämpfte Charlotte v. der Schulenburg jahrelang um ihre Witwenrente, da ihr Mann 1932 in die NSDAP eingetreten war. In ihren Memoiren schrieb sie: »Es war alles grotesk und sehr anstrengend. Dann fand man heraus, dass ein preußischer Beamter, der zum Tode verurteilt worden war, also zum Beispiel auch ein Mörder, nach einem Gesetz von ungefähr 1850 für seine Familie auch keine Pension beanspruchen könnte. Die beamtenrechtlichen Folgen dieses Gesetzes mussten erst überwunden werden. Und immer wieder dauerte es Monate, bis irgendein Bescheid kam.«107
Im Gegensatz zu der öffentlichen Meinung begann sich in der Politik und Rechtsprechung zu Beginn der fünfziger Jahre jedoch ein spürbarer Wandel abzuzeichnen, der in der Kabinettserklärung Konrad Adenauers 1951 zum Widerstand, vor allem aber in der Rede von Bundespräsident Theodor Heuss 1954 ihren ersten Höhepunkt fanden. Widerstand wurde als Abwehrrecht gegen einen totalitären Staat verstanden und zu Beginn der fünfziger Jahre zunehmend mehr für die eigene Staatsvorstellung instrumentalisiert: In dem Maße, in dem die DDR den antifaschistischen Widerstand für sich reklamierte und jede Verantwortung an NS-Verbrechen ablehnte, wurde der Widerstand in der Bundesrepublik als Vorgeschichte einer demokratischen und freiheitlichen Nation umgedeutet und damit in Teilen heroisiert, wobei der kommunistische und sozialistische Widerstand unbeachtet blieb.
Gleichzeitig kümmerte sich das Hilfswerk um die Nachkommen von Widerstandskämpfern, die zusätzlich zu der traumatischen Erfahrung häufig in der Schule, in der Lehre oder der Universität wegen ihres Vaters ausgegrenzt wurden oder sich isoliert fühlten. Der Austausch mit anderen Nachkommen aus Widerstandsfamilien sollte helfen, die Einsamkeit und das Leid der Söhne und Töchter zu lindern. In der Schule hätten alle gedacht, sie wäre eine Jüdin, da die Mitschüler nichts vom Widerstand wussten, erinnert sich Clarita Müller-Plantenberg, die Tochter Adam v. Trotts.108 Außerdem setzte sich das Hilfswerk dafür ein, dass Überlebende des Attentats den Nachkommen die Motive, die inneren Kämpfe und Ziele ihrer Väter näher brachten, um den Weg in den Widerstand für die Kinder verständlicher zu machen, die bisweilen die Motive ihrer Väter nicht verstanden. Gleichzeitig verwaltete das Hilfswerk Schulstipendien für Hermann-Lietz-Schulen, für das Internat in Salem und die Odenwaldschule. Dahinter verbarg sich die Überlegung, den Söhnen und Töchtern die Chancen in der Bundesrepublik einzuräumen, die ihnen ihre Herkunftsfamilien unter anderen Umständen auch gewährt hätten. »Das war damals eine sehr kräfteraubende und zeitintensive Arbeit, die die Gräfin Hardenberg leistete«,109 erinnert sich Christine Blumenberg-Lampe, die den Aufbau des Hilfswerks als Tochter von Gertrud Lampe, der Nachfolgerin Gräfin Hardenbergs, seit der Gründung verfolgt hat.
Im Jahr 1946 stand die Gesundheit der Kinder im Vordergrund: Die Kinder mussten »aufgepäppelt« werden. Der Schweizer Arzt, Albert v. Erlach, hatte deshalb eine Hilfsaktion für die Kinder des 20. Juli gegründet und ermöglichte 130 von ihnen einen dreimonatigen Aufenthalt in ausgesuchten Schweizer Familien. Andere Kinder kamen in Schweizer Kinderheime. Von diesem Aufenthalt profitierten die Kinder nicht nur, sondern fühlten sich teilweise erneut alleine gelassen und abgeschoben. »So kam ich zur Familie des Müllers Lanz nach Wiedlisbach im Kanton Solothurn und erlebte dort drei Monate lang ganz wunderschöne Ferien. Die Erinnerung an diese Zeit, das gute Essen, die netten Leute, der zauberhafte Ort ist mir unvergesslich. Noch heute besuchen mein Mann und ich einmal im Jahr voller Freude und Dankbarkeit die Familie Lanz in Solothurn«,110 erinnert sich Helmtrud v. Hagen. Zahlreiche amerikanische Vereine, Rotary-Clubs und Schulen luden Kinder von Widerstandskämpfern für ein Jahr auf ihre Kosten in die Vereinigten Staaten ein.
Außerdem bemühte sich das Hilfswerk zu erfahren, was den Kindern während ihres Aufenthalts in Bad Sachsa tatsächlich passiert sei. So hatten einige Mütter das Gefühl, dass sich ihre Kinder seit dieser Zeit merklich verändert hatten. Vor allem kleinere Kinder, die sich kaum artikulieren konnten, litten und leiden teilweise bis heute unter der für sie unerklärbaren Trennung von den Eltern. So erzählte die Witwe Adam v. Trotts, Clarita, in einem Interview: »Die zweieinhalbjährige Verena ist durch die Küchentür ins Haus gekommen und hat gesagt: ›Da bin ich wieder.‹ Aber als wir wieder vereint waren, konnte ich sie drei Tage lang nicht trösten, so unaufhörlich weinte sie kläglich vor sich hin.«111 Auch Helmtrud v. Hagen erlebte die Zeit als traumatisch: »Ich war die letzte, die kam, behaupte ich. Die Mädchen kannten sich oder hatten vielleicht schon zusammen gespielt. Ich war da so ein Fremdkörper, der wahrscheinlich auch störte.«112 Andere Kinder verarbeiteten die Erlebnisse auf den ersten Blick anders. So berichtete die Witwe Elisabeth Freytag v. Loringhoven: »Man hat ihnen Schauergeschichten erzählt, damit sie nicht weglaufen, aber ansonsten wurden sie wohl nicht schlecht behandelt. Meine beiden Älteren fanden dort sofort Anschluss und Freunde. Wir waren kaum zusammen, da stürzten sich die Buben über mich und sprudelten mit Namen heraus, von Kindern, mit denen sie zusammengewesen waren, Stauffenberg, Hansen …«113 Christa v. Hofackers Erinnerungen lassen hingegen die Schwere erahnen, die der Aufenthalt in Bad Sachsa und die Veränderungen in den Familien bewirkten. So berichtet sie in einem Nachsatz ihres Artikels, dass nach 1944 eine »tiefe Wunde« geblieben sei. »Aber dann ist mir, als habe sich vor dieses eine Jahr ein dichter Schleier gezogen und all das Erlebte sei nur ein Traum.«114
1953 ließ die engagierte Geschäftsführerin Renate Gräfin Hardenberg durch einen Bekannten Nachforschungen in Bad Sachsa anstellen.115 Dort stieß er zunächst auf eine Mauer des Schweigens. Das Personal des ehemaligen Kinderheims, das nach dem Krieg in ein Erholungsheim für TBC-verdächtige Kinder umgewandelt geworden war, war nicht mehr auffindbar. Schließlich gelang es ihr nach einigen Überredungskünsten, das Vertrauen des Ehepaares Bock zu erlangen, das die in Bad Sachsa inhaftierten Kinder im Juni 1945 in einem großen, mit Holzgas betriebenen Omnibus nach Süddeutschland gebracht hatte. Diese erzählten, am 5. Juni 1945 sei eine würdige ältere, aber sehr energische Rotkreuzoberin aufgetaucht, die den Abtransport der Kinder mit Hilfe der Amerikaner in die Hand genommen hätte. Frau Bock habe sich um die Lebensmittel für die lange Fahrt gekümmert. »Laut Ehepaar Bock seien die Kinder im NSV-Heim anständig behandelt worden«, resümierte der Bekannte der Gräfin Hardenberg.
Später organisierte Renate Gräfin Hardenberg, selbst Mutter von fünf Kindern, 1956 ein Treffen für Nachkommen zwischen 16 und 26 Jahren auf Burg Liebenzell. Dort saß eine Gesellschaft zur Förderung überkonfessioneller, überparteilicher und internationaler Zusammenarbeit. Renate Hardenberg gewann den Autor Eberhard Zeller, den ehemaligen Panzergeneral Gert Graf Schwerin und den persönlichen Referenten von Eugen Gerstenmaier, Hans Fritzsche, ehemals im Infanterie-Regiment 9 und jahrelang in sowjetischer Gefangenschaft, als Referenten. Graf Schwerin hatte nach einer Strafversetzung nach Norditalien vor der allgemeinen Kapitulation mit seiner Truppe kapituliert, um auf den aussichtslosen Kampf hinzuweisen. In den fünfziger Jahren hatte Graf Schwerin die Himmeroder Tagung vorbereitet, aus der die »Denkschrift über die Aufstellung eines deutschen Kontingents im Rahmen einer internationalen Streitmacht zur Verteidigung Westeuropas« hervorging.116
Unsicher, ob ihre Aktion überhaupt auf Resonanz stoßen würde, schrieb die Geschäftsführerin 182 »jugendliche« Nachkommen an, von denen fast die Hälfte, nämlich 73, kamen. Schon beim »Glühwein löste sich die Fremdheit«117. Die Nachkommen schlossen auf Grund ähnlicher Erfahrungen wichtige, mitunter lebenslange Freundschaften und genossen vor allem die vertrauensvolle Atmosphäre, in der sie diskutieren und Fragen stellen konnten, die ihnen auf dem Herzen lagen. Positiv wirkte sich dabei aus, dass die eingeladenen Referenten offen über Probleme sprachen und die Nachkommen mit Weggefährten ihrer Väter in Kontakt kamen, die ihnen diese näher bringen konnten. So berichtete Graf Schwerin davon, wie schwierig es sei, als Nachkomme von Widerstandskämpfern in der Bundeswehr aufgenommen zu werden; Eberhard Zeller, Autor des Buches Vom Geist der Freiheit118 riet den jungen Söhnen und Töchtern, sich mit den Fakten des Attentats vertraut zu machen, um sich gegen Angriffe wehren zu können. Mit ihrer Initiative hatte die Gräfin Hardenberg das Bedürfnis der Söhne und Töchter getroffen, die zu Hause oft nicht über ihre Sorgen und Nöte sprechen konnten. In einem Schreiben an die Teilnehmerin Friederike Richter äußerte sich Renate Gräfin Hardenberg selbst überrascht über den Erfolg: »Die Begeisterung übertrifft bei weitem meine Erwartungen«, schrieb sie und fügte hinzu: »Herr Fritzsche war tief gerührt, die Ähnlichkeit mit den Vätern in manchen Gesichtern wieder zu finden.«119
Auf Grund der großen Resonanz organisierte Gräfin Hardenberg im kommenden Jahr das nächste Treffen in Liebenzell – eine Tradition, die bis in die sechziger Jahre hinein weitergeführt wurde. Diesmal standen auch tagespolitische Fragen auf dem Programm.120 Hierzu hatte Gräfin Hardenberg führende Politikwissenschaftler eingeladen, wie Arnold Bergstraesser, der über die aktuelle Situation der Bundesrepublik in der Weltpolitik referierte. Hans Fritzsche steuerte einen Diavortrag über eine Asien-Reise von Eugen Gerstenmaier bei, während Eberhard Zeller bei abendlichen Kamingesprächen über »Deutschlands Politik in der veränderten Welt« referierte. Über diesen Vortrag entwickelte sich eine lebhafte Debatte, die zeigte, wie sehr sich die Nachkommen der Widerstandskämpfer für eine Demokratisierung der Bundesrepublik stark machten, nicht zuletzt, um das Erbe ihrer Väter weiterzuentwickeln. Für erhitzte Diskussionen sorgte vor allem Hans Fritzsche, der die »Bewältigung der jüngsten Vergangenheit« thematisierte. In seinem Beitrag bewertete Fritzsche die Entwicklung und den Aufstieg der rechtsradikalen Sozialistischen Reichspartei121 (SRP) und sprach über die Rolle von Hans Globke, der die Nürnberger Gesetze kommentiert hatte. Der persönliche Referent Gerstenmaiers erreichte mit seinen Ausführungen, dass die Teilnehmer offen über die Diffamierung ihrer Väter in ihrem eigenen Umfeld sprachen. Gleichzeitig artikulierten viele Teilnehmer der Tagung ihre Ängste, dass erneut ein rechtsradikales Regime die Führung in Deutschland übernehmen könne. »Beim Abendessen wich die Erregung nur langsam«,122 resümierte die Medizinstudentin Friederike Richter die erhitzte Debatte und fügte hinzu, dass beim abendlichen Tanz die Anspannung des Tages gewichen sei. Beim dritten Liebenzeller Treffen sprach der Präsident der deutschen Bundesbank, Karl Blessing, und versuchte die Frage zu beantworten, warum Hitler an die Macht gekommen war. Der Wiesbadener Rechtsanwalt Fabian v. Schlabrendorff erklärte das »Ethos der Männer des 20. Juli«. Die Teilnehmer diskutierten lebhaft über das Problem des Landesverrats und der Eidbindung, woran sich eine kontroverse Debatte über Atombewaffnung anschloss. Die Jugendtreffen entwickelten sich mehr und mehr zu einer Plattform für politische Zeitfragen, was dem Bedürfnis der zweiten Generation nach Klärung politischer Fragen entgegenkam. Eberhard Zeller hingegen fragte, ob in dieser Entwicklung tatsächlich die Zukunft der Jugendtreffen liegen könnte. In einem Schreiben an Gräfin Hardenberg hieß es: »Kommt die menschliche Einflussnahme, das Erzieherische, das, was Sie, glaube ich, einmal Lebenshilfe für die jungen Leute nannten, nicht zu kurz?«123 Die Gräfin ließ Eberhard Zeller wissen: »Ach wissen Sie, ich finde, dass wir doch eine ganze Menge durch die wiederholten Jugendtreffen erreicht haben.«124
In der Tat führten die Jugendtreffen dazu, dass die jungen Erwachsenen, die an den Treffen teilnahmen, lebenslange Verbindungen eingingen und sich für das Hilfswerk 20. Juli 1944 oder die 1973 gegründete Forschungsgemeinschaft 20. Juli einsetzten. So liest sich die Teilnehmerliste der Jugendtreffen wie eine Liste der Personen, die sich später im Hilfswerk oder der Forschungsgemeinschaft engagierten und dieses Interesse auch an ihre Kinder, das heißt an die Enkelgeneration, weitervermitteln konnten. So nahmen der gleichnamige Sohn Helmuth v. Moltke, Friedrich Wilhelm v. Hase, Axel Smend, Rüdiger v. Voss, Wilhelm Graf Schwerin, Günther Habermann ebenso an dem Treffen 1957 teil wie Walter Bonhoeffer, Peter Finckh und Fritz Graf v. d. Schulenburg.
»Das Hilfswerk hat in den ersten 25 Jahren viel für die Nachkommen der Attentäter getan«, erzählt Christine Blumenberg-Lampe, die als Tochter des Freiburger Wirtschaftswissenschaftlers Adolf Lampe die Forschungsgemeinschaft bis zum Jahr 2004 leitete. Besonders wichtig sei für ihre Generation der Raum für Gespräche und das Kennenlernen von jungen Menschen mit einem ähnlichen Schicksal gewesen. Nach dem Tod der Gräfin Hardenberg übernahm die Witwe von Adolf Lampe, Gertrud Lampe, 1960 die Geschäftsführung des Hilfswerks. Damit verlagerten sich die Schwerpunkte. Gertrud Lampe stellte das Zusammenwachsen Europas in den Mittelpunkt der Treffen.
In den sechziger Jahren veranstaltete das Hilfswerk mehrere Jugendtreffen als Reisen, die unter anderem nach Straßburg, Aachen und Brüssel führten, wo die Nachkommen die Europäische Gemeinschaft, die NATO und den Europarat besichtigten. Die Begegnungen waren von dem Geist der Versöhnung zwischen den Völkern bestimmt. So legten beispielsweise die Nachkommen der Attentäter einen Kranz für die belgische Resistance nieder und führten in der deutschen Botschaft in Brüssel Gespräche mit belgischen Angestellten, die von den Deutschen in Konzentrationslager gebracht worden waren. Anschließend fuhr die Gruppe nach Valkenberg, wo in den letzten Kriegstagen belgische Untergrundkämpfer erschossen worden waren. Wie auch die Jugendtreffen finanzierte das Hilfswerk die Reisen in erster Linie aus Spenden. Für viele Teilnehmer wurden die Reisen zu prägenden Erlebnissen. Neben der Völkerversöhnung förderte das Hilfswerk auch das politische Verständnis und Interesse der Nachkommen, nicht zuletzt, um sie auf Karrieren oder Möglichkeiten in Europa vorzubereiten. Spätere Reisen führten nach Paris, Grenoble, Oradour und Limoges. In Oradour-sur-Glane hatte die SS am 10. Juni 1944 ein Massaker unter der französischen Bevölkerung angerichtet, als Repressalie gegen die französische Widerstandsbewegung. Die SS hatte die Bevölkerung des kleinen Ortes in die Kirche getrieben und diese danach angesteckt. »Wir waren eine der ersten deutschen Gruppen, die den Ort nach dem Massaker besucht haben«, erinnert sich Christine Blumenberg-Lampe.
1963 regte der Staat Israel eine dreiwöchige Reise durch den neu gegründeten Staat an, die in erster Linie dazu dienen sollte, die Vorurteile der Israelis nach dem Eichmann-Prozess zu überwinden. Als »Botschafter« für ein anderes Deutschland waren die Söhne und Töchter der Regimegegner geeignet. Das Hilfswerk unterstützte die Reise mit Spenden. Erstmals mussten die rund 30 Söhne und Töchter einen kleinen Beitrag selbst entrichten.125 Die Reise führte vom Toten Meer durch die damals noch umkämpfte Negev-Wüste nach Jerusalem und Tel-Aviv. An der Reise nahmen rund dreißig Teilnehmer teil. »Es war höchst spannend und aufregend für uns«, erzählt Christine Blumenberg-Lampe. Die Israel-Reise war der Höhepunkt der Tagungsreisen.
1973 endeten die Jugendtreffen. Die zweite Generation war selbst erwachsen geworden, hatte erste Berufserfahrungen gesammelt, geheiratet und Kinder bekommen. Dennoch ließ die Vergangenheit viele Nachkommen nie ganz los. In einem Artikel für die Deutsche Tagespost von 1987 bemerkte der langjährige Präsident der Forschungsgemeinschaft 20. Juli, Rüdiger v. Voss: »Die Schatten des Todes reichen weit. Kennzeichnend für fast alle Kinder, die ich kenne, ist eine tiefe persönliche Betroffenheit, mit der zu leben nicht einfach ist.«126 Die Schatten des Todes, vor allem aber die eigene Lebenserfahrung, ließen so manchen der zweiten Generation in eine andere Richtung gehen, als es die Mütter und die wenigen Überlebenden vorhergesehen oder bisweilen gewünscht hätten. In den späten sechziger Jahren spielte sich deshalb auch unter den Nachkommen des 20. Juli ein Generationenkonflikt ab, der deutlich von der Studentenrevolte geprägt war. Im Vergleich zu der vorsichtig gewordenen ersten Generation wollten viele Nachkommen der zweiten Generation mehr oder weniger bewusst das Erbe ihrer Väter fortsetzen, indem sie sich politisch und sozial betätigen. Dabei brach unter den Nachkommen ein mit Vehemenz geführter Streit über den wahren Charakter des Widerstandes aus, fast als wollten die Söhne und Töchter stellvertretend für die hingerichteten Väter die politischen Diskussionen der Nachkriegszeit führen. Höchstwahrscheinlich wäre es zu diesen Auseinandersetzungen auch unter den Vätern gekommen.