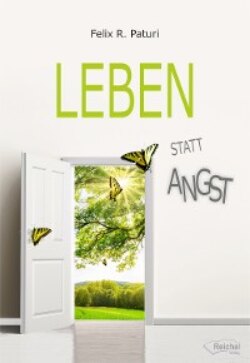Читать книгу Leben statt Angst - Felix R. Paturi - Страница 13
Gehirnentwicklung durch Spezialisierung
ОглавлениеDabei stellt sich zunächst die Frage: Woher kommen Ängste überhaupt? Es zeigt sich, dass es vielerlei Ursachen geben kann. Da sind einmal die Grundängste, die wir gleich bei der Geburt mitbekommen. Das ist nichts Schlechtes.
Unser Gehirn entwickelt seine „Persönlichkeit“ im Kindesalter. Das geschieht nicht durch theoretisches Lernen, sondern nur dadurch, dass wir Fehler machen, sie erkennen und korrigieren, also durch persönliches Üben.
In den letzten Jahrzehnten hat vor allem die Neurologie erkannt, wie sich bei einem Kind von Geburt an bis etwa ins 15. – in mancher Hinsicht bis etwa ins 20. – Lebensjahr das Gehirn entwickelt und dabei differenziert. Neudeutsch ausgedrückt ließe sich sagen: In dieser Zeit spielt sich die „Hardware“-Programmierung des Gehirns ab. Dabei werden intellektuelle Fähigkeiten wie das Sprachvermögen, die Gedächtnismechanismen, Entscheidungsfähigkeiten und so weiter ebenso festgelegt, wie emotionale und künstlerische Qualitäten: Umgang mit Gefühlen, Körpersprache, Musikalität und viele andere. Im Erwachsenenalter ist eine Umprogrammierung der „Hardware“ sehr schwierig und in mancher Hinsicht gar nicht mehr möglich.
Babys sind „Generalisten“. Sie besitzen Anlagen zu vielen Fähigkeiten, die beim Erwachsenen verkümmert sind, weil er sie nicht weiterentwickelt hat. In seinem speziellen Lebensraum braucht er sie nicht. Das trifft auch auf Ängste zu. Die Palette angeborener Ängste wird durch Erziehung und soziales Umfeld punktuell verstärkt oder abgebaut.
Diese Gehirnstrukturierung erfolgt nach bestimmten Spielregeln. Am wichtigsten dabei ist das Lernen aus Fehlern, die „Trial and Error“-Methode, wie das heute international heißt. Versuchen, sich dabei zu irren und aus den eigenen Fehlern zu lernen, ist unentbehrlich für eine gesunde Entwicklung des Gehirns. Allein durch verbales Unterrichten seitens der Eltern, Kindergärtnerinnen, Lehrer und aus Büchern, kann sich kein wirklich autark funktionsfähiges Gehirn und damit kein freier, selbstbestimmter Mensch entwickeln. Überängstliche Eltern und dem schulischen System intellektueller Belehrung verhaftete Pädagogen sind eine der Hauptquellen späterer intellektueller Unselbstständigkeit ihrer Zöglinge und damit auch für viele ihrer Lebensängste verantwortlich. Wer nicht Herr einer Situation ist, bekommt Angst.
Eine zweite wichtige Erkenntnis der Neurologen ist, dass wir von Geburt an vieles durch Abbau, nicht durch Aufbau von Fähigkeiten lernen, was für die Lebenstüchtigkeit in unserem spezifischen Kulturkreis erforderlich ist. Einem Kind, das bei einem kriegerischen Urwaldstammesvolk groß wird, steht bei Geburt die gleiche Palette an vielfältigen Fähigkeiten zur Verfügung wie einem Kind, das in einer europäischen Professorenfamilie oder in einem international arbeitenden Zirkus-Clan heranwachsen wird. Der Unterschied der neuralen Entwicklung liegt vor allem darin, dass jedes der Kinder die an sich vorhandenen Anlagen, die es in seinem spezifischen Alltag nicht braucht, verkümmern lässt und die benötigten Anlagen ausformt und weiterentwickelt. Das Gehirn spezialisiert sich.
So kommt beispielsweise so gut wie jedes Baby mit dem perfekten Gehör auf die Welt. Die meisten Erwachsenen in unserem Kulturkreis haben diese Fähigkeit unwiederbringlich verloren, denn spätestens mit Schulbeginn werden unsere Wahrnehmungen weitgehend auf den logischen Informationsgehalt von Geräuschen (etwa der Sprache) gelenkt und nicht auf musikalisches Kolorit und den Wohl- oder Missklang von Tonintervallen. Wird dasselbe Kind in einer Musikerfamilie groß oder in einem Land wie China, dem die Tonhöhe ein und desselben gesprochenen Wortes wesentliche Informationen liefert, dann bleibt sein absolutes Gehör nicht nur erhalten, es wird verfeinert.
Ähnlich ist es mit dem Kehlkopf und den Stimmbändern. Die Anatomie eines Babys erlaubt es, sämtliche sprachlichen Geräusche aller Idiome der Welt zu erlernen. Aber schon das Kleinkind, das vorwiegend durch Nachahmen lernt, übt fortwährend nur die Sprachgebungen, die es von seinen Eltern und Geschwistern hört, und dazu gehören etwa in Deutschland nicht gerade die gutturalen Klangbilder, die zum Beispiel ein Araber beim Sprechen erzeugt. Jedes Kleinkind kann etwa bis zum zweiten oder dritten Lebensjahr die Klangfarben aller Sprachen der Welt erlernen, danach geht das nicht mehr, denn dann ist bereits das Gehirn, das schließlich auch die Stimmbänder steuert, in dieser Hinsicht irreversibel programmiert.
Das geht so weit, dass zum Beispiel die erwachsenen Europäer in der linken Großhirnhälfte logische Prozesse verarbeiten und in der rechten Hälfte emotionale Eindrücke auswerten, während sich das bei einem Japaner genau umgekehrt verhält. Diese Gehirnregionen-Belegung ist nicht etwa durch die Rasse bedingt, also genetisch festgelegt, sondern wird in den ersten Lebensjahren durch Gehirnstrukturierung „hardware-programmiert“. Die Sprache und ihre Lautformung spielen dabei eine äußerst wichtige Rolle. Dieses Programmieren geschieht durch Abbau – beziehungsweise Nichttrainieren – von im eigenen Kulturkreis Überflüssigem.
So kommt zum Beispiel auch jedes Kind mit einem angeborenen umfassenden sprachlichen Grammatikgefühl zur Welt. das spezielle Gefühl für die Grammatik der Muttersprache, das sich bis etwa zum 15. Lebensjahr daraus entwickelt, erfolgt nicht durch aufbauendes Lernen, sondern durch Reduktion der angeborenen einfachen Universalgrammatik auf die landesspezifischen Feinheiten. Alles Überflüssige wird nicht geübt, sondern fortgelassen und schließlich gründlich vergessen.