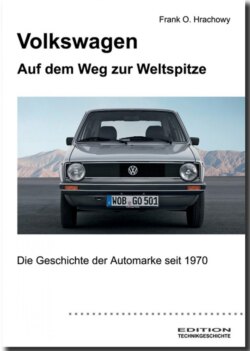Читать книгу Volkswagen – Auf dem Weg zur Weltspitze - Frank O. Hrachowy - Страница 10
Die neue Modellgeneration
ОглавлениеUnterdessen änderte sich die währungspolitische Situation auf der Welt dramatisch, was gerade der in Deutschland beheimatete VW-Konzern deutlich zu spüren bekam. So notierte der Dollar gegenüber der Deutschen Mark immer schwächer, was die Preise für die aus Deutschland in die USA exportierten VW-Modelle stetig in die Höhe trieb. Die Auswirkungen auf die Ertragslage der Wolfsburger waren deutlich, denn immerhin wurden rund ein Drittel der jährlich gebauten 1,9 Millionen VW-Fahrzeuge nach Nordamerika geliefert. In dieser Notlage wurde ernsthaft über den Bau eines eigenen VW-Werks in den USA diskutiert.
Während der Dollarkurs immer weiter sank und sich die Währungskrise verschärfte, erschien im Mai 1973 mit dem auf dem Audi 80 basierenden VW Passat schließlich eine ganz neue Mittelklasse-Limousine aus Wolfsburg, die jegliche optische Altbackenheit, aber auch jegliche technische Rückständigkeit abgelegt hatte. Dazu konkretisiert der VW-Konzern aus heutiger Perspektive auf seinem Portal VOLKSWAGEN CLASSIC: »Nach dem ebenfalls wassergekühlten und frontgetriebenen K 70 wird jetzt eine wesentliche Eigenentwicklung vorgestellt, der neue Passat. Aus Gründen der damals noch andauernden Konzernkrise werden die Produktionskosten durch Übernahme von Plattform und Aufbau des ein Jahr zuvor erschienenen Audi 80 (Design: Hartmut Warkuß) niedrig gehalten.«17
Optisch wurde der VW Passat als eigenständiges Fahrzeug wahrgenommen, weil der italienische Designer Giorgio Giugiaro den Audi 80 geschickt mit einem Schrägheck versah, das die Limousine nicht als Kopie wirken ließ. Der Passat verfügte im Gegensatz zu den Modellen 1600 und 411/412 über einen wassergekühlten Motor mit Zahnriemen, der nicht mehr im Heck arbeitete, sondern als moderner Fronttriebler die Vorderräder antrieb.
Die Markteinführung wurde innerhalb des VW-Konzerns mit angehaltenem Atem begleitet, denn: Der Passat bildete den »Grundstein« für alle weiteren modernen Fronttriebler-Modelle, die später mithilfe eines kostensparenden Baukastensystems gefertigt werden sollten. Durch eine hohe Anzahl von Gleichteilen, die in verschiedenen Modellen des VW-Konzerns verbaut würden, wollten die Planer die Produktionskosten drastisch senken.
Doch der Passat sollte nicht nur Grundstein sein, sondern auch finanzieller Rettungsanker. Würde der Passat in seiner Konzeption scheitern, dann wäre VW finanziell wohl kaum zu retten. Von den Autofahrern wurde der VW Passat jedoch sofort akzeptiert und vor allem auch bestellt – 750 Stück rollten dementsprechend schon zu Anfang von den Fließbändern. Im Gegensatz zu den alten Modellen 1600 und 412 war der VW Passat für den erfolgreichen Opel Ascona nun ein Wettbewerber auf Augenhöhe.
Im Zuge der Umstellung auf die kommende, mit dem Passat eingeleitete neue Modellgeneration hieß es weiter Abschied nehmen von Vertrautem. Nach 445.295 gebauten Karmann Ghia wurde im Juli 1973 die Produktion eingestellt. Zum Abschied schreibt die VW AG in ihrer Publikation DAS BUCH gleichermaßen treffend wie wehmütig über das Karmann Ghia Cabrio: »Mit seiner italienischen Eleganz kurvte es über die Farbseiten der eleganten Magazine, und wo ein Filmregisseur Jugend, Schönheit und Heiterkeit ins Bild bringen wollte, da musste der Karmann durch die Szene rollen: Der löste alle gewünschten Gefühle aus.«18
Geprägt wurde das Jahr 1973 durch die im Herbst beginnende Ölkrise, bei der die Organisation der Erdöl exportierenden Länder (OPEC) die Fördermengen drosselte, um die westlichen Länder politisch unter Druck zu setzen. Die dadurch steigenden Energiepreise verursachten eine Schwächung der Konjunktur und führten die westlichen Länder in eine Wirtschaftskrise, von der alle wichtigen Industrienationen betroffen waren. Parallel dazu verschärfte der steigende Ölpreis die Inflation, wodurch die US-Wirtschaft sogar in eine Stagflation (wirtschaftliche Stagnation gepaart mit Inflation) geriet. In Deutschland markierte die Ölkrise das Ende des Wirtschaftswunders.
Kurioserweise stieg in den USA die Nachfrage nach dem Käfer wieder stark an – wegen der Ölkrise wollten immer weniger Nordamerikaner einen spritschluckenden »Gas Guzzler« mit V8-Motor fahren. So wurden trotz der massiven Preiserhöhungen der VW-Fahrzeuge durch die veränderten Wechselkurse Ende 1973 in den USA mehr VW Käfer bestellt als aus Deutschland lieferbar waren. Stuart Perkins, der Präsident der Vertriebsfirma Volkswagen of America, beklagte, dass die Nachfrage um rund 15 Prozent gestiegen war, aber aufgrund des zu geringen Nachschubs aus Wolfsburg nur 6 Prozent mehr Fahrzeuge ausgeliefert werden konnten.
Im Zuge der Ölkrise stiegen nicht nur die Preise für Kraftstoff und Heizöl in ungekanntem Maße, auch wurde in Deutschland ernsthaft über ein Tempolimit auf Autobahnen diskutiert. Fakt waren die verordneten autofreien Sonntage, an denen es vom Gesetzgeber her verboten war, das Auto zu benutzen. Zur Dramatik dieser Situation schreibt die VW AG in ihrer Publikation DAS BUCH: »Die Zukunft des Autos scheint in Frage gestellt. Weltweit fallen die Verkaufszahlen in den Keller. Unter den Menschen an den Standorten von Volkswagen geht die Angst um. [...] Die Älteren beschwören die Entsetzensbilder der Massenarbeitslosigkeit herauf. Den Jüngeren wird erstmals bewusst, wie der Boden schwankt, auf dem sie leben und arbeiten.«19
In Folge traten Unternehmensleitung und Gewerkschaft in lange Verhandlungen. Dabei wurde für das Frühjahr 1974 Kurzarbeit vereinbart. Auch die Aktionäre wurden für das Jahr 1974 auf rote Zahlen vorbereitet, allerdings erhielten sie trotz unverändert im Wert fallender VW-Aktien für das Jahr 1973 noch eine Dividende von 4,50 Mark (ca. 2,25 Euro). So ging nicht nur bei VW das Jahr 1973 wirtschaftlich trostlos zu Ende, zumal eine Besserung der Krise nicht in Sicht war. Die Hoffnung lag auf den angekündigten neuen Modellen, für die der Passat den Weg bereitet hatte. Als nächster Coup wurde der Serienanlauf des Entwicklungsmodells EA 337 erwartet. Der endgültige Name für das kompakte Volkswagenmodell war mittlerweile auch schon bekannt geworden: »Golf« sollte es heißen.
Tatsächlich war es langsam an der Zeit, dieses Projekt zu einem Ende zu bringen, denn seit mehreren Jahren wurde an einem Nachfolger des VW Käfer mehr oder minder fruchtlos herumentwickelt. Die Geschichte des VW Golf hatte eigentlich schon im Mai 1968 begonnen, als VW-Konzernlenker Heinrich Nordhoff 36 Prototypen und Styling-Studien ohne Motor für einen Käfer-Nachfolger hatte konzipieren lassen. Doch es wurde bald klar, dass Nordhoff eigentlich keine rechte Notwendigkeit zur Ablösung des Typ 1 sah. Erst sein Nachfolger Kurt Lotz hatte Ende 1969 den Projektstart für ein Nachfolgemodell festgelegt, das technisch und optisch nichts mehr mit dem VW Käfer gemein haben sollte.
Unterdessen wurde das Gerücht immer lauter, dass das Ausgangsmodell des VW Golf in der DDR entwickelt worden sei. So absurd diese Behauptung klang, so machten die vorgelegten Fotographien des DDR-Ausgangsmodells doch stutzig. Unbestreitbar war beispielsweise, dass die kantig geformten Prototypen des Kompaktwagens Trabant P603 mit Fließheck und MacPherson-Fahrwerk konzeptionell sehr nahe am neuen Golf lagen. Ausgerüstet worden waren die Trabant-Prototypen mit neun verschiedenen Motoren, angefangen von alten Zweitakt- über Viertaktaggregaten bis hin zu einem Wankelmotor.
Unstrittig war auch, dass das ostzonale Politbüro die Weiterentwicklung des Fahrzeugs für den DDR-Markt offiziell 1967 gestoppt hatte – somit zeitlich genau vor dem Beginn der ersten Entwicklungsarbeiten am VW Golf.20 Eigenartig war zudem, dass auch der VW Passat den Prototypen des Fließheck-Modells 355 des zweiten großen Automobilherstellers der DDR, dem VEB Automobilwerk Eisenach, verblüffend ähnlich sah. Und seltsam war auch hier wieder der zeitliche Zusammenhang, denn obwohl die Arbeiten an den Wartburg-Prototypen weit fortgeschritten waren, war auch hier die Entwicklung auf Weisung des Politbüros 1968 plötzlich eingestellt worden.21
So machte das Gerücht die Runde, dass ein hochrangiger Mitarbeiter des Fahrzeugwerks VEB Sachsenring bzw. des VEB Automobilwerks Eisenach mit den Konstruktionsplänen in die BRD geflohen sei. Ein anderes Gerücht besagte, dass die Pläne des schon weit entwickelten Fahrzeugs heimlich an VW verkauft worden seien, um Devisen in die wirtschaftlich darbende DDR zu bringen. Andere berichteten von geheimen Testfahrten der VW-Ingenieure, die die Prototypen ausgiebig im Umland der DDR-Fahrzeugwerke testeten. Indes: Im Osten wie im Westen wurde zu diesen Gerüchten kategorisch geschwiegen [...].
Der mit dem VW K 70 und dem VW Passat eingeläutete Wandel setzte sich bei VW nicht nur fort, er steigerte sich mit der Markteinführung einer komplett neuen Modellpalette. Dem erfolgreich etablierten Passat folgte im Frühjahr 1974 das 2+2-sitzige Sportcoupé Scirocco (Typ 53 Coupé) als Nachfolger des betagten Karmann Ghia Typ 14. Straff, mit klaren Kanten und ohne Schnörkel gezeichnet, folgte der Scirocco einer neuen Ästhetik, die mit der Formgebung des Karmann Ghia nichts mehr gemeinsam hatte. Die Eleganz und Noblesse hingegen, die dem Karmann Ghia zu Eigen waren, ließ das neue Sportcoupé vermissen.
Als Mitglied der neuen Modellfamilie verfügte der Scirocco ebenfalls über einen wassergekühlten, quer eingebauten Frontmotor sowie Vorderradantrieb. Entwickelt worden war der ebenfalls von Giorgetto (Giorgio) Giugiaro gestaltete Scirocco bei Karmann in Osnabrück, wo er auch gebaut werden sollte. Die technische Basis für den Scirocco bildete der neue VW Golf, der in den Startlöchern stand und dessen Markteinführung mit Spannung erwartet wurde.
Natürlich war auch der Scirocco in das neue, kostensparende Baukastensystem eingebunden. Hierzu wurden in einem VW-internen Besprechungsbericht folgende Gleichteile festgelegt: »Zum Lieferumfang von Volkswagen und damit zu den Gleichteilen mit dem späteren Golf zählten Motor, Motor-Elektrik, Getriebe und Kupplung, Aggregate-Lagerung, Lenkung, Hinterachse, Bremsen, Hand- und Fußhebelwerk, Kraftstoffbehälter, Räder und Reifen, Schlösser, Griffe, Dichtungen, Fensterheber und Scharniere, Heizung und Lüftung sowie die Elektrik.«22
Das 2+2-sitzige Coupé startete mit drei verschiedenen Motoren, die 50, 70 oder 85 PS (37, 51 oder 62 kW) leisteten. Im Gegensatz zu den Motoren im Opel Kadett waren alle VW-Motoren moderne Konstruktionen mit Zahnriemen und obenliegender Nockenwelle. Hinzu kamen die drei Ausstattungsvarianten N als Grundmodell, L mit mehr Luxus, darüber S und TS mit stärkeren Motoren und aufgewerteter Ausstattung. Das Sportmodell TS verfügte obendrein über markante Doppelscheinwerfer anstatt der Rechteckleuchten.
Zum schwierigen Serienanlauf des Scirocco bei Karmann schreibt VW: »Allerdings konnte die ursprünglich geplante Anlaufkurve von annähernd 70 Fahrzeugen pro Tag nicht gefahren werden, da die Materialversorgung aufgrund von Lieferschwierigkeiten nicht für diese Stückzahlen ausreichte. Nach nur vier Produktionswochen musste der Ausschuss für Produktplanung dem Vorstand berichten, dass aufgrund von zulieferungs- und organisationsbedingten Schwierigkeiten weniger als die Hälfte der ursprünglich geplanten 1.200 Fahrzeuge bei Karmann vom Band gelaufen waren. Keines der 524 im Februar 1974 produzierten Fahrzeuge hatte den Zählpunkt 8 und damit die den Fertigungsprozess abschließende Qualitätskontrolle überquert. Fehlteile, aber auch Montagefehler sorgten dafür, dass sämtliche in den ersten acht Wochen der Serienfertigung produzierten Fahrzeuge noch komplettiert werden mussten. Die Abstellplätze füllten sich.«23
Schon am 29. März begann in Wolfsburg die Serienproduktion des Kompaktmodells Golf. Die Fertigung des VW Käfer, der parallel zum Golf im Verkaufsprogramm blieb, wurde nach Emden und Hannover verlagert. Theoretisch gesehen waren VW Käfer und VW Golf in der gleichen Fahrzeugklasse positioniert – aber optisch, technisch und auch vom Image her gab es nicht viele Gemeinsamkeiten. Kurios: Um Baukosten zu sparen, wurden die ersten Golf in der 50 PS-Variante an der Vorderachse mit Trommelbremsen ausgerüstet, womit gleichzeitig der Bremskraftverstärker entbehrlich wurde. Erst ab April 1975 sollten serienmäßig Scheibenbremsen vorne und ein Bremskraftverstärker eingebaut werden.
Wie wichtig es war, den Golf im Reigen der Wettbewerber möglichst kostengünstig zu positionieren, zeigt ein Interview mit seinem Designer Giorgetto Giugiaro. Auf die Interviewfrage, warum denn die eckigen Scheinwerfer der ersten Entwürfe des Golf in der Serienfertigung durch runde Exemplare ersetzt wurden, antwortet der italienische Designer ganz unverblümt: »Ja, tatsächlich eine wesentliche Änderung – aus Kostengründen. Rundscheinwerfer waren damals erheblich preiswerter in der Herstellung als rechteckige. Ursprünglich hatte ich die Rechteckscheinwerfer in Dimension und Anordnung als Spiegelbild der Heckleuchten vorgesehen. Aber das kostete zu viel, und so musste ich die runden Scheinwerfer nehmen.«24
Insgesamt war das VW-Lager zweigeteilt: Einige Mitarbeiter, Händler und Kunden sahen immer noch keine rechte Notwendigkeit für ein hauseigenes Konkurrenzmodell zum bewährten Käfer – viele Andere hingegen hatten mittlerweile erkannt, dass das Käfer-Konzept in jeder Hinsicht an seine Grenzen gestoßen war. Technisch konkreter: Auch wenn die Vorderachse des Käfer jüngst auf Scheibenbremsen und MacPherson-Federbeine umgerüstet worden war, änderte das nichts an der Tatsache, dass die Wettbewerber mit moderneren Konzepten aufwarteten.
Bei näherer Betrachtung musste dieser Schritt vom Käfer zum Golf geschehen, denn er war längst überfällig. So war der neue Golf mit seiner selbstragenden Karosserie um 165 Kilogramm leichter als der Käfer – und das trotz schwerer Wasserkühlung. Hinzu kam ein Benzinverbrauch, der rund 20 Prozent niedriger lag als beim Käfer, dessen luftgekühlter Motor prinzipbedingt mehr Kraftstoff benötigte. Ein weiterer wichtiger Aspekt waren die Produktionskosten. Der VW Golf ließ sich weitaus rationeller fertigen, außerdem lag sein Verkaufspreis rund 600 Mark über dem des Käfer. Damit war der Golf sehr viel margenstärker als sein Vorgänger.
Doch auch wenn der Passat und der Golf mit ihrem Frontantrieb und Schrägheck unbestritten Meilensteine bei der Modernisierung der Modellpalette von VW waren – neu war dieses Konzept nicht. Der englische Mini machte es längst vor; Simca zeigte seit 1967 mit dem hervorragend konzipierten Modell Simca 1100, wie ein Kompaktmodell aussehen konnte; unter anderem hatten Alfa Romeo, Renault und einige weitere Hersteller die Vorteile dieses Fahrzeugkonzepts längst erkannt.
Offen und klar ausgedrückt: Der VW Golf begründete beileibe nicht die »Golf-Klasse« und er setzte mitnichten irgendeinen technischen Meilenstein, vielmehr schloss VW mit dem Golf auf den längst gültigen Stand der Technik auf, dem die VW-Modelle jahrelang hinterhergehinkt waren. Diesen Sachverhalt dokumentierte das Fachmagazin AUTO MOTOR UND SPORT bei einem zeitgenössischen Vergleichstest: »Obwohl der Golf schon kurz nach seinem Start die deutsche Neuzulassungsstatistik anführt, können die wichtigsten Konkurrenten durchaus Paroli bieten. So setzt der Alfasud bei Raumausnutzung und Kompaktheit Maßstäbe [...] . Noch besser und sehr geschickt auf die Federung abgestimmt sind die Polster im gut ausgestatteten Citroën GS. [...] Mit Frontantrieb und quer eingebautem Reihenmotor folgt der Golf dem Konzept des schon lange gebauten Simca 1100.«25
Die Vorteile des Frontmotorkonzepts lagen dabei vorrangig in einer günstigeren Fertigung, da Motor, Getriebe, Differenzial und Achswellen kompakt in einem Block zusammengefügt und montiert werden konnten. Der teure Antrieb mit Kardanwelle ließ sich so sparen. Durch die kompakte Bauweise wurden die Fahrzeuge zudem innen deutlich geräumiger, überdies störte kein Kardantunnel mehr im Innenraum. Dass sich das Fahrverhalten gravierend verbesserte, war dabei mehr als ein Nebeneffekt. Gegenüber dem Käfer, der mit seinem Heckmotor als tückischer Übersteuerer verrufen war, präsentierte sich der Golf als gutmütiger Untersteuerer.
Wer dieses kompakte Baukonzept, das viele greifbare Vorteile in sich vereinigte, nicht vorweisen konnte, war Opel. Obwohl der Kadett C gerade erst im August 1973 eingeführt worden war, blieb er mehr oder weniger der alten Technik seiner Vorgänger verhaftet. Das war ein klarer Wettbewerbsnachteil, denn neben den für den Kunden erfahrbaren Vorteilen lockte das neue Konzept (Frontmotor und Frontantrieb) mit Einsparungen bei den Produktionskosten von bis zu 15 Prozent. Gerade im kostensensiblen Segment der Kompaktklasse war das ein wichtiges Argument.
Mit der Einführung des VW Golf wurde Opel nun vom Treibenden zum Getriebenen. Erstmals ließ es sich nicht mehr schmunzelnd auf den technisch veralteten VW Käfer blicken, vielmehr mussten die GM- und Opel-Manager feststellen, dass sie jetzt technisch ins Hintertreffen geraten waren. Und ausgerechnet Erzrivale VW hatte sie überholt. Damit rächte sich die relativ behutsame Weiterentwicklung, die dem Kadett im letzten Jahrzehnt widerfahren war. Wohl war er in allen Dimensionen gewachsen und dabei auch innen geräumiger geworden, gleichzeitig hatte er sich optisch stark verändert – doch unter dem Blech hatten die Ingenieure letztlich am alten Konzept von 1962 festgehalten.
Der Verkaufserfolg der neuen Modelle Passat, Scirocco und Golf konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass bei VW die wirtschaftliche Lage sehr ernst geworden war. Hierzu hatte nicht nur die Ölkrise beigetragen; auch die enormen finanziellen Aufwendungen, die zur Entwicklung der neuen Modellfamilie notwendig gewesen waren, schlugen sich in der Bilanz nieder. Der VW-Vorstand musste nun unverzüglich handeln, denn der massive Personalüberhang war mittels Kurzarbeit und Einstellungsstopp nicht schnell genug abzubauen. Eine großangelegte Aktion mit altersunabhängigen Aufhebungsverträgen, hohen Abfindungen und vorzeitigen Pensionierungen sollte schnell Linderung schaffen. Doch diese Aktion konnte die weiter steigenden Verluste nur begrenzt aufhalten.
VW-Chef Rudolf Leiding, der über viele Monate versucht hatte, den Bau eines eigenen Werk in den USA durchzusetzen, um dort kostengünstiger und von den schwankenden Wechselkursen unbeeinflusst Fahrzeuge bauen zu können, trat im Dezember 1974 von seinem Posten zurück. Der Widerstand des VW-Aufsichtsrats und des Landes Niedersachsen gegen diese Pläne war zu stark – zu groß war die Angst vor dem Verlust von Arbeitsplätzen in den deutschen Produktionsstätten. Die Nachfolge von Rudolf Leiding übernahm Toni Schmücker, der schon den Essener Rheinstahl-Konzern erfolgreich saniert hatte. Aufhorchen ließ sein Spitzname »Toni, der Trickser«.
Die Situation wurde Ende 1974 immer bedrohlicher, und immer noch war keine Besserung in Sicht. In greifbaren Zahlen ausgedrückt: Im Jahr 1974 hatte der Volkswagen-Konzern 807 Millionen Mark (ca. 400 Millionen Euro) Verlust eingefahren. Dabei waren die Verkaufszahlen von VW in Deutschland um 15 Prozent, in dem für den Konzern besonders wichtigen US-Markt sogar um knapp 30 Prozent zurückgegangen. Auf weiträumigen Parkplätzen standen immer mehr VW-Fahrzeuge auf Halde, die zwischenfinanziert werden mussten.
Immerhin stand Ende 1974 für den schlimmsten Fall noch eine Option offen, die aber nur hinter vorgehaltener Hand diskutiert wurde. Hierzu konkretisierte DER SPIEGEL: »Unter Eingeweihten kursiert ein Plan, nach dem die VW-Volksaktionäre, deren Papiere heute nur noch die Hälfte des einstigen Ausgabekurses wert sind, eines Tages von Bonn zum Einstandskurs entschädigt werden und VW nach dem Muster der französischen Regie Renault ein reines Staatsunternehmen wird.«26
Wie es mit der Weltwirtschaft, mit der deutschen Industrie und mit VW im Jahr 1975 weitergehen würde – das war im Dezember 1974 die große Frage. Als Hoffnung für die VW-Angestellten blieb immerhin die Tatsache, dass die Markteinführung der neuen Modellgeneration gelungen war, und der Passat, der Scirocco und der Golf von den Kunden akzeptiert wurden.