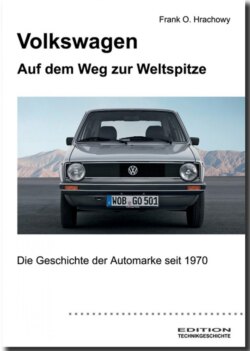Читать книгу Volkswagen – Auf dem Weg zur Weltspitze - Frank O. Hrachowy - Страница 12
Verkaufsboom und neue Märkte
ОглавлениеDie Verkaufszahlen zeigten sich 1977 weiterhin so gut, dass das deutsche Kartellamt aktiv wurde und die Autohersteller VW, Opel und Ford vor einer überzogenen Preiserhöhung warnte. Erst nach langen Verhandlungen einigten sich die Hersteller und das Kartellamt auf eine gemäßigte Erhöhung der Neuwagenpreise um rund 4 Prozent. Im Frühjahr 1977 stiegen die Autoverkäufe aller deutschen Hersteller in ungewohnt starker Weise an, so dass bei Ford, Opel und Volkswagen Sonderschichten notwendig wurden.
Damit hatte VW-Chef Toni Schmücker plötzlich mit ganz anderen Problemen zu kämpfen als noch vor zwei Jahren. Denn erstens waren mittlerweile viele VW-Modelle nur mit einer Lieferzeit von mehreren Monaten erhältlich, manche Modelle wie der unerwartet erfolgreiche Golf GTI sogar mit einer Lieferzeit von einem ganzen Jahr. Auch bei den anderen Volumenherstellern Opel und Ford wurde seit Monaten mit Sonderschichten an der Grenze der Fertigungskapazität produziert. Bei VW kam aber noch ein zweites Luxusproblem hinzu: Sollte der VW-Marktanteil auf 35 Prozent steigen, dann müsste das Kartellamt mit Sanktionen einschreiten, weil VW damit eine marktbeherrschende Stellung einnehmen würde.
Eher für Unverständnis und Belustigung sorgte hingegen die Meldung, dass VW-Chef Toni Schmücker ausgerechnet den 1928 geborenen Designer Luigi Colani (eigentlich Lutz Colani) nochmals beauftragt haben sollte, für die Volkswagenwerk AG einen modernen Kleinwagen zu entwickeln. Schon 1976 war Colani mit einem solchen Entwurf beauftragt worden, doch sein vorgestellter, grotesk geformter »Turbo Polo Concept« war optisch, technisch und konzeptionell weit von einem Fahrzeug entfernt gewesen, das in Serie gehen konnte.
In Anbetracht des gleichermaßen bärbeißigen wie selbstbewussten Auftretens von Luigi Colani, der auf Schloss Harkotten im Münsterland als selbsternannter »Meister« residierte und grundsätzlich nicht durch Bescheidenheit oder Realitätssinn bei seinen Entwürfen beindruckte, wurde der neue Entwurf mit Spannung erwartet. Gewünscht wurde diesmal ein praxistauglicheres Fahrzeug. Die Ankündigung, dass ein fahrfertiges Modell bereits in wenigen Wochen vorgestellt werden sollte, sorgte hingegen auf breiter Front für Heiterkeit.
Zur Person Luigi Colani schreibt der Journalist Erwin Koch: »Colani, die Schläfen grau, gewährt nicht Audienz, um Gewesenes zu disputieren. Sein Stoff ist die Zukunft. Redet Colani, rollt der Donner. Colani muß man, um ihn zu genießen, hören. Schwarz auf weiß ermatten seine Sätze zu Blödsinn. Colani muß man sehen. Das mediterrane Fischergesicht, sekundiert von wilder Gestik, gibt beste Operette. Es zittert und bebt.«34
Und es kam wie befürchtet: Das wenig später präsentierte Kleinwagenmodell, bei dem Colani jegliche gestalterischen und ästhetischen Konventionen über Bord geworfen hatte, sorgte für ungläubige Blicke und Entsetzen. Dabei lag dieser neuerliche Entwurf konzeptionell deutlich näher an einem zulassungsfähigen Straßenmodell als der 1976 präsentierte »Turbo Polo Concept«. Ungeachtet dessen war dieses Konzeptfahrzeug unfassbar gestaltet – die VW-Verantwortlichen jedenfalls starrten kopfschüttelnd auf dieses neue Colani-Vehikel.
Den Ablauf der Präsentation und die Reaktion der Beteiligten fasst ein Bericht des Nachrichtensenders n-tv zusammen: »Mit Siebkühlergrill und hängender Unterlippe kam der Colani-Polo beim damaligen VW-Chef Toni Schmücker und Entwicklungsexperte Ernst Fiala nicht gut an. Der Meister beschimpfte die beiden dann als „Blechpfeifen“, die mal weiter mit ihrer „Kartoffelkiste auf Rädern“ rumfahren sollen.«35 Danach zog der »Meister« beleidigt von dannen und sein präsentiertes Kleinwagenmodell verschwand auf Nimmerwiedersehen in der Abstellkammer der VW-Entwicklungs-abteilung.
Der Buchautor Jerry Sloniger schrieb hierzu ergänzend: »Am wildesten ging es natürlich bei den Styling-Arbeiten Luigi Colanis für die Wolfsburger zu, der behauptet hatte, er könne den Innenraum des Passats in die Außenabmessungen des Polo hineinzwängen. Als Schmücker und Fiala dann durch Colanis dreiste Angriffe auf die laufenden Baureihen verärgert waren, mußte wohl unvermeidlicherweise das Produkt des Exzentrikers im VW-Keller verschwinden, und der einzige Kommentar war, man habe aus seiner Formgebung gelernt.«36
Im Zuge des Erfolgs der japanischen Motoradhersteller stand die Frage im Raum, ob es für die Volkswagenwerk AG sinnvoll sein könnte, ein komplettes Motorrad-Programm zu entwickeln. Angesichts des anhaltenden weltweiten Motorradbooms war dieser Gedanke gar nicht abwegig. Die Pläne dafür waren jedenfalls weit fortgeschritten, denn sowohl das Modellportfolio als auch die Namensgebung für die einzelnen Modelle wurden schon erörtert.
Als Spitzenmodell war ein Motorrad mit wassergekühltem Vierzylindermotor geplant, der aus der Pkw-Motorenpalette stammen sollte. Als sicher galt, dass NSU als Markenname gewählt werden würde. Bei näherer Prüfung war diese Entscheidung nicht abwegig, denn NSU war zeitweise weltgrößter Motorradhersteller gewesen, bis im Jahre 1965 die Zweiradproduktion eingestellt worden war. Schließlich aber entschied sich der Vorstand dann doch gegen den Bau eigener Motorräder.
Zu den Plänen und den Gründen für das Scheitern gibt eine auf die Geschichte von NSU fokussierte Website Auskunft: »Ehrgeizige Pläne sehen den Bau von Motorrädern von 50 cm3-Zweitakt-Motoren bis zu 1.300 cm3 Viertakt-Motoren vor. Nur 5 Prozent der Weltproduktion wären über 300.000 Einheiten gewesen. In einer Studie wird ein Motorrad entworfen, welches – je nach Kundenwunsch – mit den 3 wassergekühlten Motorvarianten (900 cm3, 1.100 cm3 und 1.300 cm3) des VW-Polo bestückt werden sollte. Doch wie so oft, es blieb bei der Studie. Mangelnde Wirtschaftlichkeit war der offizielle Grund, warum es die Studie nicht zum Entwicklungsprojekt schaffte.«37
Parallel zum gut laufenden Pkw-Geschäft forcierte die VW-Konzernleitung ihr Engagement in der bis dato eher vernachlässigten Nutzfahrzeugsparte. Im August wurde deshalb ein Kooperationsvertrag mit der Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG (M.A.N.) vereinbart, der die gemeinsame Entwicklung und Produktion leichter Lastkraftwagen zum Ziel hatte. Europaweit vertrieben würden die Nutzfahrzeuge unter dem Markennamen »MAN-VW«. 1979 sollten die ersten Fahrzeuge des Gemeinschaftsprojekts auf den Markt kommen.
Während mit dem nachdrücklichen Einstieg in die Nutzfahrzeugsparte für den VW-Konzern ein neues Kapitel aufgeschlagen wurde – fand nahezu gleichzeitig ein anderes Kapitel sein Ende: Im Herbst 1977 wurde der Bau des technisch futuristischen, jedoch wirtschaftlich erfolglosen NSU Ro 80 eingestellt. Dies war für viele Mitarbeiter eine schmerzliche Entscheidung, denn mit dem Ende des NSU Ro 80 wurde im VW-Konzern nicht irgendein Modell verabschiedet. Vielmehr bedeutete diese Entscheidung gleichzeitig die kategorische Abkehr vom Wankelmotor, auf dem so große Hoffnungen geruht hatten. Der Kreiskolbenmotor war fortan passé.
Ärgerlich daran war, dass die technischen Probleme, die den Kreiskolbenmotor in Misskredit gebracht hatten, von den Ingenieuren längst gelöst worden waren. Die Witze um sich begegnende Ro-80-Fahrer, die mit zum Gruß erhobener Hand durch die Anzahl der ausgesteckten Finger anzeigten, der wievielte Motor eingebaut war, wirkten längst schal. Mit anderen Worten: Die einstigen Motorschäden gehörten der Vergangenheit an, der Wankelmotor war robust und hielt in der Regel über 200.000 km. Nicht vom Tisch zu wischen war freilich die Tatsache des prinzipbedingten hohen Kraftstoffverbrauchs des Wankelmotors.
Auf der Suche nach neuen, ungesättigten Absatzmärkten gelang dem VW-Marketing im November 1977 ein geradezu sensationeller Coup: 10.000 neue Golf sollten in die sozialistische Deutsche Demokratische Republik (DDR) geliefert werden. Ähnliche Geschäfte waren bislang mit den Ostblock-Staaten Jugoslawien und Ungarn eingefädelt worden. Bezahlt werden sollten die 10.000 Golf allerdings nicht in klingender Münze, sondern mit Zulieferteilen wie Reifen, Lampen und Scheiben im Gegenwert von 80 Millionen Mark (ca. 40 Millionen Euro), die aus der DDR in die westdeutschen VW-Werke geliefert würden. Thüringer Bratwürste für die Wolfsburger Kantine, so ein gängiger Scherz dieser Zeit, sollten allerdings nicht zum Lieferumfang gehören.
Die näheren Umstände dieses Geschäfts skizziert ein Beitrag des WDR: »Bereits sechs Wochen nach der Bestellung liefert Volkswagen die ersten 200 Fahrzeuge – von den DDR-Medien aus ideologischen Gründen gänzlich unbeachtet. Im Gegenzug schickt die DDR Pressen und Werkzeugmaschinen sowie ein Planetarium nach Wolfsburg. [...] Zwischen 27.000 und 36.000 Ostmark müssen ganz normale DDR-Bürger mit ordentlichem Sparbuch für die Westfahrzeuge berappen – viel Geld im Vergleich zu einem Trabbi, dessen Listenpreis 7.850 Ostmark beträgt.«38
Das Bedürfnis der DDR-Bevölkerung, ungeachtet des vollkommen überzogenen Preises, einen VW Golf zu bekommen, nahm groteske Züge an. Den Bewohnern, die die Summe ausgeben konnten, war es egal, wie sehr sich die Devisenabteilung der DDR an diesem Geschäft bereicherte – sie hatten genug von den rückständigen Ostmobilen, die im Fall eines Trabant oder Wartburg zudem mit Zweitaktmotoren ausgerüstet waren.
Zur Situation in den Autohäusern, die den Golf zugeteilt bekommen hatten, schreibt die FAZ: »Die Stasi sendet ihre Spitzel aus. Einer berichtet aus Ost-Berlin: „Am IFA-Vertrieb Berlin, Rummelsburger Straße, fanden sich gegen 05.30 Uhr die ersten Interessenten ein. Gegen 06.00 Uhr standen ca. 50 Personen, zum überwiegenden Teil aus anderen Bezirken der DDR, an, um einen Kaufvertrag abzuschließen. Gegen 07.00 stieg die Zahl der Interessenten laufend an, so dass der Betrieb bis zu 20 Mitarbeiter zur Abfertigung einsetzte (Schlangenbildung bis zu 500 Personen; vorsprechende Interessenten nutzten in der Rummelsburger Straße ca. 2 Kilometer als Parkfläche für ihre Wagen; Einsatz von VP-Regulierungsposten war erforderlich).“«39
Allerdings gibt es auch Stimmen, die dieser Darstellung widersprechen und sie relativieren. So schreibt DIE WELT: »Doch die Arbeiterklasse stand dem Westimport skeptisch gegenüber. Einmal machten sich die potenziellen Kunden Sorgen um die Ersatzteilversorgung, zum anderen waren ihnen die Preise zu hoch. Und da passierte, was es nie zuvor und nie danach in der DDR gegeben hat: Die Preise wurden gesenkt und dem üblichen Niveau angepasst. Der Golf kostete nun nur noch zwischen 22.000 und 26.000 Ostmark. Zum Vergleich: Ein Lada 1500 hat damals 24.000 Mark, ein Trabant um 10.000 Mark gekostet.«40