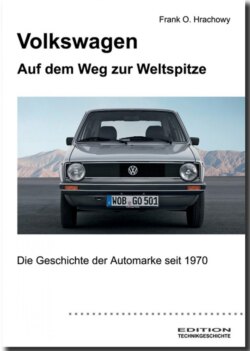Читать книгу Volkswagen – Auf dem Weg zur Weltspitze - Frank O. Hrachowy - Страница 11
Das Ende der Ölkrise
ОглавлениеSo elend, wie das Jahr 1974 endete – so elend fing das neue Jahr 1975 an. Und so viel Arbeit bei VW in die Entwicklung der neuen Modelle gesteckt worden war, so groß war die Enttäuschung über die desolate Situation, in der sich der Volkswagen-Konzern Anfang 1975 befand. Die Situation war für Volkswagen so existenziell schlecht, dass sie dem Nachrichtenmagazin DER SPIEGEL sogar das Titelbild (Was wird aus VW?) und die Titelstory der Ausgabe 16/1975 wert waren.
Innerhalb eines Jahrzehnts war aus einem Zugpferd des deutschen Wirtschaftswunders ein Sanierungsfall geworden. Eine kurzfristige Lösung war für den neuen VW-Vorstandsvorsitzenden Toni Schmücker kaum in Sicht, weil nicht nur das VW-Management untereinander zerstritten war, sondern darüber hinaus im Aufsichtsrat mehrere starke Interessengruppen ihre persönlichen Anliegen durchzusetzen trachteten. Vor allem das wichtige Auslandsgeschäft wurde für VW immer mehr zu einem geldfressenden Ärgernis.
Gerade eines der wichtigsten Standbeine des VW-Konzerns, das einst so umfangreiche US-Geschäft, lag weiterhin deutlich unter Plan. Der VW Golf wurde als Nachfolger des Käfer in den USA nicht in der Art und Weise angenommen, wie es sich die deutschen Planer erhofft hatten. Viel erfolgreicher auf dem US-Markt hingegen waren die bis dato eher wenig auffälligen japanischen Automarken Datsun (Nissan), Toyota und Honda. Eine Entwicklung wurde dabei immer deutlicher: Importautos waren zu einer festen Größe auf dem US-Automarkt geworden, aber auch auf dem deutschen.
Dabei galt es zu unterscheiden: Die Fahrzeuge aus England, Frankreich und Italien entsprachen in der Vergangenheit zwar nicht immer den Qualitätsansprüchen der deutschen Autokritiker, doch überzeugten sie viele Kunden durch ihren relativ günstigen Preis. Diese Situation bestand unverändert, doch wuchs seit einiger Zeit für die etablierten Hersteller mit den japanischen Importen eine weitere, immer stärker zunehmende Bedrohung heran. Insgesamt mussten die deutschen Autobauer feststellen, dass der Marktanteil ausländischer Pkw zum Ende des Jahres 1974 bereits auf 26,7 Prozent angeschwollen war. Tendenz weiter steigend.
Das schwache Auslandsgeschäft lag bei VW jedoch nicht nur an den niedrigen Absatzzahlen, die weit unter den Prognosen lagen. Ein weiterer Faktor war die für deutsche Produkte zunehmend ungünstiger werdende Währungsentwicklung der Deutschen Mark gegenüber dem Dollar. Die Folgen für VW untermauerte DER SPIEGEL mit eindeutigen Zahlen: »Die internationale Währungsentwicklung setzte die Wolfsburger endgültig matt: Bekamen sie in ihrem Glanzjahr 1970 für ein 3.000-Dollar-Auto von der Bank noch 10.950 Mark (ca. 5.500 Euro) überwiesen, so blieben fünf Jahre später davon ganze 6.900 Mark (ca. 3.450 Euro) übrig.«27 Hinzu kam, dass die hohen Lohnkosten in Deutschland immer stärker zu einem Wettbewerbsnachteil wurden.
Angesichts der anhaltenden wirtschaftlichen Bedrohung neigten sich die Barmittel von VW ihrem Ende zu. Der neue VW-Vorstandsvorsitzende Toni Schmücker musste nun rigoros handeln und das zerstrittene Topmanagement zur Einigung zwingen. Aufgrund der immer bedrohlicher werdenden Situation beschloss der VW-Aufsichtsrat schließlich ein Programm zur Massenentlassung von 25.000 Mitarbeitern. Aufgefangen werden sollten die Angestellten über ein regionales Förderprogramm.
Eine Mittelklasselimousine, ein Sportcoupé und ein Kompaktmodell waren bereits auf den Markt gebracht worden, jetzt fehlte nur noch ein Kleinwagen im VW-Programm. Im März 1975 begann dem folgend in Wolfsburg die Serienfertigung des Polo, der im Marktsegment der Kleinwagen als preiswerte Variante zum baugleichen Audi 50 angeboten werden sollte. Damit zielte der Polo eher indirekt auf den Opel Kadett C, denn er wurde von seiner Größe und von seinem Preis her unterhalb des Rüsselsheimer Kontrahenten positioniert. Das neue VW-Modell war ebenfalls als Schrägheckmodell konstruiert, das nach bewährtem Muster einen vorne quer eingebauten Motor mit Frontantrieb verband.
Technisch basierte der Polo wohl auf dem ein Jahr zuvor präsentierten Audi 50; er war aber deutlich preisgünstiger, weil bei seiner Ausstattung rigoros gespart wurde. Noch nicht einmal Kopfstützen besaß der Polo serienmäßig, ebenso fehlten in der Basisausstattung auf der Beifahrerseite das Türschloss, der Türkontakt für die Innenbeleuchtung, die Sonnenblende sowie der obere Haltegriff. Konsequenterweise war der kleine VW anfangs nur mit einem Reihenvierzylinder mit 900 cm3 und 40 PS (29 kW) erhältlich.
Zum Konzept des Polo schreibt der VW-Konzern auf seinem Portal VOLKSWAGEN CLASSIC: »Der Polo, ein dreitüriger Kleinwagen, ist recht spartanisch ausgestattet und kann deshalb preiswert angeboten werden. Er besticht durch eine gut verarbeitete, auf das Notwendige angelegte Ausstattung. Vieles erinnert an den zeitgleichen „Spar-Käfer“ 1200, wie zum Beispiel die simplen Türpappen, Öffnungen statt Klappen und zur Krönung eine Drahtschlinge als Gaspedal: Selten ist so konsequent reduziert worden.«28
Opel hingegen fehlte ein solcher Kleinwagen im Verkaufsportfolio, denn unterhalb des Kadett gab es kein Modell aus Rüsselsheim. Im Jahr 1975 reagierte Opel insofern, als dass der Kadett C in einer weiteren Karosserieform angeboten wurde. Als preisgünstiges dreitüriges Schrägheckmodell Kadett City sollte er mit seiner großen Heckklappe einen besonders hohen Alltagsnutzen bieten. Dabei reduzierten die Entwickler die Wagenlänge um 20 cm, womit der Kadett City tatsächlich formal und preislich in die Nähe des VW Polo rückte. Technisch hingegen blieb der VW Polo das modernere Auto.
Im April begann bei Volkswagen die Produktion des Volkswagen LT (Lastentransporter) mit zahlreichen Aufbau-Variationen, womit das Nutzfahrzeug-Programm nach oben erweitert wurde. Im Gegensatz zum kleineren und konzeptionell älteren Transporter T2 verfügt der Volkswagen LT über einen vorne eingebauten Reihenmotor mit Wasserkühlung. Damit war die Wolfsburger Modelloffensive erst einmal zu ihrem Ende gelangt.
Die Autoverkäufe zogen weltweit langsam wieder an und vorsichtiger Optimismus machte sich breit. Parallel dazu stiegen die Börsenkurse der Automobilhersteller. Mitte des Jahres 1975 schließlich war die Ölkrise vorbei und die Konjunktur sprang an. Statt über Kurzarbeit wurde in den deutschen Werken plötzlich wieder über Sonderschichten gesprochen. Dabei profitierten BMW, Daimler-Benz und Porsche zusätzlich von der Investitionszulage, die gut verdienende Selbstständige und Firmen in Anspruch nehmen konnten.
Zur sich wandelnden Situation schreibt der VW-Konzern: »In der größten Not geschehen bisweilen Wunder. Schmücker ist ein Glückskind: Mitte 1975 kommt die wirtschaftliche Wende. Der Dollar steigt wieder, und am heimischen Markt löst sich die Verkrampfung der Käufer. Schon im August müssen in Wolfsburg und Emden Sonderschichten gefahren werden, weil 50.000 bestellte Autos fehlen.«29 Mehr noch: Während noch Mitarbeiter aus dem Notprogramm den Konzern verließen, hob die VW-Konzernleitung im Spätsommer 1975 eilig den geltenden Einstellungsstopp auf und bot stattdessen 2.750 neue Arbeitsplätze an, die möglichst schnell besetzt werden sollten.
Die Ölkrise war durchgestanden, doch unzweifelhaft war in Deutschland eine Ära zu Ende gegangen. Die Grenzen des Wachstums, so der Titel eines zu dieser Zeit viel diskutierten Buches, hatten nun auch die Deutschen zu spüren bekommen. In anderen Worten ausgedrückt: Die Ära des deutschen Wirtschaftswunders war vorbei. Das Konzept, das den VW-Konzern aus der Krise führen sollte, ging jedenfalls auf: der Golf wurde wie der Passat und der Scirocco sofort zum Bestseller. Dabei war den Planern bei VW das Kunststück gelungen, den kompakten Golf als klassenloses Fahrzeug zu etablieren – als »Volkswagen« im besten Sinne.
In den Golf konnte sich ein Arzt oder eine Rentnerin genauso selbstverständlich setzen wie eine Hausfrau oder ein Student – unpassend oder gar peinlich war der VW Golf niemals. Ein Artikel im Nachrichtenmagazin DER SPIEGEL fasste die neue Situation anschaulich zusammen: »Der Golf brachte die starren Märkte in Bewegung. Unter dem Golf-Erfolg schrumpften die Marktanteile der Konkurrenten Opel und Ford. Im Oktober 1974 wurden vom Golf mehr verkauft als von sämtlichen Opel-Personenwagen zusammen. Und Opels Konkurrent Ford, einstmals zu 18 Prozent am deutschen Markt beteiligt, fiel auf acht Prozent Marktanteil zurück.«30
Doch die Wettbewerber schliefen nicht und reagierten ihrerseits auf die Modelloffensive von VW. In diesem Sinne begann im September 1975 bei Opel die Produktion der Mittelklasselimousine Ascona B sowie des davon abgeleiteten Sportcoupés Manta B. Bei der Technik des Ascona B blieben die Ingenieure auf vertrautem Terrain: Frontmotor mit Kardanwelle und Hinterradantrieb, dazu die alten Motoren. Der Rückstand von Opel hinsichtlich moderner Motoren und Packaging-Konzepte war bei GM jedoch nicht unbemerkt geblieben, weshalb sich für die Fahrzeuge der europäischen Kompakt- und Mittelklasse bereits neue, in ihrer Konzeption fortschrittlichere Modelle in der Entwicklung befanden.
Trotz seiner eher konservativen Konzeption wurde der Opel Manta B sofort zu einem Erfolg. Gerade junge Familienväter, die auf der Suche nach einem zuverlässigen, formschönen und bezahlbaren Sportcoupé waren, griffen zu. Die verbaute Technik markierte zwar nicht die technologische Führerschaft, dafür war sie mit ihrer Solidität über alle Zweifel erhaben. Gerade im direkten Vergleich zu sportlichen Fahrzeugen aus englischer, französischer oder italienischer Produktion machte der Manta B eine glänzende Figur.
Das Jahr 1975 endete für den VW-Konzern mit einem Verlust von nur noch 157 Millionen Mark (ca. 79 Millionen Euro), während es unverändert steil bergauf ging und der Gewinn von Monat zu Monat stieg. Dieser Erfolg von VW brachte die Automobilkonzerne in Deutschland in Verlegenheit. Gerade die traditionellen Anbieter von Mittelklassemodellen wie Ford und Opel mussten erkennen, dass mit Volkswagen plötzlich ein ernstzunehmender Wettbewerber auf den Plan getreten war, über den man vorher eher gelächelt hatte. Fakt war: Während viele Autohersteller in Deutschland unter der Ölkrise gelitten hatten, ging VW aus dem vorangegangenen Desaster gestärkt hervor.
Zu Jahresende 1975 sickerte eine technische Neuigkeit durch, die allenthalben für Staunen sorgte: Ferdinand Piëch, Enkel von Professor Ferdinand Porsche und mittlerweile zum Leiter der gesamten Motorenentwicklung im VW-Konzern aufgestiegen, hatte den Benzinmotor des Audi 80 zu Testzwecken in einen Dieselmotor verwandelt. Bei nahezu unverändertem Gewicht, so war aus der Gerüchteküche zu hören, sollte das Aggregat 50 PS (37 kW) leisten und 30 Prozent weniger Treibstoff konsumieren. Und mehr noch: Die Serienfertigung sollte vom Vorstand bereits beschlossen worden sein.
Das Jahr 1976 begann mit einer verblüffenden Nachricht: Dem neuen VW-Chef Toni Schmücker schien es gelungen zu sein, die Konzernspitze soweit auf Linie zu bringen, dass sie dem Bau eines VW-Werkes in Nordamerika zustimmte. Damit wäre ihm genau das gelungen, was sein Vorgänger Rudolf Leiding nicht hatte durchsetzen können. Dieses Werk würde zwar den US-Markt unabhängiger von den deutschen Produktionsstätten machen, doch die Vorteile für den VW-Konzern waren nicht von der Hand zu weisen. Mit einem Werk in Übersee könnten die dort produzierten Fahrzeuge direkt vor Ort ohne aufwändige Verschiffung, ohne Einfuhrzölle, ohne Währungsrisiken und ohne hohe deutsche Lohnkosten verkauft werden.
Und noch zwei weitere Gerüchte machten die Runde: So das Gerücht, dass die VW-Konzernleitung festgestellt hatte, dass rund 50.000 Kunden pro Jahr einen Golf oder Polo nicht kauften, weil sie ein klassisches Stufenheck einem Fließheck vorzogen. Aus diesem Grund wurde geplant, die Modelle Polo und Golf ergänzend als Stufenheckmodelle zu bauen.
Das zweite Gerücht drehte sich um einen kostengünstigen Sportwagen auf Basis des Golf, der unter dem Namen Golf GTI im Herbst 1975 auf der IAA präsentiert worden war. Geplant war eine limitierte Auflage von 5.000 Exemplaren des Golf GTI, die mit dem von Audi übernommenen 1,6-Liter-Einspritzmotor (mechanische Einspritzanlage K-Jetronic von Bosch) ausgerüstet werden sollte. In Anbetracht der Motorleistung von 110 PS (81 kW) und einem Gewicht von deutlich unter 1.000 Kilogramm bot der Golf GTI seit seiner Vorstellung reichlich Stoff für Gespräche. Über 180 km/h sollte er schnell sein. Skeptiker im VW-Konzern hielten das Unternehmen allerdings für finanziell riskant, denn wer sollte solch einen Renn-Golf kaufen. 5.000 Verrückte?
Im Juni 1976 schließlich kamen die Spekulationen zu einem Ende, denn der erste Golf GTI rollte vom Fließband. Lieferbar war der Golf GTI in den Farben Marsrot und Diamant-Silbermetallic. Neben seinem starken Motor glänzte der Golf GTI mit sportlicher Ausstattung: So wurden auf diesen Golf breitere Reifen der Dimension 175/70 HR 13 aufgezogen, das Fahrwerk wurde gestrafft sowie vorne und hinten mit Stabilisatoren ausgerüstet. Zusätzlich wurde das Fahrwerk vorne um 10 mm und hinten um 20 mm abgesenkt. Überdies wurde der Frontspoiler vergrößert.
Auch optisch zeigte der Golf GTI, wofür er gebaut war: So schreibt VW auf seinem Portal VOLKSWAGEN CLASSIC: »Die Ausstattung ist sportlich: Unter anderem werden alle Chromteile durch schwarz lackierte Komponenten ersetzt, der Kühlergrill trägt den GTI-Schriftzug und erhält die rote Umrandung. Der Dachhimmel ist ebenso wie Sonnenblenden und Teppiche tiefschwarz. [...] Im Innenraum gibt es körpergerecht ausgeformte Sportsitze mit dem bekannten Schottenkaro, geschaltet wird mit dem berühmten Golfball.«31 Auch wenn Neider den sportlichen Golf verunglimpften und die Abkürzung »GTI« als »Größenwahn, Temporausch, Imponiergehabe« übersetzten, zeigte sich bald, dass sich das Marketing von dem Plan, 5.000 Exemplare zu bauen, verabschieden musste.
Denn: Der Golf GTI wurde innerhalb kürzester Zeit zu einem Klassiker der Moderne, dem von Beginn an Kultstatus zukam. Durch seine enormen Fahrleistungen, seine Alltagstauglichkeit und seinen günstigen Preis wurde er beim vor allem jüngeren Publikum zu einem Erfolg. Sofort stellte sich die Zubehörindustrie auf den Golf GTI ein, die den Käufern eine unüberschaubare Fülle von Tuningkomponenten und Zubehör anbot. So dauerte es nicht lange, bis der Golf GTI auch auf der Rennstrecke Erfolge einfuhr. Mit dem Golf GTI hatten die Planer ein Kultauto geschaffen, dessen Ruhm über Jahrzehnte fortdauern sollte.
Im Juni 1976 erhielt auch der Scirocco den 110 PS (81 kW) starken, auf 1.600 cm³ vergrößerten Motor mit der mechanischen K-Jetronic-Benzineinspritzung von Bosch. Allerdings waren aufgrund der gestiegenen Leistung zahlreiche technische Änderungen notwendig. So musste in der Motorperipherie der Wasserkühler angepasst werden, hinzu kam ein Ölkühler. Fahrwerksseitig wurden die Federung und die Stoßdämpfer modifiziert, außerdem zusätzliche Stabilisatoren, innenbelüftete Scheibenbremsen vorn, breitere Felgen sowie Reifen mit einem höheren Geschwindigkeitsindex montiert. Damit war der Scirocco GTI geboren, der den Scirocco TS als Spitzenmodell ablöste.
Ebenfalls mit dem 110 PS (81 kW) starken Einspritzmotor wurde eine weitere Version des Scirocco ausgerüstet, die unter der Bezeichnung Scirocco GLI auf komfortorientiertes Publikum zugeschnitten war. Diese elegantere Version des Sportcoupés erhielt serienmäßig eine Metalliclackierung und getönte Scheiben. Edle, hochwertige Materialien im Innenraum sorgten für Wohlfühlambiente.
Das zweite Gerücht löste sich ebenfalls auf, denn im Juli 1976 wurde die Konzerntochter »Volkswagen Manufacturing Corporation of America« ins Leben gerufen, die eine Produktion in den Vereinigten Staaten aufbauen sollte. Geplant war, dort jährlich 200.000 VW Golf zu produzieren. Zu dieser gewaltigen Aufgabe konkretisiert der VW-Konzern: »Die neue Tochter übernimmt ein Presswerk in South Charleston, West Virginia und eine Montagefabrik in Westmoreland, Pennsylvania, wo im April 1978 die Golf-Fertigung für den nordamerikanischen Markt anläuft. Motoren und Getriebe stammen aus Deutschland, Hinterachsen und Kühler von der Volkswagen de México, die restlichen Bauteile vorwiegend aus der US-Zulieferindustrie.«32
Damit hatte VW-Chef Toni Schmücker nun schlussendlich durchgesetzt, woran sein Vorgänger Rudolf Leiding gescheitert war. Sicher spielte bei der Entscheidung des Aufsichtsrats auch eine Rolle, dass sich der US-amerikanische Staat und die Gemeinde an den Baukosten indirekt beteiligten, etwa durch erhebliche Zuschüsse aus Industrie- und Arbeitsförderungs-programmen. Für die aus Deutschland gelieferten Komponenten sollte eigens eine Freihandelszone geschaffen werden, um die Importzölle zu reduzieren. Unterm Strich sanken damit die Kosten für den VW-Konzern von errechneten 1.000 Millionen Mark (ca. 500 Millionen Euro) auf bescheidene 400 Millionen Mark (ca. 200 Millionen Euro).
Dass ein Werk im Ausland auch reichlich Probleme bereiten konnte, die im eigenen Land kaum denkbar waren, zeigte der permanente Ärger mit dem VW-Werk in Mexiko. »Volkswagen de México« war bereits 1964 gegründet worden und seit 1967 wurde dort vor allem der VW Käfer produziert. Doch das Unternehmen verharrte seit Jahren in den roten Zahlen, weil die mexikanische Regierung VW auf der einen Seite keine Preiserhöhungen erlaubte – auf der anderen Seite die Gewerkschaften mit gelockertem Zügel führte. So war das mexikanische Werk durch Lohnerhöhungen und Streiks mittlerweile vollkommen unrentabel geworden. Am liebsten, daraus machte VW-Chef Toni Schmücker keinen Hehl, wollte er dieses gleichermaßen nervenaufreibende wie kostspielige Werk loswerden.
Und auch das Werk in Brasilien, das größte und bisher erfolgreichste VW-Auslandsunternehmen, machte nun Sorgen. Der dort gebaute VW Käfer war immer schwieriger zu verkaufen, während der moderne Passat nicht in gewünschter Weise vom Publikum angenommen wurde. Einzig das in Brasilien entwickelte Modell VW Brasília, ein kompakter Kombi auf der technischen Basis des VW Typ 3 (VW 1600), ließ sich noch passabel vermarkten. Doch am meisten Sorgen machte dem Volkswagen-Vorstand, dass immer mehr Wettbewerber den brasilianischen Markt für sich entdeckten und VW massiv unter Druck setzten.
Auch das dritte Gerücht löste sich im Sommer 1976 auf: Das Gerücht um den neu entwickelten, kleinen Dieselmotor. Denn im Juni lief im Werk Salzgitter der erste Golf mit einem 4-Zylinder-Dieselmotor mit 1,5 Liter Hubraum und einer Leistung von anfangs 50 PS (37 kW) vom Band (bald schon mit 1,6 Liter Hubraum und 54 PS (40 kW)). Der als Wirbelkammer-Diesel konzipierte Motor basierte auf dem Rumpfmotor (EA 827) von Audi, dessen mechanische Komponenten für den Umbau zum Selbstzünder verstärkt worden waren. Auch die Kühlanlage war für den Dieselmotor verändert worden.
Mit einer Beschleunigung von19 Sekunden von 0 auf 100 km/h und einer Höchstgeschwindigkeit von 140 km/h war der Diesel-Golf von seinen Fahrleistungen her nicht gerade spritzig zu fahren. Aber die Fahrleistungen standen auch nicht im Mittelpunkt dieses Antriebskonzepts, sondern seine Sparsamkeit, die sich in einem Verbrauch von rund 6,5 Litern Dieselkraftstoff niederschlug. Die große Freude beim Tanken wurde jedoch getrübt durch die geschmälerte Freude beim Fahren – die Manieren dieses Dieselmotors hinsichtlich Laufgeräusch und Vibrationen ließen noch zu wünschen übrig.
Auch in der oberen Mittelklasse tat sich etwas im VW-Konzern, denn die für das anspruchsvollere Klientel zuständige Konzernmarke Audi stellte im September 1976 ihr neues Flaggschiff vor: den Audi 100 C2. Der neue große Audi löste den 1968 eingeführten Audi 100 C1 nach 827.474 gebauten Exemplaren ab. Optisch hatte das Designerteam das Modell völlig neu konzipiert. Statt rundlich-barocker Form war der vorgestellte Audi 100 nun kantig und glattflächig gezeichnet. Dabei war Helmut Warkuß für die äußere Formgebung (Exterieur) verantwortlich gewesen. Claus Luthe, der auch schon den NSU K 70 und den NSU Ro 80 geformt hatte, hingegen für die Gestaltung des Innenraums (Interieur).
Als Motoren standen Vier- und Fünfzylinder-Aggregate mit einer Leistung von 85 (63 kW) bis 136 PS (100 kW) zur Auswahl. Eine rund 180 PS (132 kW) starke Version mit einem neu entwickelten Wankelmotor befand sich noch in der Erprobung. Allerdings wurden grundsätzliche Bedenken hinsichtlich des Einbaus eines Kreiskolbenmotors in ein Modell des VW-Konzerns mittlerweile immer massiver formuliert. 1977 schließlich sollte das Projekt Audi 100 Wankel endgültig begraben werden.
War schon der alte Audi 100 als »Prokuristen-Mercedes« tituliert worden, so galt diese Einschätzung erst recht für den neuen Audi 100 C2. Er wurde in der oberen Mittelklasse direkt auf Augenhöhe der Platzhirsche Mercedes W 123 und 5er-BMW positioniert. Dabei konnte der Audi 100 im direkten Vergleich mit einem günstigen Preis und ansprechenden Fahrleistungen punkten. Das formulierte Ziel des Managements war, das Image eines Audi-Fahrers mit Hosenträgern, Hut und Wackeldackel auf der Heckablage abzustreifen. Stattdessen sollte Audi als Technologieführer im Automobilbereich aufgebaut und ganz deutlich von VW abgegrenzt werden.
Bei diesen Ambitionen mussten nicht nur Fachleute schmunzeln – dies vor allem mit Blick auf den technisch anspruchsvollen NSU Ro 80, der nur Verluste einfuhr. Und noch eine weitere Herausforderung kam hinzu: Angesichts der anspruchsvollen Klientel legte das Audi-Marketing Wert darauf, den Händlern die entsprechenden Umgangsformen zu vermitteln. Statt leutselig Sprüche zu klopfen, wurde den Verkäufern in der zu diesem Zweck aufgelegten Verkaufsfibel beispielsweise geraten, mit dem neuen Audi 100 zu Tennisvereinen, Ausflugslokalen, Pferderennen, Yacht- und Jagdclubs und so weiter zu fahren.
Mittlerweile hatte sich die neue Modellgeneration etabliert, die Trauer um die traditionellen Modelle mit luftgekühltem Boxermotor im Heck wurde immer leiser .Wie gut VW den Geschmack der Zeit getroffen hatte, zeigten alleine schon die Produktionszahlen des Golf. So verließ am 27. Oktober 1976 bereits der einmillionste Golf das Fließband in Wolfsburg. Auch die anderen Modelle der neuen Generation verkauften sich in hoher Stückzahl, wobei das Sportcoupé Scirocco als Nischenmodell von seinen Verkaufszahlen her naturgemäß nicht an den anderen Modellen gemessen werden durfte.
Das Jahr 1977 begann bei VW mit einem neuen Modell, über das schon eine Zeit lang geredet und spekuliert worden war. Im Februar schließlich rollte der erste VW Derby vom Fließband, ein Polo mit Stufenheck. Die Rücksitzlehnen waren zwar nicht mehr umklappbar, doch gleichzeitig gewann der Kleinwagen einen üppigen Kofferraum mit 515 Litern Volumen. Entwickelt wurde der Derby, der wie der Polo auf dem Audi 50 basierte, in Ingolstadt bei Audi.
Zur Wahl standen wie beim Polo drei Leistungsstufen: der 0,9-Liter-Motor mit 40 PS (29 kW), der 1,1-Liter-Motor mit 50 PS (37 kW) und der 1,3-Liter-Motor mit 60 PS (44 kW). Alle Ausführungen besaßen ein handgeschaltetes 4-Gang-Getriebe und Frontantrieb. Mit diesem Modell sollte Opel und Ford Paroli geboten werden, die mit ihren kompakten Stufenheckmodellen bislang recht erfolgreich waren.
Spätestens mit diesem – nach dem Audi 50 und dem VW Polo – dritten Kleinwagenmodell aus dem VW-Konzern wurde offensichtlich, wie stark mittlerweile der Wettbewerb zugenommen hatte. Im Zuge der Ölkrise war ein neuer Trend entstanden – der Markt der Kompaktfahrzeuge wurde offensiv durch darunter positionierte Kleinwagen angegriffen. Hier kämpften die drei Modelle des VW-Konzerns, aber ebenso ausländische Kleinwagen wie der Renault 5 oder der Fiat 127, um die Käufergunst.
Opel reagierte auf diese Entwicklung nicht mit einem eigenen kleineren Fahrzeug, hier bildete weiterhin der Kadett C in kostenreduzierter City-Ausstattung das Einstiegsmodell. Kein Zweifel, Opel war inzwischen modellpolitisch und technisch ins Hintertreffen geraten. Wer aber auf diese Herausforderung reagierte war die Marke Ford, die 1976 einen neuen, modern mit Frontmotor und Frontantrieb konzipierten Kleinwagen namens Fiesta auf den europäischen Markt brachte. Gebaut wurde der Ford Fiesta kostengünstig in Spanien. Schon bald wurde klar, dass mit dem Fiesta ein weiterer ernstzunehmender Wettbewerber auf den Plan getreten war.
Diese Hinwendung zu Kleinwagen entfachte gleichzeitig das Interesse an alternativen Antriebskonzepten für die Automobile der Zukunft. So äußerte sich beispielsweise Volkswagen-Entwicklungschef Prof. Ernst Fiala in einem Interview über neue Automotoren dahingehend, dass eine Turboaufladung für Dieselmotoren wohl denkbar und auch technisch umsetzbar, jedoch bislang aus Kostengründen kaum wirtschaftlich sei.
Noch spannender war die Frage des Journalisten nach sinnvollen Zukunftskonzepten im Bereich Antriebstechnik. Hierauf erläuterte Prof. Fiala: »So leid es mir tut, ich kann Ihnen keine Revolution des Autoantriebs voraussagen. Zunächst, für die nächsten 20 Jahre, wird der Hubkolbenmotor, sei es als Diesel-, sei es als Benzinmotor, mit Abstand die wichtigste Antriebsart sein. Danach käme der Wankel, dann vielleicht die Gasturbine. dann der sogenannte Heißluftmotor, danach die Dampfmaschine. [...] Das Elektroauto kommt dann auch noch.«33
Die Abkehr von großvolumigen Verbrennungsmotoren zeigte sich beispielhaft im Verkaufsprogramm des Wettbewerbers Opel, der seine aus den Modellen Kapitän, Admiral und Diplomat bestehende KAD-Klasse einstellte. Diese an US-Straßenkreuzer erinnernden Dickschiffe mit ihren großen Motoren, die beim V8 des Diplomat mit einem Hubraum von 5,4 Litern aufwarteten, wurden kaum mehr gekauft. Um hier wieder Anschluss zu finden, präsentierte Opel 1977 auf der IAA in Frankfurt mit dem Senator und dem davon abgeleiteten Coupé Monza eine Neuentwicklung für die Obere Mittelklasse.
Der direkte Vergleich zu den überkommenen KAD-Modellen zeigte nachdrücklich die Abkehr von amerikanischen Einflüssen. Viel kleiner, straff gezeichnet und modern konzipiert traten die neuen Modelle die Nachfolge der in die Jahre gekommenen KAD-Klasse an. Alleine schon die kompakteren Abmessungen von Senator und Monza zeigten: Opel hatte sich aus der imageträchtigen Oberklasse verabschiedet, um zukünftig in den unteren Klassen präsenter zu sein.
In den USA waren die Kunden der drei großen Hersteller Chrysler, Ford und GM in ihrer Ignoranz weit entfernt von diesem neuen Trend, der sich weltweit formte. Die nach wie vor starre Geisteshaltung der amerikanischen Kunden schlug sich unverändert in technisch rückständigen Modellen der drei großen US-Automobilhersteller nieder. Großvolumige durstige V8- oder V6-Motoren bestimmten nach wie vor den Markt. Dieselmotoren, die in Europa immer stärker nachgefragt wurden, waren hingegen in den USA verpönt. Diese technische Rückständigkeit war einer der Gründe, weshalb neuerdings immer mehr japanische Hersteller auf dem US-amerikanischen Markt Fuß fassten.
So lautete im Sommer 1977 die Reihenfolge der Importeure in Nordamerika: Toyota, Datsun, Honda, dann erst kam VW. Toyota beispielsweise stand im Jahr 1977 in den USA bereits an der Schwelle von 500.000 verkauften Fahrzeugen. Demnächst sollten die für ihre Zuverlässigkeit geschätzten, japanischen Autos sogar in eigenen Fabriken direkt vor Ort in den USA gefertigt werden. In dem über viele Jahre von den großen drei Konzernen Ford, Chrysler und GM vernachlässigten Heimatmarkt wollte fortan auch VW durch sein US-Werk stärker auftreten.