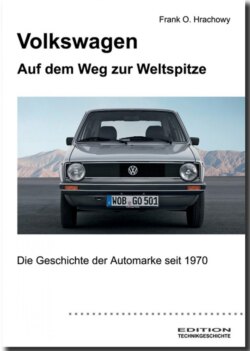Читать книгу Volkswagen – Auf dem Weg zur Weltspitze - Frank O. Hrachowy - Страница 6
Der VW Käfer und das Wirtschaftswunder
ОглавлениеStatt Motorrad oder Rollermobil fuhren mittlerweile viele Deutsche einen gebrauchten Käfer. Viele weitere sparten, um möglichst bald ebenfalls auf ein Auto umsteigen zu können. Der Bedarf der westdeutschen Bevölkerung an einfachen, kostengünstigen Automobilen schien unbegrenzt, ebenso wie das Wachstum der westdeutschen Wirtschaft unbegrenzt schien. Die vom ehemaligen Bundeswirtschaftsminister Ludwig Erhard 1957 in seinem Buch Wohlstand für Alle beschriebene Vision schien sich zu erfüllen, rückten doch immer mehr Deutsche dank eines gut bezahlten, sicheren Arbeitsplatzes in die Mittelschicht auf.
Doch so groß der Erfolg des VW Käfer in der Vergangenheit war, so wurde doch von Jahr zu Jahr offensichtlicher, dass der luftgekühlte Hecktriebler nicht mehr dem neuesten Stand der Technik entsprach. Zwar hatten die Wolfsburger Ingenieure den Käfer ständig weiterentwickelt, so dass nahezu jedes Bauteil im Laufe der Jahre verändert worden war, doch das Grundkonzept war unangetastet geblieben. Mit anderen Worten: Der VW Käfer war ein ausgereiftes Automobil, doch seine kritische Straßenlage, die unzureichende Heizleistung des luftgekühlten Motors und der im Verhältnis zu den Fahrleistungen hohe Benzinverbrauch waren nicht wegzudiskutieren.
Gleiches galt für den VW Typ 3, der bereits 1961 als größeres Modell dem Käfer zur Seite gestellt worden war. Dieses VW 1500 genannte Stufenheckmodell basierte auf der Technik des Typ 1, es war jedoch von seinem Maßen her länger und breiter als der Käfer. Der bewährte Boxermotor besaß knapp 1.500 cm3 Hubraum und war leistungsstärker geworden. Er leistete jetzt 45 PS. Wichtiger aber war, dass der Ölkühler und das Radialgebläse zur Motorkühlung umgesetzt worden waren, so dass der Motor nun sehr flach baute.
Wie beim Käfer war die Karosserie mit einem Plattformrahmen verschraubt. Optisch wirkte der Typ 3 deutlich erwachsener, vor allem aber besaß er viel mehr Stauraum als der VW Käfer. Vorne standen 200 Liter für Gepäck zur Verfügung; hinten, direkt über dem flach im Heck liegenden Motor, nochmals 180 Liter. Das wirkte wohl auf den ersten Blick recht überzeugend, doch in der Praxis boten beide Kofferräume nur Platz für flaches Stückgut. Auch von seinen Platzverhältnissen her überzeugte der Typ 3 nicht, denn der Radstand war mit dem des Typ 1 identisch. Fakt war: Obwohl der Typ 3 von seiner äußeren Erscheinung deutlich größer aussah als der VW Käfer, war er innen genauso eng.
Den Typ 3 gab es in drei Karosserieversionen zu kaufen, namentlich als Limousine, als Kombi sowie unter dem Label »Karmann-Ghia« als Coupé (Typ 14). Auf ein geplantes Cabriolet wurde für den Serienbau aus Kostengründen verzichtet. Bereits im Herbst 1963 erschien der VW 1500 S mit einer Leistung von 54 PS. Der VW 1500 S wurde im August 1965 vom VW 1600 TL (»Touren-Limousine«) mit Fließheck abgelöst, der zwar nicht stärker, dafür aber etwas breiter war.
Wie wenig dieses Modell den Erwartungen der Käufer entsprach, zeigte sich bei der Verballhornung des Kürzels »TL«, das bald als »Traurige Lösung« die Runde machte. Für kaum mehr Begeisterung sorgte der neue, vorrangig für die Deutsche Post entwickelte VW Kleintransporter Typ 147 »Fridolin«, der kostensparend aus Komponenten der bereits vorhandenen VW-Modelle entwickelt worden war.
Zum VW Typ 3 schrieb Buchautor Jerry Sloniger: » [...] die Hälfte der Wagen mußten außerplanmäßig die Werkstatt aufsuchen – für VW-Verhältnisse etwas völlig Absurdes. Nicht genug, daß dieses Auto so viel kostete wie andere, die mehr boten und schneller waren – auch sein Durst war infolge eines leicht veralteten Motorkonzeptes nicht gerade gering. Doch viel schlimmer war, wie Käuferbefragungen inzwischen ergaben, dass es sowohl hinter heimischen wie ausländischen Konkurrenten in puncto Zuverlässigkeit und Qualität zurückfiel.«2
Das Ziel war klar, VW wollte den Typ 3 in die nächsthöhere Klasse hieven, wo mit ertragreicheren Preisen und Margen kalkuliert werden konnte. Die deutsche Bevölkerung war anspruchsvoller geworden – und die neuen Ansprüche galt es nun zu bedienen. Zur zeitgenössischen Marktsituation schrieb das Nachrichtenmagazin FOCUS: »Die Mittelklasse war Mitte der 1960er Jahre zum wichtigsten Umsatzbringer fast aller deutscher Automobilhersteller geworden. Audi, BMW, Ford, Glas, Mercedes, Volkswagen und bald auch NSU, alle wollten ihren Anteil am lukrativsten Marktsegment, das sich Opel anfangs fast nur mit Borgward teilen musste.«3
Das Jahr 1967 markierte in Deutschland einen Umbruch, denn das Wirtschaftswunder stockte und die Wirtschaft schrumpfte. Die Steuereinnahmen waren niedriger ausgefallen als erwartet, während die Staatsausgaben stark gestiegen waren. Nach den Boomjahren des Aufbaus mit Wachstumsraten von teilweise über 10 Prozent rutschte die deutsche Wirtschaft plötzlich in eine Rezession. Dabei stiegen die Arbeitslosenzahlen von 0,7 Prozent 1966 auf 2,1 Prozent im Jahr 1967. Gleichzeitig stieg die Inflation, weshalb die Bundesbank die Zinsen erhöhte. Der Effekt war, dass Investitionen verschoben oder nicht getätigt wurden. Nach dem stetigen Wachstum der vergangenen Jahre musste die Volkswagenwerk AG so 1967 erstmals einen Absatzrückgang gegenüber dem Vorjahr hinnehmen.
Trotz der wirtschaftlich schwierigen Zeiten wurde mit dem Bau einer der weltweit größten Test- und Prüfanlagen der Automobilindustrie begonnen. In der Nähe des kleinen Dorfes Ehra-Lessin, das rund 25 Kilometer nördlich von Wolfsburg im Landkreis Gifhorn liegt, sollte die gewaltige Anlage entstehen. Mitten in den Wald wurden über 100 Kilometer Versuchsstraßen und eine Hochgeschwindigkeitsstrecke (»Schnellbahn«) mit einer Länge von rund 21 Kilometern sowie zwei Steilkurven gebaut. Durch die Überhöhung der Steilkurven in einem Winkel von bis zu 42 Grad sollten hier zukünftig Fahrzeuge bis zu einem Tempo von 350 km/h getestet werden.
Konkurrenz für Volkswagen kam mittlerweile auch aus dem europäischen Ausland. Schon 1966 war jedes siebte in der Bundesrepublik zugelassene Auto nicht mehr deutschen Ursprungs. Aus Japan schickte sich Honda als erster asiatischer Hersteller an, seinen Kleinwagen N 360 nach Deutschland zu verschiffen. Die Bemühungen der fernöstlichen Anbieter wurden gemeinhin belächelt, zu denken gab allenfalls die Dominanz dieser meist aus dem Zweiradbau kommenden Hersteller bei den Motorradweltmeisterschaften. Ausreichend technisches Know-how schienen die japanischen Ingenieure wohl zu besitzen – wer aber sollte ein asiatisches Auto kaufen?
Doch Wettbewerb drohte nicht nur aus dem Ausland, sondern auch von Opel und Ford. Besonders Opel war in den letzten Jahren beeindruckend gewachsen, weshalb bereits 1962 ein großes neues Werk in Bochum errichtet worden war. Hier baute der Rüsselsheimer Traditionshersteller den Kompaktwagen Kadett A, der technisch in jeder Hinsicht moderner war als der VW Käfer.
Der Kadett A war ein kompakter Wagen mit klassischer Pontonform (Stufenheck), einem geräumigen Kofferraum, einem in der Fahrzeugfront montierten Motor mit Wasserkühlung und einem modernen Fahrwerk, der schneller, sparsamer und komfortabler war als der mittlerweile betagte Wolfsburger VW Käfer mit seinem luftgekühlten Boxermotor. Der heckgetriebene Kadett A lag mit seinem Preis von 5.075 Mark (ca. 2.550 Euro) zwar um 875 Mark (ca. 440 Euro) über dem VW Käfer – doch dafür gab es einen entsprechenden Mehrwert. Auch wenn es in Wolfsburg nicht gern gehört wurde: Der Kadett A war zweifellos ein moderneres Automobil als der VW Käfer.
Der offensichtliche technische Abstand zwischen den beiden Kontrahenten war Anlass für eine zum Teil recht provokative Werbekampagne von Opel, die potenziellen Kunden deutlich vor Augen führte, dass der Käfer nicht mehr den aktuellen Stand der Technik repräsentierte. Diesem Urteil schlossen sich zahlreiche Autofahrer durch einen Kauf an, so dass bis zum Jahr 1965 bereits eine halbe Million Kadett A produziert wurden. Im September 1965 rollte dann mit dem Kadett B bereits das Nachfolgemodell von den Bändern in Bochum. Der Werbeslogan für den Kadett lautete: »Opel Kadett. Das Auto«.
1968 stimmten die Zahlen bei VW wieder, die kurzzeitige Rezession war überstanden. Doch so richtig zufrieden konnte die Konzernleitung nicht sein: Der Käfer hatte zweifellos seine beste Zeit hinter sich und die Verkaufszahlen des Typ 3 lagen weit hinter denen des Typ 1. Das Ende des im Gegensatz zu seinem Vorgänger völlig glücklosen neuen Karmann Ghia 1600 (Typ 34) wurde bereits im Sommer 1968 beschlossen und die Fertigung eingestellt. Lediglich 42.505 Fahrzeuge waren gebaut worden. Kurios dabei: Der alte Karmann Ghia (Typ 14), der bereits seit 1955 im Programm war, sollte weitergebaut und sogar modellgepflegt werden.
Einen weiteren Grund für die verhaltene Stimmung lieferte das neue Mittelklassemodell VW 411, das 1968 auf den Markt gekommen war. Der ebenfalls mit luftgekühltem Boxermotor und Heckantrieb gebaute VW 411 (Typ 4) wurde seiner Rolle als Limousine der gehobenen Mittelklasse in keiner Weise gerecht, was sich in den schlechten Verkaufszahlen widerspiegelte. Bei einem Vergleichstest des Fachmagazins AUTO MOTOR UND SPORT belegte das neue Modell gar den letzten Platz aller sechs getesteten Fahrzeuge.4
Ein Fachautor brachte es auf den Punkt: »Verglich man den 411 mit allen Konkurrenten seiner Klasse, so fiel auf, daß er der einzige mit Luftkühlung und Heckmotor war; der teuerste und größte aller VWs. [...] Ansonsten war er einfach nicht auf dem Niveau der betrachteten Hubraumklasse, vor allem nicht in seinen Fahrleistungen. Und in Deutschland begann man sich laut zu fragen, ob VW weiterhin als Zentralfigur des wirtschaftlichen Aufschwungs bewertet werden könne.«5
»Der Große aus Wolfsburg« (VW-Werbeslogan) verfügte immerhin über eine moderne selbsttragende Karosserie, allerdings war er sogar teurer als der jüngst präsentierte Audi 75. Hinzu kam: Wer sich als Interessent einen VW 411 in den Ausstellungsräumen von VW ansah, ging nicht selten als Käufer eines neuen, deutlich moderner konzipierten Audi 100 wieder hinaus. Dass viele VW-Betriebe auch Fahrzeuge von Audi verkauften, machte sich in einem direkten und für die Schwestermarke VW teuren Kannibalisierungseffekt bemerkbar.
Ein Grund zur Trauer war für viele Wolfsburger der Tod von Ex-Konzernlenker Heinrich Nordhoff, der seit 1948 als Generaldirektor der Volkswagenwerk GmbH und seit dem Jahr 1960 als Vorstandsvorsitzender der Volkswagenwerk AG fungiert hatte. »Mister Volkswagen«, wie er anerkennend genannt wurde, hatte VW nach dem Krieg zur jetzigen Größe geführt. Neuer VW-Chef wurde Dr. Kurt Lotz, der am 1. Mai 1968 den Posten des Vorstandsvorsitzenden der Volkswagenwerk AG übernahm.