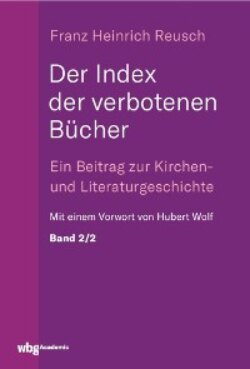Читать книгу Der Index der verbotenen Bücher. Bd.2/2 - Franz Reusch - Страница 9
86. Bischöfliche Bücherverbote.
ОглавлениеSeitenstücke zu den Löwener und Pariser Indices des 16. Jahrhunderts gibt es nicht, obschon auch nach dem J. 1600 die Sorbonne sehr viele, die Löwener und andere theologische Facultäten einzelne Bücher censurirten. Dagegen haben wir einen von dem Erzbischof von Paris, freilich im Auftrage des Parlamentes veröffentlichten Index kennen gelernt (S. 57) und zwei Indices von Prager Erzbischöfen (S. 63). Auch das Decret des Erzbischofs Precipiano vom J. 1695 (S. 59) ist eine Art von Index. Einzelne Bücherverbote von Bischöfen sind, so weit sie von Bedeutung waren, gelegentlich erwähnt worden. Solche sind auch in der neuern Zeit manche erlassen worden. Einige derselben können sogar im gewissen Sinne als Indices bezeichnet werden, sofern darin eine grössere Zahl von Schriften verboten wird. So namentlich ein Pastoralschreiben des Augsburger Generalvicariates vom J. 1820 „in Betreff der neuen schwärmerischen aftermystischen Lehren und Secten“, dem ein Verzeichniss von 55 Schriften angehängt ist, ferner ein Erlass der Bischöfe der Kirchenprovinz Turin und eine Pastoral-Instruction des Bischofs von Luçon, beide vom J. 1852.
Das Augsburger Pastoralschreiben von 1820 steht in Mastiaux’ Lit.-Ztg. 1820, No. 35, S. 129—171. In dem beigefügten „Verzeichniss mehrerer Bücher und Büchgen, welche von der aftermystischen Secte in Umlauf gebracht werden“, stehen einige Schriften von Ignaz Lindl (A. D. B. 18, 698), eine von Feneberg, zwei von Bernières-Louvigni, einige von G. Tersteegen, Joh. Arndt, Gottfr. Arnold und L. v. Zinzendorf und viele anonyme. Am Schlusse steht: Der besondern Aufmerksamkeit werden noch empfohlen die Schriften der Mad. Guyon, Fénélons Lehrsätze der Heiligen, Taulerus’ Werke nach protestantischen Ausgaben.
Die 10 Bischöfe der Kirchenprovinz Turin, an der Spitze der Erzbischof Luigi Fransoni, veröffentlichten unter dem 2. Oct. 1852 eine gemeinsame Notificanza über verbotene Bücher und Zeitungen (Ami de la rel. 158, 449). Sie geben darin zunächst die Censuren an, die auf das Lesen verbotener Bücher gesetzt seien, sagen dann, zu den verbotenen Schriften gehörten diejenigen, die im Index ständen oder unter die Regeln des Index fielen, und zählen einige Classen von Schriften auf, die nach diesen Regeln verboten seien, u.a. die Bücher der Haeretiker über irgendwelche Gegenstände, welche nicht von dem Ortsbischof approbirt, Bibeln oder einzelne biblische Bücher in der Volksprache, die nicht vom h. Stuhle approbirt oder mit Anmerkungen von Kirchenvätern oder katholischen Gelehrten versehen und vom Bischof approbirt, zuletzt Bücher, welche von dem Ortsbischof als ketzerische, verdächtige … Sätze enthaltend verboten sind. „Als solche, heisst es dann weiter, erklären wir gemeinsam nach reiflicher Prüfung und nach Befragung von Theologen und Canonisten folgende Bücher: I Valdesi, cenni storici per Amedeo Bert; La confessione, saggio dommatico storico di L. De Sanctis; Gustavo, corrispondenza religiosa; Libera propaganda, diretta da A. Borella e comp.; Corso completo di diritto pubblico elementare, opera del Marchese Diego Soria; Gli orrori dell’ Inquisizione; I misteri di Torino e di Roma; La strenna del fischietto; L’almanacco degli operai; La filosofia delle scuole italiane di Ausonio Franchi (diese Schrift wurde 7. Oct. 1852 auch in Rom verb.; die anderen stehen nicht im Index). Ferner verbieten wir, als geeignet, der Sittlichkeit und dem Glauben zu schaden, die kirchliche Hierarchie und die Fürsten zu diffamiren, den Unterschied zwischen Tugend und Laster zu verwischen, folgende Blätter: Gazetta del popolo, L’Opinione, La Strega o Maga, Il Fischietto, L’Italia e Popolo, Il Monitore de’ communi italiani, unbeschadet anderer Verbote, welche einzelne von uns für ihre Diöcesen erlassen haben oder werden. Diese Bücher und Blätter darf niemand drucken, lesen, verbreiten, verleihen oder behalten; wer sie zu seiner Verfügung hat, hat sie dem Bischof abzuliefern; nur die Blätter darf man selbst verbrennen.“ Dann wird das Breve vom 22. Aug. 1851 gegen Prof. Nuytz in Erinnerung gebracht und bemerkt, in diesem Breve sei implicite auch das Schriftchen Il Prof. Nuytz a’ suoi concittadini verboten; den in dem Breve angedrohten Censuren verfalle auch derjenige, der die Bücher nicht gelesen, aber unterlassen habe, sie an den Bischof abzuliefern. — In einer Anmerkung werden Verbote von Zeitungen durch andere Bischöfe erwähnt, u.a. des Sior Antonio Rioba durch den Patriarchen von Venedig 1848, das Verbot des Avvenire und die Verwarnung der Redacteure des Mediterraneo und des Ordine durch den Bischof von Malta 1851. In einer andern Anmerkung werden diejenigen im Römischen Index stehenden Schriften aufgezählt, die in der Kirchenprovinz Turin am meisten verbreitet seien: die Bibelübersetzung von Diodati, Machiavelli’s Principe, die Werke von Voltaire, Rousseau, Volney, de la Mennais, Proudhon, Eugène Sue (besonders Les mystères de Paris), Maurette, Alfieri, Gioja, Botta, Gioberti, Rosmini, Pilati, Rossetti, Maineri, Bianchi-Giovini1), Tommaseo, La buona novella, Il Costante, Gesù davanti un consiglio di guerra, Non più tiara (italienisch und französisch).
Die Instruction pastorale de Monseigneur l’évêque de Luçon sur l’Index des livres prohibés, Paris 1852, 238 S. 8., erwähnt das Mandatum Leo’s XII. von 1825 (p. 79; s.o. S. 882) und enthält p. 201—222 einen Index diocésain, in welchem die von dem Bischof, — er hiess Jacques-Marie-Joseph Baillès, — seit seinem Amtsantritt im J. 1845 und einige von seinem Vorgänger Soyer und die in Rom seit 1845 verbotenen Bücher in Ein Alphabet geordnet sind. Von den von den beiden Bischöfen verbotenen Büchern, die mit einem * bezeichnet sind, verdienen erwähnt zu werden: die Biographie universelle von Hoefer, das Bibelwerk von Is. Cahen (das A. T. hebr. und französisch mit Noten, 20 vol. 8.), Livre d’instruction morale et religieuse, nouv. éd. s. a., 218 p. 12., sans nom d’auteur, mais attribué à M. Victor Cousin; Ad. Rion, Bibliothèque pour tout le monde, 50 vol. 18.; Alphabet et premier livre de lecture, autorisé par le Conseil royal; A. Bossu, Anthropologie, contenant l’anatomie etc., 2 vol. 8. avec atlas de 20 planches; Le journal La Presse (die einzige Zeitung, die erwähnt wird) und 105 (nicht speciell aufgezählte) protestantische Broschüren der Société des traités religieux. — Die Instruction enthält sonst allerlei über den Index. P. 230 sagt der Bischof, er hoffe bald, entsprechend dem Wunsche des Provincialconcils von Bordeaux und dem Geiste der Kirche, erklären zu können, dass der ganze Römische Index in seiner Diöcese verbindlich sei; vorläufig beauftragt er p. 232 die Pfarrer, in der Predigt die Leetüre der im Index stehenden Schriften von E. Sue, G. Sand, Balzac, A. Esquiros und Proudhon zu verbieten und zu erklären, dass nach dieser Publication der Index bezüglich dieser Bücher verbindlich sei. P. 197 spricht er von den Vorschriften des Index für die Buchhändler, weist aber doch p. 233 die Pfarrer nur an, den Buchhändlern ihrer Pfarrei begreiflich zu machen, combien ils attireraient de bénédictions sur leur commerce, wenn sie innerhalb eines Monates ihm ein vollständiges Verzeichniss der livres qui sont en vente zur Prüfung einsenden wollten. — Im Dec. 1853 publicirte der Bischof ein Avis important sur le colportage des mauvais livres (Ami de la rel. 163, 241), worin er es rügt, dass in den von der Regierung aufgestellten Verzeichnissen der Bücher, die colportirt werden dürften, auch solche ständen, welche unter die Regeln des Index fielen, wie protestantische Bibeln und Tractätchen, oder speciell im Index ständen, wie Schriften von Voltaire, Marmontels Bélisaire und Pascals Provincialbriefe, und ausserdem schlechte Romane und dgl. von Dumas, Soulié, Karr und de Kock. (Der Bischof von Périgueux nahm 1854 den Index zum Thema seines Fasten-Hirtenbriefes, wurde dafür vom Papste belobt und publicirte das Belobungsbreve; Ami de la rel. 165, 170.) — Im Jan. 1856 wurde Baillès von Pius IX. auf Veranlassung der kaiserlichen Regierung, der er als Legitimist missliebig geworden, nach Rom beschieden und zur Resignation veranlasst (Ami de la rel. 172, 228). Er blieb in Rom, wurde Consultor der Index-Congr. und hat ohne Zweifel das Verbot einiger französischen Schriften veranlasst. 1866 veröffentlichte er eine Vertheidigung des Index gegen die Philippica Roulands in der Senatssitzung vom 31. Mai 18651).
Bei den Verhandlungen über das baierische Concordat von 1817 wurde in Rom die Aufnahme eines Artikels gefordert, wonach kein Buch ohne die Zustimmung des Bischofs gedruckt oder in das Land gebracht werden sollte. Der Artikel 13 erhielt aber schliesslich die Form: „Wenn die Bischöfe im Lande gedruckte oder in das Land gebrachte Bücher, welche etwas dem Glauben, den guten Sitten oder der kirchlichen Disciplin Widersprechendes enthalten, der Regierung anzeigen, so wird diese unverzüglich für ihre Unterdrückung sorgen“1). Bei einem Buche von Brendel wurde ein vergeblicher Versuch gemacht, diese Bestimmung durchzuführen (§ 109).
In dem österreichischen Concordate von 1855 lautete Art. 9: Archiepiscopi . . propriam auctoritatem omnimoda libertate exercebunt, ut libros religioni morumque honestati perniciosos censura perstringant et fideles ab eorundem lectione avertant. Sed et Gubernium ne ejusmodi libri in Imperio divulgentur, quovis opportuno remedio cavebit. In den Separatartikeln zum Concordat, die in einem Schreiben des Erzbischofs Rauscher an den Cardinal Viale Prelà vom 18. Aug. 1855 formulirt wurden (Coll. Lac. 5, 1229), heisst es zu Art. 9: die Regierung werde den betreffenden Wünschen der Bischöfe gebührende Rechnung tragen; doch bedürfe es grosser Vorsicht um die Sache nicht schlimmer zu machen; die Verhältnisse seien nicht in allen Theilen des Reiches dieselben: in den lombardisch-venetianischen Provinzen sei es leichter, schlechte Bücher auszuschliessen als anderswo; überdies sei in Italien vieles, dessen man in Deutschland überdrüssig geworden, noch neu und darum noch von verderblichem Einflusse. Das Concordat und die Separatartikel wurden mit einem Schreiben des Grafen Thun vom 25. Jan. 1856 den Bischöfen übersandt und darin darauf hingewiesen, dass in den Separatartikeln die Gründe hervorgehoben seien, weshalb von Repressivmassregeln gegen Druckschriften ein vorsichtiger Gebrauch zu machen sei. Mittlerweile hatten aber bereits im Dec. 1855 einige Bischöfe in dem österreichischen Italien, namentlich der Erzbischof Romilli von Mailand und der Patriarch von Venedig auf Grund des Concordates verordnet: es seien ihnen alle Manuscripte vor dem Drucke vorzulegen (was doch selbst im Kirchenstaate nicht mehr verlangt wurde, S. 885), und für den Verkauf aller von aussen importirten Bücher mit Ausnahme der notorisch erlaubten sei ihre Erlaubniss nachzusuchen; wer verbotene Bücher verkaufe gegen den werde die Hülfe des weltlichen Armes angerufen werden. Der Bischof Speranza von Bergamo bezeichnete sogar in einem Hirtenbriefe vom 16. Jan. 1856 die Aufhebung der Censur als ein Werk des Teufels (er verbot zugleich die Zeitschrift Il crepusculo). Die Wiener Kirchenzeitung erklärte darauf (1856, No. 5, ohne Zweifel im Auftrage Rauschers): die italienischen Bischöfe hätten sich über ihre Verordnungen mit dem Erzbischof Rauscher nicht vorher benommen; an eine Präventivcensur sei bei Art. 9 des Concordates gar nicht gedacht; in Wien würden nicht einmal Erbauungsbücher und kirchliche Schriften anderer Art zur Censur verlangt und die seit 8 Jahren bestehende Praxis werde nicht geändert werden. Graf Thun forderte die italienischen Bischöfe auf, ihre Erlasse zurückzunehmen, liess sie in dem Giornale di Milano desavouiren (Wiener K.-Z. 1856, 108) und erklärte in einem Erlasse an alle Länderchefs vom 25. Jan. 1856: die Regierung könne sich nicht auf Grund des Art. 9 des Concordates als blosse Vollstreckerin der vom kirchlichen Forum ergangenen Erkenntnisse ansehen, habe sich vielmehr die volle Selbständigkeit sowohl bei Beurtheilung der Bücher als auch bei Entscheidung der Frage, welche Massregeln gegen die für verderblich erkannten anzuwenden seien, gewahrt und werde, wenn in einzelnen Fällen die Bischöfe ihre Mitwirkung zur Unterdrückung der von ihnen als verderblich bezeichneten Bücher für wünschenswerth hielten, über ihr Ansuchen die Frage, ob und in welcher Weise auf Grundlage der bestehenden Gesetze diesem Ansuchen entsprochen werden könne, sorgfältig erwägen1). Die Regierung brachte das Vorgehen der Bischöfe auch in Rom zur Sprache, und 10. Nov. 1857 meldete der Gesandte Graf Colloredo, der Cardinal-Staatssecretär habe ihm erklärt, er werde dem Bischof von Bergamo die Missbilligung des h. Stuhles aussprechen und einschärfen, sich künftig in etwa vorkommenden ähnlichen Fällen an die Regierungsbehörden zu wenden und nicht ohne sie vorzugehen.
Unter dem 24. Aug. 1864 richtete die Index-Congregation an alle Bischöfe ein von dem Präfecten Card. Altieri und dem Secretär P. Modena unterzeichnetes Rundschreiben folgenden Inhalts (Civ. catt. 5, 12, 488): Es erscheinen jetzt sehr viele schlechte Drucksachen, namentlich kleine und wohlfeile Schriften und Zeitungen. Sie werden vielfach bei der Index-Congregation denuncirt; da diese aber durch die immer zunehmende Zahl der Denunciationen aus der ganzen christlichen Welt überbürdet ist, kann sie nicht alle Angelegenheiten rasch erledigen. Das hat zur Folge, dass ein Verbot jener Schriften mitunter erst erfolgt, wenn das Lesen derselben schon grossen Schaden angerichtet hat. Um diesem Uebelstande abzuhelfen, hat der Papst uns beauftragt, das Mandatum Leo’s XII. vom 26. März 1825 in Erinnerung zu bringen, was wir mit dieser Lettera eccitatoria thun. Damit man aber nicht die Bücherverbote der Bischöfe unter dem Vorgeben, diese seien zu solchen nicht berechtigt, oder unter einem andern Vorwande geringschätzen zu dürfen glaube, werden die Bischöfe hiermit ermächtigt, in dieser Sache als Delegaten des apostolischen Stuhles vorzugehen. Es sollen jedoch dem apostolischen Urtheil alle diejenigen Schriften vorbehalten bleiben, welche eine gründlichere Prüfung erheischen und bei denen nur ein Urtheil der höchsten Autorität eine heilsame Wirkung erzielen kann. — Man kann nicht sagen, dass die Bischöfe von dieser neuen delegirten Gewalt einen ausgedehnten Gehrauch gemacht1), und ebensowenig, dass die Index-Congregation seitdem in ihrer Thätigkeit eine Aenderung habe eintreten lassen.
Catalogue des ouvrages, écrits et dessins de toute nature poursuivis, supprimés ou condamnés depuis le 21. Oct. 1814 jusqu’au 31. Juillet 1877. Edition entièrement nouvelle, considérablement augmentée … Par Fernand Drujon. Paris 1879 * XXXVII und 430 S. gr. 8. — Drujon verzeichnet p. VIII 8 ältere Zusammenstellungen. Eine bis zum J. 1847 gehende ist bei Migne, Dict. des hérésies 2, 1229 abgedruckt.
1) Bianchi-Giovini polemisirt gegen die Notificanza in der Vorrede der Critica degli evangeli und erwähnt dabei, dass vier von seinen hier aufgezählten Büchern zu Mailand gedruckt seien und die österreichische Censur passirt hätten.
1) La Congrégation de l’Index mieux connue et vengée par l’ancien Evêque de Luçon, Paris 1866, III, VII und 616 S. 8. — Rouland, damais Gouverneur de la Banque de France, hatte u.a. gesagt: „Die ultramontane Partei hatte noch ein anderes Mittel, um alles zu ruiniren, was es in der Kirche noch von freien Meinungen gab. Sie nahm ihre Zuflucht zu der öftern Anwendung von Entscheidungen der Index-Congregation. Was ist die Index-Congr.? Die Incarnation des Despotismus, ein Tribunal, welches verdammt, ohne zu hören. Unsere Väter wachten über ihre Rechte. In der gallicanischen Kirche wurden die Entscheidungen des Index nie anerkannt. Warum nicht? Weil die so fromme und gelehrte französische Kirche ein Gefühl der Würde hatte, welches wir nicht mehr haben, weil sie nur den Papst und den König kannte und nicht begriff, dass der Papst sein Gewissen und sein Urtheil einer Congregation delegiren könne, damit sie mit göttlicher Gewalt auftrete. Unsere Väter hatten Recht. Wenn man zu ihrer Zeit verhandelte, wusste man, dass man direct mit dem Papste verhandelte. Nichts ist gefährlicher, nichts ungerechter als ein Tribunal, welches verdammt, ohne gehört zu haben; und ein solches Tribunal sollte einen Bischof verurtheilen, einen Priester brandmarken dürfen? Nein, nein.“ — Den Vorwurf, die Bücherverbote seien in neuester Zeit zahlreicher geworden, widerlegt Baillès p. 208 mit Ziffern: unter Gregor XVI., der 14 Jahre regierte, wurden 110 französische, 7 lat. Schriften verb., nur 24 weniger als in den ersten 19 Regierungsjahren Pius’ IX. In den 17⅔ Jahren Benedicts XIV. wurden 133 franz., 92 lat., in den 20⅓ Jahren Clemens’ XI. 183 franz., 305 lat. Schriften verb. u. s. w.
1) Sicherer, Staat und Kirche in Bayern, 1874, S. 65. 118. 145. 218. Deutscher Merkur 1874, 116.
1) Darmst. Allg. K.-Z. 1856, No. 11. 26. Allg. Ztg. 1856, 9. 14. 17. 21. 40. 59. Theol. Lit.-Bl. 1871, 228. Unwillige Aeusserungen C. Cantù’s über den Mailänder Erlass in den Lettere di Gino Capponi 3, 171.
1) Phillips, Kirchenr. 6, 622. 624 macht den Bischöfen darüber Vorhaltungen.