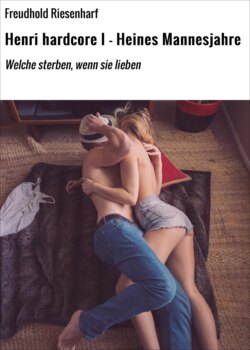Читать книгу Henri hardcore I - Heines Mannesjahre - Freudhold Riesenharf - Страница 5
3: Kantiana
ОглавлениеDer alte Fontenelle habe vielleicht Recht gehabt, als er sagte: Wenn ich alle Gedanken dieser Welt in meiner Hand trüge, so würde ich mich hüten, sie zu öffnen. Er, Heine, seinerseits denke anders: Hätte er alle Gedanken dieser Welt in seiner Hand – er würde uns vielleicht bitten, ihm die Hand gleich abzuhauen; auf keinen Fall hielte er sie so lange verschlossen. Er eigne sich nicht dazu, ein Kerkermeister der Gedanken zu sein:
Bei Gott! ich lass sie los. Mögen sie sich immerhin zu den bedenklichsten Erscheinungen verkörpern, mögen sie immerhin wie ein toller Bacchantenzug alle Lande durchstürmen, mögen sie mit ihren Thyrsusstäben unsere unschuldigsten Blumen zerschlagen, mögen sie immerhin in unsere Hospitäler hereinbrechen und die kranke alte Welt aus ihren Betten jagen – es wird freilich mein Herz sehr bekümmern, und ich selber werde dabei zu Schaden kommen! Denn ach! ich gehöre ja selber zu dieser kranken alten Welt, und mit Recht sagt der Dichter: Wenn man auch seiner Krücken spottet, so kann man darum doch nicht besser gehen. Ich bin der Kränkste von euch allen und um so bedauernswürdiger, da ich weiß, was Gesundheit ist!
Er weiß, es ist der allenthalben triumphierende wissenschaftliche Realismus, der allen alten Glaubensvorstellungen, auch seinen eigenen, den Garaus macht, und gegen dessen ultimativen Triumph kein Kraut gewachsen ist. In dunkeln Zeiten wurden die Völker am besten durch die Religion geleitet, wie in stockfinstrer Nacht ein Blinder unser bester Wegweiser ist; er kennt dann Wege und Stege besser als ein Sehender – Es ist aber töricht, sobald es Tag ist, noch immer die alten Blinden als Wegweiser zu gebrauchen – Man sagt, die Nachtgeister erschrecken, wenn sie das Schwert eines Scharfrichters erblicken. – Wie aber müssten sie erst erschrecken, wenn man ihnen Kants Kritik der reinen Vernunft entgegenhalte! Dieses Buch sei das Schwert, womit der Deismus hingerichtet in Deutschland.
Die Lebensgeschichte des Immanuel Kant sei schwer zu beschreiben. Denn er habe weder ein Leben noch eine Geschichte gehabt. Er lebte ein mechanisch geordnetes, fast abstraktes Hagestolzleben in einem stillen abgelegenen Gässchen zu Königsberg, einer alten Stadt an der nordöstlichen Grenze Deutschlands.
Er, Harry, glaube nicht, dass die große Uhr der dortigen Kathedrale leidenschaftsloser und regelmäßiger ihr äußeres Tagewerk vollbrachte wie ihr Landsmann Immanuel Kant. Aufstehen, Kaffeetrinken, Schreiben, Kollegienlesen, Essen, Spazierengehn, alles hatte seine bestimmte Zeit, und die Nachbarn wussten ganz genau, dass die Glocke halb vier sei, wenn Immanuel Kant in seinem grauen Leibrock, das spanische Röhrchen in der Hand, aus seiner Haustür trat und nach der kleinen Lindenallee wandelte, die man seinetwegen noch jetzt den Philosophengang nennt. Achtmal spazierte er dort auf und ab, in jeder Jahreszeit, und wenn das Wetter trübe war oder die grauen Wolken einen Regen verkündigten, sah man seinen Diener, den alten Lampe, ängstlich besorgt hinter ihm dreinwandeln, mit einem langen Regenschirm unter dem Arm, wie ein Bild der Vorsehung.
Sonderbarer Kontrast zwischen dem äußeren Leben des Mannes und seinen zerstörenden weltzermalmenden Gedanken! Wahrlich, hätten die Bürger von Königsberg die ganze Bedeutung dieses Gedankens geahnt, sie würden vor jenem Manne eine weit grauenhaftere Scheu empfunden haben als vor einem Scharfrichter, vor einem Scharfrichter, der nur Menschen hinrichtet – aber die guten Leute sahen in ihm nichts anderes als einen Professor der Philosophie.
Mehr übrigens scheint er aus heutiger Sicht auch nicht gewesen! Harry sitzt dem populären Vorurteil auf, Kant hätte etwas wirklich Revolutionäres geleistet; dabei ist der Grund der Kantischen Theorie eine ausgemachte Binse. Die Philosophen vor Kant, meint er, hätten zwar über den Ursprung unserer menschlichen Erkenntnis nachgedacht und seien, wie bereits gezeigt, in zwei verschiedene Wege geraten, je nachdem sie Ideen a priori oder Ideen a posteriori – gemeint ist die Existenz synthetischer Ideen a priori – annahmen; über unser Erkenntnisvermögen selber oder seine Grenzen sei weniger nachgedacht worden. Dies sei nun die Aufgabe Kants gewesen, er habe unsere menschliche Erkenntnisfähigkeit einer schonungslosen Prüfung unterworfen sowie die ganze Tiefe dieses Vermögens und alle seine Grenzen erkannt.
Da habe er nun gefunden, dass wir gar nichts wissen könnten von sehr vielen Dingen, mit denen wir früher in vertrautester Bekanntschaft zu stehen vermeinten: Das war sehr verdrießlich. Aber es war doch immer nützlich, zu wissen, von welchen Dingen wir nichts wissen können. Wer uns vor nutzlosen Wegen warnt, leistet uns einen ebenso guten Dienst wie derjenige, der uns den rechten Weg anzeigt. Kant bewies uns, dass wir von den Dingen, wie sie an und für sich selber sind, nichts wissen, sondern dass wir nur insofern etwas von ihnen wissen, als sie sich in unserem Geiste reflektieren …
Da wir von den Dingen nur insoweit etwas wissen können, als sie uns durch Erscheinung kundgeben, und da also die Dinge nicht, wie sie an und für sich selbst sind, sich uns zeigen: so hat Kant die Dinge, insofern sie erscheinen, Phänomena, und die Dinge an und für sich Noumena genannt. Nur von den Dingen als Phänomena können wir etwas wissen, nichts aber können wir von den Dingen wissen als Noumena. Letztere sind nur problematisch, wir können weder sagen, sie existieren, noch: sie existieren nicht. Ja, das Wort Noumen ist nur dem Wort Phänomen nebengesetzt, um von Dingen, insoweit sie uns erkennbar, sprechen zu können, ohne in unserem Urteil die Dinge, die uns nicht erkennbar, zu berühren.
Dass das alles aber bloßes Wortgeklingel und eine ausgemachte Bieridee ist, scheint ihm zu entgehen; und ebenso, dass Kant uns das Beispiel auch nur eines einzigen Dings, von dem wir angeblich nichts wissen könnten, schuldig bleibt! ,Erkenntnis' ist ja schon ihrem Begriff nach eine Abbildung und Repräsentation der Dinge – anstelle ihrer identischen Replikation – in unserem Denken. Das Problem ist daher nicht, dass wir nur in den Kategorien unseres menschlichen Denkens denken können – Denken kann man tautologischerweise immer nur in ,Denkkategorien' –, sondern vielmehr: ob diese subjektiven Kategorien de facto auch geeignet sind, die Kategorien des absolut Seienden adäquat zu erfassen. Und zwar nicht nur möglichst adäquat, sondern auch möglichst vollständig zu erfassen! Sind sie das, dann lässt unsere menschliche Erkenntnisfähigkeit offenbar auch gar nichts zu wünschen übrig.
Eben das ist aber genau die wissenschaftliche Erfahrung: De facto sind von Demokrit bis heute keine Kategorien des objektiv Seienden aufgetaucht, bei denen es prinzipiell nicht möglich wäre, oder in Zukunft möglich sein sollte, sie in fortschreitender Forschung – von Anfang bis Ende der Welt – auch befriedigend zu erfassen. Es gibt also überhaupt keine ,Noumena', das Wort ist ein bloßer metaphysischer Grenzbegriff, weder Fisch noch Fleisch, eine Leerformel und taube Nuss. In Wahrheit ist Kants Lehre – wie spätestens Hans Reichenbach zeigte – bloß die Wissenschaftstheorie seiner Zeit: der Newtonschen Mechanik; und so ist, soweit diese physikalisch überholt ist, auch die Kantische Lehre nur ein kurioses kulturelles Relikt.
Sei man – so Kant – vor ihm davon ausgegangen, dass unsere menschliche Erkenntnis sich nach den Dingen richten müsse, so wolle nun er einmal davon ausgehen, dass die Dinge sich nach unserer Erkenntnis richten. Das ist aber eine Schnapsidee a priori: Seit wann würde die objektive Welt sich denn nach der menschlichen Erkenntnis richten? Natürlich muss unsere Erkenntnis sich nach dem objektiv existierenden Seienden richten – die Prinzipien des Denkens selbst sind ein solch objektiv Seiendes –, und es gibt auch keinen Grund, warum sie das nicht fertigbringen sollte. Das ist der Naturwissenschaft schon zur Zeit Heines klar, weswegen sie sich von damals bis heute um Kant auch nie etwas scherte. Harry aber ist naturwissenschaftlich zu unbedarft, um nicht einem einfachen Taschenspielertrick auf den Leim zu gehen.
Was Kant nicht erkennt – schon auf Grund des begrenzten wissenschaftlichen Erkenntnisstands seiner Zeit nicht erkennen kann –, das ist: dass die menschliche Intelligenz als Funktion des menschlichen Gehirns ein universelles informationsverarbeitendes Instrument ist, imstande, das Universum mittels der Naturwissenschaft buchstäblich in allen seinen mikrokosmischen und megakosmischen Dimensionen zu durchdringen. Das Menschenhirn ist eine universelle Informationsverarbeitungsmaschinerie, die durch keinerlei irgend vorbedingte oder präjudizierende Strukturen gehandikappt ist. Das mathematisch-physikalische Denken passt aus demselben Grund auf die Welt, warum unser Geist auch sonst auf die Welt passt. Unser Geist ist ein universelles Simulationsvermögen, das die objektiv existierende Welt mit den Mitteln des erkennenden Subjekts simuliert. Die mathematischen Begriffe sind, wie alle Begriffe, Vorstellungen unseres Geistes, die letztlich durch Zell- und Molekülkomplexe im Gehirn materiell realisiert sind.
Unser Denken ist eine Art Molekülmanipulationsvermögen, mittels dessen wir materielle Verbindungen von einem molekularen Gebilde unseres Gehirns zu einem anderen schlagen. Die Simulation geschieht in der Form neuronaler Architektur. Speziell das logische Schließen scheint ein bestimmter mechanischer Übergang von einem molekularen Gebilde zum andern, und werden die Regeln dieses Übergangs eingehalten, dann sind diese Schlüsse ,logisch'.
Die Regeln, denen der logische Übergang von einem neuronalen Komplex zum andern gehorcht, sind aber dieselben wie die, denen die Prozesse in der realen Außenwelt auch gehorchen, die durch sie abgebildet werden: die objektiven Naturgesetze. Die Gehirnvorgänge funktionieren ja selbst nach diesen physikalisch-chemischen Gesetzen. Ist also eine bestimmte gehirnlich-molekulare Konstellation das subjektive Korrelat einer außersubjektiven Gegebenheit, und führt ein solch ,logischer' materieller Übergang zu einer anderen damit konsistenten gehirnlich-molekularen Konstellation, dann ist auch diese das Korrelat einer realen Beziehung der Außenwelt: Das ist die naturalistische Erklärung dafür, warum die Mathematik auf die Welt passt, auch wenn diese molekularen Gebilde und ihre Verbindungen noch meilenweit davon entfernt sind, neurobiologisch genau bekannt und erforscht zu sein. –
Immerhin habe Kant dem traditionellen Gott – dem theos wie dem deus – den Garaus gemacht, auch wenn er als Noumen noch weiter ein Schattendasein fristet. Damit, so Heine, sei der Deismus im Reiche der spekulativen Vernunft erblichen. Diese betrübende Todesnachricht bedürfe vielleicht einiger Jahrhunderte, ehe sie sich allgemein verbreite – wir aber hätten längst Trauer angelegt. De profundis!
Ihr meint, wir könnten jetzt nach Hause gehn? Beileibe! es wird noch ein Stück aufgeführt. Auf die Tragödie folge das Satyrspiel. Kant habe bis hier den unerbittlichen Philosophen traciert, er habe den Himmel gestürmt, er habe die ganze Besatzung über die Klinge springen lassen, der Oberherr der Welt schwimme unbewiesen in seinem Blute, es gebe jetzt keine Allbarmherzigkeit mehr, keine Vatergüte, keine jenseitige Belohnung für diesseitige Enthaltsamkeit, die Unsterblichkeit der Seele liege in den letzten Zügen – das röchle, das stöhne –, und der alte Lampe stehe dabei mit seinem Regenschirm unterm Arm, als betrübter Zuschauer, und Angstschweiß und Tränen rinnen ihm vom Gesicht.
Da habe Kant sich erbarmt und gezeigt, dass er nicht bloß ein großer Philosoph sei, sondern auch ein guter Mensch, und er überlegte, und halb gutmütig und halb ironisch sprach er: „Der alte Lampe muss einen Gott haben, sonst kann der arme Mensch nicht glücklich sein – der Mensch soll aber auf der Welt glücklich sein – das sagt die praktische Vernunft – meinetwegen – so mag auch die praktische Vernunft die Existenz Gottes verbürgen.“ Infolge dieses Arguments unterscheide Kant zwischen der theoretischen Vernunft und der praktischen Vernunft, und mit dieser, wie mit einem Zauberstäbchen, belebe er den Leichnam des Deismus, den die theoretische Vernunft getötet, wieder.
Das ist aber, da es ja nur eine Wahrheit geben kann, und ein und dieselbe Intelligenz, die sie erkennt, ein blanker logischer Widerspruch! Das entgeht auch Heine nicht: Es gibt überhaupt nur eine Vernunft, nicht die theoretische Vernunft hie und die praktischen Vernunft da. Hat vielleicht Kant die Resurrektion nicht bloß des alten Lampe wegen, sondern auch der Polizei wegen vorgenommen? Hat er wirklich aus Überzeugung gehandelt? Hat er eben dadurch, dass er alle Beweise für das Dasein Gottes zerstörte, uns recht zeigen wollen, wie misslich es ist, wenn wir nichts von Gott wissen können? Er handelte da fast ebenso weise wie sein westfälischer Freund, welcher alle Laternen auf der Grohnderstraße zu Göttingen zerschlagen hatte und ihnen nun dort, im Dunkeln stehend, eine lange Rede hielt über die praktische Notwendigkeit der Laternen, welche er nur deshalb theoretisch zerschlagen habe, um ihnen zu zeigen, wie sie ohne dieselben nichts sehen könnten. –
Von Kant kommt er, gleichwie vom Regen in die Traufe, zu dessen Schüler Johann Gottlieb Fichte. Die Aufgabe, welche sich Fichte stellt, ist: Welche Gründe haben wir, anzunehmen, dass unseren Vorstellungen von Dingen auch Dinge außer uns entsprechen? Und dieser Frage gibt er die Lösung: Alle Dinge haben Realität nur in unserem Geist. Ist die Kritik der reinen Vernunft das Hauptbuch von Kant, so die Wissenschaftslehre das Hauptbuch Fichtes. Dieses sei gleichsam eine Fortsetzung des erstern. Die Wissenschaftslehre verweise den Geist ebenfalls in sich selbst. Wo aber Kant analysiere, da Fichte konstruiere. Die Wissenschaftslehre beginne mit einer abstrakten Formel (Ich = Ich), sie erschaffe die Welt hervor aus der Tiefe des Geistes, sie füge die zersetzten Teile wieder zusammen, sie mache den Weg der Abstraktion zurück, bis sie zur Erscheinungswelt gelangt. Diese Erscheinungswelt könne alsdann der Geist für notwendige Handlungen der Intelligenz erklären.
Mit einem Wort, anstatt einfach, wie die klar denkende Naturwissenschaft, vom objektiven Dasein der Welt auszugehen, sie als solche anzuerkennen und intellektuell korrekt und vollständig im Ideellen zu rekonstruieren, trampelt der deutsche Idealismus umgekehrt auf den Ideen herum und versucht, ihnen entsprechend die Welt zurechtzubiegen. Der Idealismus ist die Pubertät eines Denkens, das sich nicht vorbehaltlos zur realen Welt bekennt, sondern auf kindliche, kindische Weise die ,Priorität' des Geistes behauptet: prima philosophia. Bei Fichte komme als besondere Schwierigkeit mit hinzu, dass er dem Geist zumutet, sich selber zu beobachten, während er tätig ist. Das Ich soll über seine intellektuellen Handlungen Betrachtungen anstellen, während es sie ausführt. Der Gedanke soll sich selber belauschen, während er denkt, während er allmählich warm und wärmer und endlich gar wird. Diese Operation gemahne uns an den Affen, der am Feuerherd vor einem kupfernen Kessel sitzt und seinen eigenen Schwanz kocht. Denn er meinte: Die wahre Kochkunst besteht nicht darin, dass man bloß objektiv kocht, sondern auch subjektiv des Kochens bewusst wird und sich sozusagen gleich selber mitkocht.
Es sei ein eigener Umstand, dass die Fichtesche Philosophie immer viel von der Satire ausstehen musste. Mal sieht er eine Karikatur, die eine Fichtesche Gans vorstellt. Sie hat eine so große Leber, dass sie nicht mehr weiß, ob sie die Gans ist oder die Leber. Auf ihrem Bauch steht: Ich = Ich. Jean Paul habe die Fichtesche Philosophie in einem Buch betitelt Clavis Fichteana aufs heilloseste persifliert. Dass der Idealismus in seiner konsequenten Durchführung am Ende sogar die Realität der Dinge selbst leugne, das erschien dem großen Publikum als ein Spaß, der zu weit getrieben. Wir mokierten uns nicht übel über das Fichtesche Ich, welches die ganze Erscheinungswelt durch sein bloßes Denken produzierte. Unseren Spöttern kam dabei ein Missverständnis zustatten, das zu populär geworden, als dass ich es unerwähnt lassen dürfte. Der große Haufe hat nämlich gemeint, das Fichtesche Ich, das sei das Ich von Johann Gottlieb Fichte, und dieses individuelle Ich leugne alle anderen Existenzen. „Welche Unverschämtheit!“, riefen die guten Leute, „dieser Mensch glaubt nicht, dass wir existieren, wir, die wir weit korpulenter als er und als Bürgermeister und Amtsaktuare sogar seine Vorgesetzten sind!“ Die Damen fragten: „Glaubt er nicht wenigstens an die Existenz seiner Frau? Nein? Und das lässt Madame Fichte so hingehn?“ –
So groß scheint das Missverständnis der einfachen Leute aber auch wieder nicht. Denn leugnet der Idealismus in äußerster Konsequenz die Realität der Materie, dann muss der Idealist auch die Existenz der anderen Menschen leugnen, die ja aus Materie sind; übrig bleibt nur sein eigenes solipsistisches Ich, und auch Frau Fichte muss es sich gefallen lassen, tatsächlich nur in Fichtes Gedanken zu existieren. Entweder also, man akzeptiert die Existenz einer objektiv seienden, bewusstseinsunabhängigen Welt, dann ist man sofort beim Realismus und sieht in der Erkenntnis eine ideelle Rekonstruktion des objektiv Seienden mit den Mitteln des erkennenden Subjekts. Dann ist auch das erkennende Subjekt selbst Materie, und der Geist deren Funktion! Oder aber man verkennt die objektive Welt, dann landet man am Ende beim Solipsismus.
Da hilft es auch nichts, zu meinen: Das Fichtesche Ich ist aber kein individuelles Ich, sondern das zum Bewusstsein gekommene allgemeine Welt-Ich. Das Fichtesche Denken ist nicht das Denken eines Individuums, eines bestimmten Menschen, der Johann Gottlieb Fichte heißt; es ist vielmehr ein allgemeines Denken, das sich in einem Individuum manifestiert. So wie man sagt: es regnet, es blitzt usw., so sollte auch Fichte nicht sagen: „Ich denke“, sondern: „Es denkt“, „das allgemeine Weltdenken denkt in mir“.
Das ist aber keine Lösung. Wie nämlich kommt dieses allgemeine Weltdenken in meinen Kopf? Aus einer immateriellen, von der materiellen Ebene unabhängigen Dimension des Geistes? Sicherlich nicht, eine solche Dimension gibt es überhaupt nicht. Mein Denken ist allein und ausschließlich eine Funktion meines Gehirns, also eines materiell-energetischen Organs. Warum sollten wir das zu einem ,allgemeinen Weltdenken' verbrämen? Auch Fichtes Denken ist nur eine Funktion von Fichtes Hirn, und das ,allgemeine Weltdenken' höchstens das gesamte Denken aller einzelnen Gehirne der Welt.
Dies aber: dass aller Geist in der Welt nur der menschliche Geist ist, und der menschliche Geist identisch mit der Funktion des menschlichen Hirns – Geist also eine Funktion der Materie, und sonst nichts –, – dies ist der wissenschaftliche Realismus der Moderne, und als solcher Heine noch genauso wenig geheuer wie manch anderen seiner Zeitgenossen. Er selbst wird sich nicht schlüssig und fühlt sich widerwärtig berührt von den grellen Worten, womit Fichte unseren Gott für ein bloßes Hirngepinst erklärt und sogar ironisiert. Der Fichtesche Idealismus sei gottloser und verdammlicher als der plumpeste Materialismus. Was man in Frankreich den Atheismus der Materialisten nenne, wäre noch immer etwas Erbauliches, etwas Frommgläubiges, in Vergleichung mit den Resultaten des Fichteschen Transzendentalidealismus: Soviel weiß ich, beide sind mir zuwider. Beide Ansichten sind auch antipoetisch. Die französischen Materialisten haben ebenso schlechte Verse gemacht wie die deutschen Transzendentalidealisten.
Apropos ,plumpester Materialismus'. Dass er den Materialismus nicht anders denn plump sehen kann, beweist nur, dass er ihn nicht versteht. Er unterschätzt, was beim damaligen Stand der Physik allerdings auch nicht erstaunlich ist, bei weitem die Möglichkeiten der Materie – insonders der des Gehirns. Insbesondere scheint er der Ansicht, das Gehirn sei nicht dazu fähig, das menschliche Bewusstsein hervorzubringen. Er überschätzt also das Bewusstsein und unterschätzt das Gehirn.
Als Nächstes kommt er auf Fichtes Schüler Schelling. Ebenso wie Herr Joseph Schelling lehrte auch Fichte: Es gibt nur ein Wesen, das Ich, das Absolute; er lehrte Identität des Idealen und des Realen. In der Wissenschaftslehre hat Fichte durch intellektuelle Konstruktion aus dem Idealen das Reale konstruieren wollen. Herr Joseph Schelling aber dreht die Sache um: er sucht aus dem Realen das Ideale herauszudeuten. Von dem Grundsatz ausgehend, dass der Gedanke und die Natur ein und dasselbe seien, gelangt Fichte durch Geistesoperation zur Erscheinungswelt, aus dem Gedanken schafft er die Natur, aus dem Idealen das Reale; dem Herrn Schelling hingegen, während er von demselben Grundsatz ausgeht, werde die Erscheinungswelt zu lauter Ideen, die Natur wird ihm zum Gedanken, das Reale zum Idealen. Beide Richtungen, die von Fichte und die von Schelling, ergänzten sich daher gewissermaßen. Denn nach jenem erwähnten obersten Grundsatz konnte die Philosophie in zwei Teile zerfallen, und in dem einen Teil würde man zeigen: wie aus der Idee die Natur zur Erscheinung kommt; in dem andern Teil würde man zeigen: wie die Natur sich in lauter Ideen auflöst. Die Philosophie konnte daher zerfallen in transzendentalen Idealismus und in Naturphilosophie. Diese beiden Richtungen habe Schelling auch wirklich anerkannt, und die letztere verfolgte er in seinen Ideen zu einer Philosophie der Natur, und erstere in seinem System des transzendentalen Idealismus.
Indessen, beide Grundsätze sind einer so verfehlt wie der andere, und auch Schelling gewinnt keinen Blumentopf. Philosophisch komme Schelling nicht weiter als Spinoza: Aber Herr Schelling verlässt jetzt den philosophischen Weg und sucht durch eine Art mystischer Intuition zur Anschauung des Absoluten selbst zu gelangen, er sucht es anzuschauen in seinem Mittelpunkt, in seiner Wesenheit, wo es weder etwas Ideales ist noch etwas Reales, weder Gedanken noch Ausdehnung, weder Subjekt noch Objekt, weder Geist noch Materie, sondern … was weiß ich! Hier hört die Philosophie auf bei Herrn Schelling, und die Poesie, ich will sagen, die Narrheit, beginnt. Hier aber auch findet er den meisten Anklang bei einer Menge von Faselhänsen, denen es eben recht ist, das ruhige Denken aufzugeben und gleichsam jene Derwisch Tourneurs nachzuahmen, die, wie unser Freund Jules David erzählt, sich so lange im Kreise herumdrehen, bis sowohl objektive wie subjektive Welt ihnen entschwindet, bis beides zusammenfließt in ein weißes Nichts, das weder real noch ideal ist, bis sie etwas sehen, was nicht sichtbar, hören, was nicht hörbar, bis sie Farben hören und Töne sehen, bis sich das Absolute ihnen veranschaulicht.
Schauplatz dieser tanzenden Derwische sei das bayerische München, eine Stadt, welche ihren pfäffischen Charakter schon im Namen trägt und auf Latein Monacho monachorum heißt … –
Grund für den Niedergang Schellings sei das Auftreten eines größeren Denkers, der die Naturphilosophie zu einem vollendeten System ausbildet, aus ihrer Synthese die ganze Welt der Erscheinungen erklärt, die großen Ideen seiner Vorgänger durch größere Ideen ergänzt, sie durch alle Disziplinen durchführt und also wissenschaftlich begründet. Er ist ein Schüler des Herrn Schelling, aber ein Schüler, der allmählich im Reiche der Philosophie aller Macht seines Meisters sich bemeisterte, diesem herrschsüchtig über den Kopf wuchs und ihn endlich in die Dunkelheit verstieß.
Die Rede sei vom großen Hegel: vermeintlich der größte Philosoph, den Deutschland seit Leibniz erzeugt hat. Es ist keine Frage, dass er Kant und Fichte weit überragt. Diesen Mann mit Schelling zu vergleichen, sei gar nicht möglich; denn Hegel war ein Mann von Charakter. Schelling hingegen winde sich wurmhaft in den Vorzimmern eines sowohl praktischen wie theoretischen Absolutismus und handlangere in der Jesuitenhöhle, wo Geistesfesseln geschmiedet würden; dabei wolle er uns weismachen, er sei noch immer unverändert derselbe Lichtmensch, der er einst war, er verleugne seine Verleugnung, und zu der Schmach des Abfalls füge er noch die Feigheit der Lüge!
Schon in Die Stadt Lucca bedauert er das Gedeihen einer Philosophie, die aller Begeisterung nur eine relative Bedeutung zuspricht und sie somit in sich selbst vernichtet oder sie allenfalls zu einer selbstbewussten Donquijoterie neutralisiert: Die kühlen und klugen Philosophen! Wie mitleidig lächeln sie herab auf die Selbstquälereien und Wahnsinnigkeiten eines armen Don Quijote, und in all ihrer Schulweisheit merken sie nicht, dass jene Donquijoterie dennoch das Preisenswerteste des Lebens, ja das Leben selbst ist, und dass diese Donquijoterie die ganze Welt mit allem, was darauf philosophiert, musiziert, ackert und gähnt, zu kühnerem Schwunge beflügelt! Denn die große Volksmasse mitsamt den Philosophen ist, ohne es zu wissen, nichts anderes als ein kolossaler Sancho Pansa, der trotz all seiner nüchternen Prügelscheu und hausbackenen Verständigkeit dem wahnsinnigen Ritter in allen seinen gefährlichen Abenteuern folgt, gelockt von der versprochenen Belohnung, an die er glaubt, weil er sie wünscht, mehr aber noch getrieben von der mystischen Gewalt, die der Enthusiasmus immer ausübt auf den großen Haufen – wie wir es in allen politischen und religiösen Revolutionen und vielleicht täglich im kleinsten Ereignisse sehen können …
Auch in seiner, Heines, Brust aber blühe noch jene flammende Liebe, die sich sehnsüchtig über die Erde emporhebt, abenteuerlich herumschwärmt in den weiten, gähnenden Räumen des Himmels, dort zurückgestoßen wird von den kalten Sternen und wieder heimsinkt zur kleinen Erde, und mit Seufzen und Jauchzen gestehen muss, dass es doch in der ganzen Schöpfung nichts Schöneres und Besseres gibt als das Herz der Menschen. Diese Liebe ist die Begeisterung, die immer göttlicher Art, gleichviel, ob sie törichte oder weise Handlungen verübt – Und so habe er als kleiner Knabe keineswegs unnütz seine Tränen verschwendet, die er über die Leiden des närrischen Ritters vergoss, ebenso wenig wie späterhin der Jüngling, als er manche Nacht im Studierstübchen weinte über den Tod der heiligsten Freiheitshelden, über König Agis von Sparta, über Cajus und Tiberius Gracchus von Rom, über Jesus von Jerusalem, und über Robespierre und Saint Just von Paris. Jetzt, wo er die Toga virilis angezogen und selbst ein Mann sein wolle, hat das Weinen ein Ende und es gilt zu handeln wie ein Mann, nachahmend die großen Vorgänger, und will's Gott! künftig ebenfalls beweint von Knaben und Jünglingen.
Ja, diese sind es, auf die man noch rechnen kann in unserer kalten Zeit; denn diese werden noch entzündet von dem glühenden Hauche, der ihnen aus den alten Büchern entgegenweht, und deshalb begreifen sie auch die Flammenherzen der Gegenwart. Die Jugend ist uneigennützig im Denken und Fühlen, und denkt und fühlt deshalb die Wahrheit am tiefsten, und geizt nicht, wo es gilt eine kühne Teilnahme an Bekenntnis und Tat. Die älteren Leute sind selbstsüchtig und kleinsinnig; sie denken mehr an die Interessen ihrer Kapitalien als an die Interessen der Menschheit; sie lassen ihr Schifflein ruhig fortschwimmen um Rinnstein des Lebens und kümmern sich wenig um den Seemann, der auf hohem Meere gegen die Wellen kämpft; oder sie erkriechen mit klebrigter Beharrlichkeit die Höhe des Bürgermeistertums oder der Präsidentschaft ihres Klubs und zucken die Achsel über die Heroenbilder, die der Sturm hinabwarf von der Säule des Ruhms, und dabei erzählen sie vielleicht: dass sie selbst in ihrer Jugend ebenfalls mit dem Kopf gegen die Wand gerannt seien, dass sie sich aber nachher mit der Wand wieder versöhnt hätten, denn die Wand sei das Absolute, das Gesetzte, das an und für sich Seiende, das, weil es ist, auch vernünftig ist, weshalb auch derjenige unvernünftig ist, welcher einen allerhöchst vernünftigen, unwidersprechbar seienden, festgesetzten Absolutismus nicht ertragen will. Ach! diese Verwerflichen, die uns in eine gelinde Knechtschaft hineinphilosophieren wollen, sind immer noch achtenswerter als jene Verworfenen, die bei der Verteidigung des Despotismus sich nicht einmal auf vernünftige Vernunftgründe einlassen, sondern ihn geschichtskundig als ein Gewohnheitsrecht verfechten, woran sich die Menschen im Laufe der Zeit allmählich gewöhnt hätten, und das also rechtsgültig und gesetzkräftig unumstößlich sei.
Missgunst und Neid hat Engel zum Falle gebracht, und es ist leider nur zu gewiss, dass Unmut wegen Hegels immer steigendem Ansehen den armen Herrn Schelling dahin geführt, wo wir ihn jetzt sehen, nämlich in die Schlingen der katholischen Propaganda, deren Hauptquartier zu München. Herr Schelling verriet die Philosophie an die katholische Religion. Alle Zeugnisse stimmen hierin überein, und es war längst vorauszusehen, dass es dazu kommen musste. Aus dem Munde einiger Machthaber zu München hat er so oft die Worte gehört: man müsse den Glauben verbinden mit dem Wissen. Diese Phrase ist unschuldig wie die Blume, und dahinter lauert die Schlange. Jetzt weiß ich, was ihr gewollt habt. Herr Schelling muss jetzt dazu dienen, mit allen Kräften seines Geistes die katholische Religion zu rechtfertigen, und alles, was er unter dem Namen Philosophie jetzt lehrt, ist nichts anderes als eine Rechtfertigung des Katholizismus. Dabei spekulierte man noch auf den Nebenvorteil, dass der gefeierte Name die weisheitsdürstende deutsche Jugend nach München lockt und die jesuitische Lüge, im Gewande der Philosophie, sie desto leichter betört. Andächtig kniet diese Jugend nieder vor dem Manne, den sie für den Hohepriester der Wahrheit hält, und arglos empfängt sie aus seinen Händen die vergiftete Hostie.
Ein ähnlicher Geist ist Herr Joseph Görres, dessen ich schon mehrmals erwähnt, und der ebenfalls zur Schellingschen Schule gehört. Er ist in Deutschland bekannt unter dem Namen: „der vierte Alliierte“. So nannte ihn nämlich einst, 1814, ein französischer Journalist, als er, beauftragt von der Heiligen Allianz, den Hass gegen Frankreich predigte. Von diesem Kompliment zehrt der Mann noch bis auf den heutigen Tag. Aber in der Tat, niemand vermochte so gewaltig wie er, vermittelst nationaler Erinnerungen, den Hass der Deutschen gegen die Franzosen zu entflammen; und das Journal, das er in dieser Absicht schrieb, der Rheinische Merkur, ist voll von solchen Beschwörungsformeln, die, käme es wieder zum Kriege, noch immer einige Wirkung ausüben möchten. Seitdem kam Herr Görres fast in Vergessenheit. Die Fürsten hatten seiner nicht mehr nötig und ließen ihn laufen. Als er deshalb zu knurren anfing, verfolgten sie ihn sogar. Es ging ihnen wie den Spaniern auf der Insel Cuba, die im Kriege mit den Indianern ihre großen Hunde abgerichtet hatten, die nackten Wilden zu zerfleischen; als aber der Krieg zu Ende war und die Hunde, die an Menschenblut Geschmack gefunden, jetzt zuweilen auch ihre Herren in die Waden bissen, da mussten diese sich gewaltsam ihrer Bluthunde zu entledigen suchen. Als Herr Görres, von den Fürsten verfolgt, nichts mehr zu beißen hatte, warf er sich in die Arme der Jesuiten, diesen dient er bis auf diese Stunde, und er ist eine Hauptstütze der katholischen Propaganda zu München. Dort sah ich ihn, vor einigen Jahren, in der Blüte seiner Erniedrigung. Vor einem Auditorium, das meistens aus katholischen Seminaristen bestand, hielt er Vorlesungen über allgemeine Weltgeschichte und war schon bis zum Sündenfall gekommen. Welch ein schreckliches Ende nehmen doch die Feinde Frankreichs! Der vierte Alliierte ist jetzt dazu verdammt, den katholischen Seminaristen, der École-Polytechnique des Obskurantismus, jahraus jahrein tagtäglich den Sündenfall zu erzählen!
Mit Hegel sei die philosophische Revolution beendet und ihr großer Kreis geschlossen. Wir sähen seitdem nur Entwicklung und Ausbildung der naturphilosophischen Lehre. Diese sei in alle Wissenschaften eingedrungen und habe da das Außerordentlichste und Großartigste hervorgebracht. Hier sei die eigentlich interessante und farbenreiche Partie unserer Philosophiegeschichte.