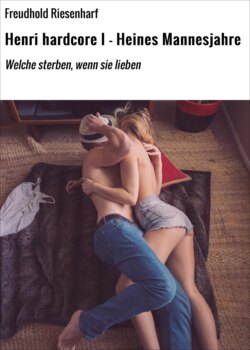Читать книгу Henri hardcore I - Heines Mannesjahre - Freudhold Riesenharf - Страница 6
4: Ronja
ОглавлениеIn Berlin 1822 wird er Mitglied des gemeinnützigen Vereins für Kultur und Wissenschaft der Juden der Stadt und pflegt Umgang im Salon der Rahel Varnhagen.
Rahel Varnhagen von Ense, geborene Levin, ist eine Schriftstellerin und Salonnière jüdischer Abstammung, die zur romantischen Epoche gehört, zugleich aber auch für Positionen der europäischen Aufklärung und die Emanzipation der Frauen und Juden eintritt. 1790 bis 1806 führt sie einen literarischen Salon, in dem Dichter, Naturforscher, Politiker, Aristokraten und andere Gesellschaftsgrößen auf einer Ebene miteinander verkehren. Berühmte Gäste sind Jean Paul, Ludwig Tieck, Friedrich Schlegel, Wilhelm und Alexander von Humboldt, Friedrich de la Motte Fouqué, Prinz Louis Ferdinand und dessen Geliebte Pauline Wiesel.
Letztere, Pauline, wird nicht sowohl durch eigene Leistungen, als vielmehr durch ihre exponierte Rolle im Gefühlsleben berühmter Zeitgenossen berühmt. Ihrer starken Promiskuität und freiheitlichen, unkonventionellen Art wegen gilt sie im geistesgeschichtlichen Umbruch der ,Sattelzeit' als Verkörperung eines unmittelbaren Lebensgenusses und ungebundener Selbstverwirklichung. Zwei Verhältnisse besonders tragen zu ihrer Popularität und ihren Ort in der heutigen Geschichtswissenschaft bei: die Freundschaft mit Rahel und die Liebesaffäre mit Louis Ferdinand.
Wann und wo Pauline den Prinzen Louis kennenlernt, steht nicht fest. Wahrscheinlich ist aber, dass sie einander das erste Mal 1803 im Salon der Rahel, zu deren Habitués auch der Prinz gehört, begegnen und sich bald voneinander angezogen fühlen. Louis Ferdinand, „der Liebling der Genossen, der Abgott schöner Fraun“, war damals sicher der beliebteste Hohenzollernprinz: „Seine persönliche Ausstrahlung war bemerkenswert. Sowohl Männer als auch Frauen verehrten ihn. Beide Geschlechter fanden ihn wunderschön und edel. Er war ein blonder Riese, sechs Fuß groß, ein großartiger Sportler und Jäger, ein engagierter Offizier, ein begabter Musiker, intelligent, neugierig, weltoffen, dabei erstaunlich frei von Standesdünkeln.“
Leider hat Louis „Loulou“, der schon seit jeher ein aufregendes Liebesleben führt, in Form von Henriette Fromm bereits eine Lebensgefährtin, mit der Pauline sich wohl oder übel abfinden muss. Auch Pauline hat wie gewohnt ihre Verehrer, darunter die Diplomaten Karl Gustav Brinckmann und Friedrich Gentz. So ist ihre Beziehung zu dem Prinzen von Anfang an nicht frei von Spannungen: Loulou sucht in Pauline wohl vor allem das schnelle erotische Vergnügen; Pauline „Pölle“ erhofft sich ihrerseits emotionale Nähe und auch die gesellschaftliche Legitimation ihres Verhältnisses, das nicht nur frivol ist, sondern in hohem Maße auch unstandesgemäß. Auch das intellektuelle Gefälle zwischen beiden spielt eine gewisse Rolle. Gegen Ende von 1805 erreicht die Stimmung zwischen ihnen einen Tiefpunkt; Pölle schreibt sogar einen Abschiedsbrief.
Vielleicht kommt Harry aber auch weniger Paulines oder Rahels, als vielmehr deren jüngeren Bruders, des Schriftstellers Ludwig Robert, wegen.
Noch genauer besehen, kommt er vielleicht nicht sowohl um Roberts, als vielmehr um dessen schöner Gattin Friederike Robert willen.
Da geht es ihm aber nicht besser als dem Jean-Jacques Rousseau bei Frau d'Houdetot: Sie kommt, er sieht sie, er ist trunken von Liebe ohne Gegenstand; diese Trunkenheit bezaubert seine Augen, dieser Gegenstand fixiert sich auf sie, er sieht seine Julie in Frau Robert, und bald sieht er nur noch Frau Robert, aber angetan mit allen Vollkommenheiten, mit denen er das Idol seines Herzens geschmückt hat. Um seine Liebe voll zu machen, spricht sie zu ihm als leidenschaftliche Geliebte von Ludwig Robert. O Macht der Liebesansteckung! Wie er ihr gehört, sich ihr nahe fühlt, wird er von einem süßen Schauder ergriffen, den er bei keiner je zuvor gespürt hat.
Wirklich keiner? Übertreiben wir nicht! Aber als er sie hört, sich neben ihr fühlt, überkommt ihn ein köstlicher Schauer, wie er ihn lang neben keiner mehr so empfand. Sie spricht, und er fühlt sich bewegt; er glaubt, nur an ihren Gefühlen Anteil zu nehmen, während bereits die gleichen Gefühle in ihm erwachen; in vollen Zügen schlürft er den Becher voll Gift und fühlt zunächst nur dessen Süßigkeit. Endlich, ohne dass er dessen gewahr wird, ohne dass sie es gewahr wird, flößt sie ihm all die Liebe für sie ein, die sie für ihren Mann empfindet. Er glaubt, sich nur für die Gefühle zu interessieren, die sie für Robert hat, als ähnliche ihn bereits selbst erfüllen. In langen Zügen trinkt er die vergiftete Schale und schmeckt nichts außer ihrer Süße. Er schlittert hinein wie in Goethes Fliegentod:
Sie schlürft mit Gier verrätrisches Getränke,
Unausgesetzt, vom ersten Zug verführt;
Sie fühlt sich wohl, und doch sind die Gelenke
Der zarten Beinchen schon paralysiert.
Ach, es ist zu spät, ach, es ist zu grausam, von einer ebenso starken wie unglücklichen Leidenschaft ergriffen zu werden für eine Frau, deren Herz voll ist von einer anderen Liebe! Er ist sich lange unschlüssig über die Art, wie er sich ihr gegenüber verhalten soll, wie wenn die wahrhafte Liebe Vernunft genug ließe, um noch solchen Überlegungen zu folgen.
Er ist noch zu keinem Entschluss gekommen, als er ihr abermals begegnet. Nun ist er vorbereitet. Die Scham, die Gefährtin des Leids, macht ihn stumm, lässt ihn vor ihr zittern. Er wagt weder den Mund aufzutun noch die Augen zu heben. So ist es gerade die Bemühung, sie nicht anzusehen und nicht ihrem Blick zu begegnen, die seine Gefühle verrät. Er ist in einer unaussprechlichen Verwirrung, die ihr unmöglich entgehen kann. Er entschließt sich, sie ihr zu gestehen und sie die Ursache ahnen zu lassen. Das heißt sie ihr deutlich genug bekennen.
Wäre er jung und liebenswürdig, und würde Friederike schwach werden, so würde er ihr Verhalten tadeln. Da aber all das nicht so ist, kann er ihr nur Beifall zollen und sie bewundern. Er fasst und hält den Entschluss, in Friederike nur seine Freundin und die Geliebte seines Freundes zu sehen, und verweilt vier oder fünf Stunden allein bei ihr in einer köstlichen Ruhe, die selbst, was den Genuss betrifft, jenen glühenden Fieberschauern unendlich vorzuziehen ist, die er so lange bei ihr empfand. Das Kopfweh, an dem er immer schon leidet, verstärkt sich. Von nun an Kopfnervenleiden.
Ich weiß nicht, woher er die Mittel nimmt, aber August 1822 durchstreift er auf eine Einladung des Grafen Breza, eines Berliner Studienfreunds, hin für einige Monate die Kreuz und die Quer den preußischen Teil Polens. Er sollte nach Dresden und Töplitz reisen, um seine Gesundheit wiederherzustellen. Aber seine wilde Natur treibt ihn nach den Wäldern Polens. – Sie wissen ja, lieber Lehmann, ich ging dort auf die Jagd nach reinen, gesunden Menschennaturen, die ich gut herauszufinden verstehe, da mir das Unreine und Kranke so genau bekannt ist. Ich habe immer unter Jüdinnen die gesundesten Naturen gefunden, und ich kann es Gott Vater gar nicht verdenken, dass auch er an einer Jüdin Wohlgefallen fand.
Ich hatte einen Polen zum Freund, für den ich mich bis zu Tod besoffen hätte, oder besser gesagt, für den ich mich hätte totschlagen lassen, und für den ich mich noch totschlagen ließe, und der Kerl taugte für keinen Pfennig, und war venerisch, und hatte die schlechtesten Grundsätze – aber er hatte einen Kehllaut, mit welchem er auf so wunderliche Weise das Wort ,Was?' sprechen konnte, dass ich augenblicks weinen und lachen muss, wenn ich daran denke –
Später, in Paris vor einem Gemälde Delacroix', erinnert er sich, wie er einst, auf einem schönen Schloss im teuren Polen, vor dem Bild des Freundes stand und mit seiner holden Schwester von ihm sprach und ihre Augen heimlich verglich mit den Augen des Freundes. Sie sprachen auch von dem Maler des Bildes, der kurz vorher gestorben, und wie die Menschen dahinsterben, einer nach dem andern – ach! der liebe Freund selbst war jetzt tot, erschossen bei Praga, die holden Lichter der schönen Schwester sind ebenfalls erloschen, ihr Schloss ist abgebrannt, und es werde ihm einsam ängstlich zumute, wenn er bedenkt, dass nicht bloß unsere Lieben so schnell aus der Welt verschwinden, sondern sogar von dem Schauplatz, wo wir mit ihnen gelebt, keine Spur zurückbleibt, als hätte nichts davon existiert, als sei alles nur ein Traum.
Mit der Sprache hat es keine Schwierigkeit, die polnischen Juden reden ein mit Hebräisch versetztes, mit Polnisch fassoniertes Deutsch. Empört ist er von der Unterwürfigkeit des polnischen Bauern gegen den Edelmann. Dieser beugt sich mit dem Kopf fast bis zu den Füßen des gnädigen Herrn und spricht die Formel: „Ich küsse die Füße.“ Wer den Gehorsam personifiziert haben wolle, sehe einen polnischen Bauern vor seinem Edelmann stehen; es fehle nur noch der wedelnde Hundeschweif. Bei einem solchen Anblick denke er unwillkürlich: Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde! – und es ergreift ihn ein unendlicher Schmerz, wenn er einen Menschen vor einem andern so tief erniedrigt sieht. Nur vor dem König soll man sich beugen; bis auf dieses letztere Glaubensgesetz bekennt er sich ganz zum nordamerikanischen Katechismus. Er leugne es nicht, dass er die Bäume der Flur mehr liebe als Stammbäume, dass er das Menschenrecht mehr achte als das kanonische Recht, und dass er die Gebote der Vernunft höher schätze als die Abstraktionen kurzsichtiger Historiker; wenn wir ihn aber fragten: ob der polnische Bauer wirklich unglücklich ist und ob seine Lage besser wird, wenn jetzt aus den gedrückten Hörigen lauter freie Eigentümer gemacht würden? so müsste er lügen, sollte er diese Frage unbedingt bejahen.
Wenn man den Begriff von Glücklichsein in seiner Relativität auffasse und sich wohl merke, dass es kein Unglück sei, wenn man von Jugend auf gewöhnt ist, den ganzen Tag zu arbeiten und Lebensbequemlichkeiten zu entbehren, die man gar nicht kennt, so müsse man gestehen, dass der polnische Bauer im eigentlichen Sinn nicht unglücklich sei; um so mehr, da er gar nichts hat und folglich in der großen Sorglosigkeit, die ja von vielen als das höchste Glück geschildert wird, sein Leben dahinlebt. Es sei also keine Ironie, wenn er sage, dass im Fall man jetzt die polnischen Bauern plötzlich zu selbstständigen Eigentümern machte, sie sich gewiss bald in der unbehaglichsten Lage von der Welt befinden und manche gewiss dadurch in größeres Elend geraten würden. Bei seiner zur zweiten Natur gewordenen Sorglosigkeit würde der Bauer sein Eigentum schlecht verwalten, und träfe ihn ein Unglück, wär er ganz und gar verloren.
Jetzt aber knien Sie nieder, oder wenigstens ziehen Sie den Hut ab – ich spreche von Polens Weibern. Mein Geist schweift an den Ufern des Ganges und sucht die zartesten und lieblichsten Blumen, um sie damit zu vergleichen. Aber was sind gegen diese Holden alle Reize der Mallika, der Kuwalaya, der Oschadhi, der Nagakesarblüten, der heiligen Lotosblumen, und wie sie alle heißen mögen – Kamalata, Pedma, Kamala, Tamala, Sirischa usw.! Hätte er den Pinsel Rafaels, die Melodien Mozarts und die Sprache Calderóns, so gelänge es ihm vielleicht, uns ein Gefühl in die Brust zu zaubern, das wir empfänden, wenn eine wahre Polin, eine Weichsel-Aphrodite, vor unseren hochbegnadigten Augen leibhaftig erschiene. Aber was seien Raffaelsche Farbenkleckse gegen diese Altarbilder der Schönheit, die der lebendige Gott in seinen heitersten Stunden fröhlich hingezeichnet! Was seien Mozartsche Klimpereien gegen die Worte, die gefüllten Bonbons für die Seele, die aus den Rosenlippen dieser Süßen hervorquellen! Was seien alle Calderonischen Sterne der Erde und Blumen des Himmels gegen diese Holden, die er ebenfalls, auf gut Calderonisch, Engel der Erde benamse, weil er die Engel selbst Polinnen des Himmels nenne! Ja, wer in ihre Gazellenaugen blicke, glaube an den Himmel, und wenn er der eifrigste Anhänger des Barons Holbach wäre …
Sollte er über den Charakter der Polinnen sprechen, so bemerke er bloß: sie sind Weiber. Wer wollte sich anheischig machen, den Charakter dieser letzteren zu zeichnen! Da meine Frau Polin ist, darf ich das nicht überschlagen.
Ein sehr werter Weltweiser, der zehn Oktavbände Weibliche Charaktere geschrieben, habe endlich seine eigene Frau in militärischen Umarmungen gefunden. Er will hier nicht sagen, die Weiber hätten gar keinen Charakter. Beileibe nicht! Sie hätten vielmehr jeden Tag einen andern. Diesen immerwährenden Wechsel des Charakters will er ebenfalls durchaus nicht tadeln. Es sei sogar ein Vorzug. Ein Charakter entstehe durch ein System stereotyper Grundsätze. Sind letztere irrig, so werde das ganze Leben desjenigen Menschen, der sie systematisch in seinem Geist aufgestellt, nur ein großer, langer Irrtum sein. Wir loben das und nennen es „Charakter haben“, wenn ein Mensch nach festen Grundsätzen handelt, und bedenken nicht, dass in einem solchen Menschen die Willensfreiheit untergegangen, dass sein Geist nicht fortschreite und dass er selbst ein blinder Knecht seiner verjährten Gedanken sei. Wir nennen das auch Konsequenz, wenn jemand dabei bleibe, was er ein für allemal in sich aufgestellt und ausgesprochen hat, und wir seien oft tolerant genug, Narren zu bewundern und Bösewichter zu entschuldigen, wenn sich nur von ihnen sagen lässt: dass sie konsequent gehandelt.
Diese moralische Selbstunterjochung finde sich aber fast nur bei Männern; im Geist der Frauen bleibe immer lebendig und in lebendiger Bewegung das Element der Freiheit. Jeden Tag wechseln sie ihre Weltansichten, meistens ohne sich dessen bewusst zu sein. Sie stehen des Morgens auf wie unbefangene Kinder, bauen des Mittags ein Gedankensystem, das, wie ein Kartenhaus, des Abends wieder zusammenfällt. Haben sie heute schlechte Grundsätze, so wette er darauf, haben sie morgen die allerbesten. Sie wechseln ihre Meinungen so oft wie ihre Kleider. Wenn in ihrem Geist just kein herrschender Gedanke steht, so zeigt sich das Allererfreulichste, das Interregnum des Gemüts. Und dieses ist bei den Frauen am reinsten und am stärksten und führt sie sicherer als die Verstandes-Abstraktionslaternen, die uns Männer so oft irreleiten.
Wir sollten aber nicht glauben, er wolle hier den Advocatus diaboli spielen und die Weiber noch obendrein preisen wegen jenes Charaktermangels, den unsere Gelbschnäbel und Grauschnäbel – die einen durch Amor, die anderen durch Hymen malträtiert – mit so vielen Stoßseufzern beklagen. Auch müssten wir bemerken, dass bei diesem allgemeinen Ausspruch über die Weiber hauptsächlich die Polinnen gemeint seien und die deutschen Frauen so halb und halb ausgenommen würden. Das ganze deutsche Volk habe, durch seinen angeborenen Tiefsinn, ganz besondere Anlage zu einem festen Charakter, und auch den Frauen habe sich ein Anflug davon mitgeteilt, der durch die Zeit sich immer mehr und mehr verdichtet, so dass man bei ältlichen deutschen Damen, sogar bei Frauen aus dem Mittelalter, d. h. bei Vierzigerinnen, eine ziemlich dicke, schuppige Charakterhornhaut vorfindet.
Unendlich verschieden seien die Polinnen von den deutschen Frauen. Das slawische Wesen überhaupt, und die polnische Sitte insbesondere, mag dieses hervorgebracht haben. In Hinsicht der Liebenswürdigkeit wolle er die Polin nicht über die Deutsche erheben: sie seien nicht zu vergleichen. Wer will eine Venus von Tizian über eine Maria von Correggio setzen? In einem sonnenhellen Blumentale würde ich mir eine Polin zur Begleiterin wählen; in einem mondbeleuchteten Lindengarten wählte ich eine Deutsche. Zu einer Reise durch Spanien, Frankreich und Italien wünschte ich eine Polin zur Begleiterin; zu einer Reise durch das Leben wünschte ich eine Deutsche. Leben Sie also mit einer Polin, die Sie geheiratet haben, in Deutschland, haben Sie beides.
Muster von Häuslichkeit, Kindererziehung, frommer Demut und allen jenen stillen Tugenden der deutschen Frauen werde man wenige unter den Polinnen finden. Jene Haustugenden fänden sich aber auch bei uns meistens nur im Bürgerstand und einem Teil des Adels, der sich in Sitten und Ansprüchen dem Bürgerstand angeschlossen. Bei dem übrigen Teil des deutschen Adels würden oft jene Haustugenden in höherem Grad und auf eine weit empfindlichere Weise vermisst als bei den Frauen des polnischen Adels. Ja, bei diesen sei es doch nie der Fall, dass auf diesen Mangel sogar ein Wert gelegt werde, dass man sich etwas darauf einbilde; wie von so manchen deutschen adligen Damen geschehe, die nicht Geld- oder Geisteskraft genug besitzen, um sich über den Bürgerstand zu erheben, und die sich wenigstens durch Verachtung bürgerlicher Tugenden und Beibehaltung nichts kostender altadliger Gebrechen auszuzeichnen suchten. Auch seien die Frauen der Polen nicht ahnenstolz, und es falle keinem polnischen Fräulein ein, sich etwas darauf einzubilden, dass vor einigen hundert Jahren ihr wegelagernder Ahnherr, der Raubritter, der verdienten Strafe entgangen sei. –
Das religiöse Gefühl sei bei den deutschen Frauen tiefer als bei den Polinnen. Diese leben mehr nach außen als nach innen; sie sind heitere Kinder, die sich vor Heiligenbildern bekreuzigen, durch das Leben wie durch einen schönen Redoutensaal gaukeln, und lachen und tanzen und liebenswürdig sind. Er möchte wahrlich nicht Leichtfertigkeit, und nicht einmal Leichtsinn nennen jenen leichten Sinn der Polinnen, der so sehr begünstigt werde durch die leichten polnischen Sitten überhaupt, durch den leichten französischen Ton, der sich mit diesen vermische, durch die leichte französische Sprache, die in Polen mit Vorliebe und fast wie eine Muttersprache gesprochen werde, und durch die leichte französische Literatur, deren Dessert, die Romane, von den Polinnen verschlungen würden; und was die Sittenreinheit betreffe, so sei er überzeugt, dass die Polinnen hierin den deutschen Frauen nicht nachzustehen brauchen. Die Ausschweifungen einiger polnischer Magnatenweiber hätten, wegen ihrer Großartigkeit, zu verschiedenen Zeiten viele Augen auf sich gezogen, und unser Pöbel beurteile eine ganze Nation nach den paar schmutzigen Exemplaren, die ihm davon zu Gesicht gekommen. Außerdem müsse man bedenken, dass die Polinnen schön sind, und dass schöne Frauen, aus bekannten Gründen, dem bösen Leumund am meisten ausgesetzt seien und demselben nie entgehen, wenn sie, wie die Polinnen, freudig dahinleben in leichter, anmutiger Unbefangenheit. Wir sollten ihm glauben, man sei in Warschau um nichts weniger tugendhaft wie in Berlin, nur dass die Wogen der Weichsel etwas wilder brausen als die stillen Wasser der seichten Spree.
In Posen leitet ihn Ideenassoziation direkt auf das Theater. Ein schönes Gebäude haben die dortigen Einwohner den Musen zur Wohnung angewiesen; aber die göttlichen Damen sind nicht eingezogen und schicken nach Posen bloß ihre Kammerjungfern, die sich mit der Garderobe ihrer Herrschaft putzen und auf den geduldigen Brettern ihr Wesen treiben. Nein, er will nicht das ganze Posensche Theater verdammen; er bekenne sogar, dass es ein ganz ausgezeichnetes Talent, zwei gute Subjekte und einige nicht ganz schlechte besitze. Das ausgezeichnete Talent, wovon er spricht, sei Demoiselle Paien. Ihre gewöhnliche Rolle sei die der ersten Liebhaberin. Da sei nicht das weinerliche Lamento und das zierliche Geträtsche jener Gefühlvollen, die sich für die Bühne berufen glauben, weil sie vielleicht im Leben die sentimentale oder kokette Rolle mit einigem Sukzess gespielt, und die man von den Brettern fortpfeifen möchte, eben weil man sie im einsamen Closet herzlich applaudieren würde. Demoiselle Paien spiele mit gleichem Glück auch die heterogensten Rollen, eine Elisabeth so gut wie eine Maria. Am besten gefällt sie ihm jedoch im Lustspiel, in Konversationsstücken, und da besonders in jovialen, neckenden Rollen. Sie ergötzt ihn königlich als Pauline in Sorgen ohne Not und Not ohne Sorgen. Bei Demoiselle Paien findet sich ein freies Spielen von innen heraus, eine wohltuende Sicherheit, eine fortreißende Kühnheit, ja fast Verwegenheit des Spiels, wie wir es nur bei einem echten, großen Talent gewahren.
Er sieht sie ebenfalls mit Entzücken in einigen Männerrollen, z. B. in der Liebeserklärung und in Wolffs Cäsario; nur hat er hier eine etwas eckige Bewegung der Arme zu rügen, welchen Fehler er aber auf Rechnung der Männer setze, die ihr zum Muster dienten. Demoiselle Paien sei zu gleicher Zeit Sängerin und Tänzerin, habe ein günstiges Äußeres, und es wäre schade, wenn dieses kunstbegabte Mädchen in den Sümpfen herumziehender Truppen untergehen müsste …
Eine unvergleichliche Anmut zeigen die polnischen Sängerinnen, und das sonst so rohe Polnische habe ihm wie Italienisch geklungen, als er es singen hörte.
Hier, in Gesellschaft Brezas, hat er eines der nachhaltigsten Erlebnisse seiner Jugend. Zusammen mit ihm macht er neugierhalber, um Kollege Goethens Kurerfahrungen nachzuempfinden, einen Abstecher ins böhmische Karlsbad, Karlovy Vary. Sie logieren für die Nacht in einem vornehmen Hotel am Markt, streifen dann durch die Kolonnaden und besichtigen eine Mineraliensammlung. Das Goethe-Denkmal mit dem hohen, mit antikisierenden Reliefs verzierten und dem Namen „Goethe“ versehenen Sockel in der Parkanlage vor dem Hotel Pupp steht derzeit noch nicht. Für Mineralogen bieten Karlsbad und seine Umgebung eine bereits von Goethe geschätzte Besonderheit. An den Thermalquellen gibt es als Sinterbildung Aragonit, eine Form von „kohlensaurem Kalk“, den man hier als Sprudelstein und Erbsenstein bezeichnet. Ist der Sprudelstein ein wellenförmig gebänderter Kalksinter, so der Erbsenstein eine Ansammlung von Kalkkügelchen. Diese entstehen an heißen Quellen durch konzentrische Abscheidung von Aragonit an kleinen Gesteins- oder Mineralpartikeln, die durch die Wasserbewegung in der Schwebe gehalten werden. Dadurch gewinnen sie an Gewicht. Werden die Kugeln zu schwer, sinken sie zu Boden und werden dort durch weitere Kalkabscheidungen zu einem Aggregat verkittet. –
Im einbrechenden Abend dann spüren sie die Leere und Verlassenheit der anonymen Stadt. Es ist ein wenig so, wie wenn ihnen das Herzblut abgezapft würde. Ein Droschkenkutscher, dem Breza, der leider schon etwas venerisch ist, augenzwinkernd ihr Verlangen nach einem Ort mit „diversen Vergnügungen“ zu erkennen gibt, versteht sofort und kutschiert sie zu einem anonymen Lokal in der Innenstadt. Die geballte Menschlichkeit des gedrängt vollen Orts lässt ihre entherzte Einsamkeit schnell verfliegen und versetzt sie in eine komplementär euphorische Stimmung. Sie gesellen sich zu einem Tisch, an dem bereits einige zusammensitzen, fremde Männer, zwei fremde Frauen, aber da eine von ihnen ziemlich hübsch, nahezu schön zu nennen ist, fühlt Harry sich auf sympathische Art angeheimelt. Dass sie aus Deutschland kommen, sichert ihnen eine gewisse sensationelle Aufmerksamkeit. Weder Breza noch er verstehen ein Wort Tschechisch, doch spricht einer der Männer, der sich als berufsmäßiger Journalist vorstellt, etwas Deutsch, was wenigstens eine lustig-rudimentäre Kommunikation ermöglicht. Haben sie doch, auch wenn Harry von tschechischer Literatur so gut wie nichts weiß, gewissermaßen dasselbe Metier. Auch wird ihre Einbürgerung dadurch, dass Breza für die nächste Flasche Wein aufkommt, gleich spürbar erleichtert.
Fremder Ort, fremde Sprache, fremde Frauen, die Schönheit aber ist universell, und so ist Harry, unter Einfluss des Alkohols und slawischer Schönheit, bald in seinem Element. Hinzu kommt die knisternde Spannung, da bei der anonymen Situation durchaus unklar ist, ob der Ort wirklich zu jenen gehört, wie er ihnen vorgeschwebt hat, und inwieweit die anwesende Damenwelt, zumal deren schönere Hälfte, auch wirklich zu der für die dem Kutscher abverlangten „diversen Vergnügungen“ zuständigen Halbwelt gehört. Vorsichtig sondiert er das Terrain, ob eine der Damen zu dem Zeitungsfritzen in einer festen Beziehung steht, kann ihrem unverbindlichen Verhalten nach aber nichts feststellen, worauf er beim Augenflirt Rücksicht nehmen müsste.
Indessen zeigt es sich auf die Länge, dass die Schöne auf die schönen Augen, die er ihr ebenso heimlich wie ermunternd widmet, doch nicht auf solche Weise reagiert, wie es dem Grund seiner – ziemlich hintergründigen – Liebäugelei entspricht, und stets eine gewisse Reserve bewahrt, – sei es, dass sie bereits anderweitig vergeben ist und/oder dem hier vermuteten Milieu von Hause aus nicht zugehört. Sei dem, wie ihm sei, jedenfalls hat es nicht den Anschein, als ob diese Göttin die mit steigendem Alkoholgenuss immer innigeren Beweihräucherungen ihres Anbeters auch mit göttlichen Gunstbezeigungen entlohnen wollte.
Stattdessen ist es, in einer seltsam verkehrt reagierenden Alchemie der Leidenschaft, das andere Mädchen am Tisch, das gegenüber seinem ungebremsten Charme, vielleicht gerade deshalb, weil er zuerst nicht ihr selber gilt, nicht unempfindlich bleibt und sich ihm mehr und mehr zugeneigt zeigt. Zwar ist sie eindeutig nicht so hübsch wie die andere, eher ein kleines, pummeliges Wesen, er könnte keinen Staat mit ihr machen. doch hat er inzwischen genügend von jenen Trank im Leibe, durch den wir Helenen sehen in jedem Weibe, so dass es ihm nicht schwerfällt, spontan zu taktieren und seine Werbung in leidenschaftlich alchemischer Wendung auf sie umzulenken. Sie hat den romantischen Namen Ronja. Vielleicht auch, dass seine Favoritin, anderweitig kompromittiert, inzwischen schon gegangen ist, so dass sein angeheiztes Temperament hätte sinnlos verpuffen müssen. Geschürt noch wird seine Glut durch den besagten Journalisten, der, eine Art böhmischer Mephistopheles, ihm auch noch kupplerische Übersetzerdienste leistet. Er ist ihm nicht wenig verpflichtet dafür. Kurzum, es kommt in einer Art romantischen Rausches so weit, dass sie am Ende völlig hingerissen von ihm ist, und offenbar geneigt, ihm alle Art jener diversen Vergnügungen zu gewähren, so er ihr allenfalls abverlangen wollte. Er fragt sich, ob sie wirklich eine Professionelle ist, sie aber gibt sich mit weiblicher Instinktsicherheit durchaus den Anschein, als ob sie es nicht und stattdessen eine spontane zivile Verliebte wäre. Kommt es noch im Lokal zum Austausch körperlicher Zärtlichkeiten? Wir wissen es nicht. Genug, sie hängt sich so anhänglich an ihn, dass sie ihm fortan durch dick und dünn und gegebenenfalls auch willig in seine deutsche Heimat folgen würde.
Zumindest folgt sie den beiden zunächst, nachdem er mit dem journalistischen Mephisto Adressen getauscht und Breza die Rechnung beglichen hat, den langen Weg durch die Karlsbader Nacht zurück zu ihrem Hotel. Die Straßen sind leer geworden, die Häuser schlafen mit geschlossenen Fensteraugen, nur hie und da, durch die hölzernen Wimpern, blinzelt ein Lichtchen. Oben am Himmel aber tritt ein breiter hellgrüner Raum aus den Wolken hervor, und darin schwimmt der Halbmond wie eine silberne Gondel in einem Meer von Smaragden. Der ganze Weg ist eine einzige Orgie von Koketterie und Verführung. Am Ende will sie auch gleich mit aufs Hotelzimmer kommen, wo sie die Orgie, im Zweifelsfall im Beisein des venerischen Breza, oder gar zusammen mit ihm, noch ganz anders fortsetzen könnten. Harry weiß beileibe nicht und ist sich nicht sicher, ob er die Sache so auf die Spitze treiben soll. Wäre er bei all dem Alkohol zu dergleichen überhaupt noch imstande?
Nun aber, auch im böhmischen Karlovy Vary ist die moralische Welt nicht so eingerichtet, dass sie dergleichen hemmungslose Exzesse mir nichts dir nichts so einfach hinnähme und über die Bühne gehen ließe. Angekommen beim Hotel, wird ihm die Entscheidung von selbst abgenommen, denn der Nachtwächter winkt, als er die Nachtschwärmer ins Foyer kommen sieht, freundlich, aber entschieden ab. Offenbar ist der Besuch von Damen, oder gewisser Damen, in dem vornehmen Hotel nicht gestattet. Die Bedenken des Portiers, oder diejenigen seiner Auftraggeber, scheinen von ganz derselben oder vergleichbarer Art wie weiland diejenigen des Jerezaner Franzosen Henri, als Harry mit seinen Bekannten Pepi und Loli in seine schwüle Dachkammer klettern wollte. Kurz und gut, die Welt sei nicht so eingerichtet und verstatte es nicht, dass einer ungehindert seinen Leidenschaften nachging auf Kosten des bürgerlichen Glücks anderer, der ihr Schäfchen selbst eben mit knapper Not ins Trockene gebracht haben und jetzt auf irreversible Weise geschädigt und ruiniert werden könnten, – Bedenken, die, wie er sich bewusst wird, diesmal wohl tatsächlich ungleich berechtigter sind als damals.
Harry weiß nicht, ob er lachen oder weinen soll, dass er auf solch unsanfte Weise von seiner Eroberung getrennt wird. Vielleicht aber doch, wenn man die Folgen seiner Leidenschaft bedenkt, eher lachen; ansonsten er ja bei Ronja draußen in einer anderen Absteige bleiben und Breza, der bestimmt vollstes Verständnis dafür hätte, allein im Hotel lassen könnte. Tatsache ist, dass er sie unter letzten mit mehr oder minder gespieltem Bedauern gewechselten Blicken und letzten Umarmungen, wie damals mit Sylvette, einsam und allein auf der Straße des nächtlichen Karlsbad stehen lässt und sie auch, da sie anderntags zurück nach Polen reisen, auch nicht mehr wiedersieht.
Eine jener kurzen, nur scheinbar harmlosen Tragödien, wie seine Natur sie immer wieder mit sich bringt. Hätten wir der Episode doch mit keinem Wort Erwähnung getan, wenn sie für seinen Donjuanismus nicht so typisch wäre. In Wahrheit ist sie der idealtypische äußere Ausdruck seiner tiefinnerlich eingefleischten Befindlichkeit. Die sinnliche Begierde eines leeren einsamen Abends in einer fremden Stadt in einem fremden Land, deren Sprache er nicht versteht, ein unbekannter Ort in unbekannter Zeit – wie später in Bergmans Schweigen –, dann plötzlich liebreizende fremde Frauen, eine donjuanistische Eroberung, bei der sich ihm eine Frau an die Brust schmeißt, ihre bedingungslose Hingabe, leidenschaftlicher Sex und tragischer Abschied, – es kommt ihm vor, als wäre das sein eigentliches Leben, als müsste sein eigentliches Leben aus lauter solchen Abenteuern bestehen. Unendlich selig ist das Gefühl, wenn die Erscheinungswelt mit unserer Gemütswelt zusammenrinnt.
Warum kann das nicht jeden Tag so sein? Stattdessen ist es eine extrem seltene Ausnahme, dass ihm tatsächlich dergleichen gelingt. Wie aber auch? fragt er sich. Was wäre denn am andern Tag, nachdem er hemmungslos seiner promiskuitiven Lust gefrönt? Was hätte dann aus ihm und einer Frau wie ihr werden sollen? Er hätte sie ja nicht einfach wieder wegwerfen und auf Nimmerwiedersehen abstreifen können. Er hätte dann Verantwortung für sie getragen. Das Leben ist ja nicht so, dass man die Frau dann einfach wieder sitzen und zurück lassen kann. Das beweist: es befindet sich in einem radikalen Konflikt zwischen sinnliche Veranlagung und dem wahren Leben, zwischen Physiologie und Soziologie. Er muss seine Sinnlichkeit an die Kandare nehmen und es mit dem wahren Leben irgendwie unter einen Hut kriegen. Das ist sein eigentliches Lebensproblem. –
Eine ganz andere Frage ist es natürlich, ob er mit den Frauen tatsächlich jene Wollust erfahren würde, wie er es sich in seiner ipsistischen Phantasie andauernd vorstellt? ... –
Mit Goethe, erfährt er später, ist es kein Haarbreit anders. Sieh dir nur mal die Marienbader Elegie an! Sommers 1821 reist der fast 72-jährige Dichterfürst, dem fünf Jahre zuvor seine geliebte Christiane weggestorben – „Du versuchst, o Sonne, vergebens, / Durch die düstren Wolken zu scheinen! / Der ganze Gewinn meines Lebens / Ist, ihren Verlust zu beweinen“ –, zu einem Kuraufenthalt ins böhmische Marienbad. Dort trifft er auf die gerade mal siebzehnjährige Ulrike von Levetzow, die hier mit ihrer Mutter und den beiden jüngeren Schwestern den Sommer verbringt. Das Goethe-Denkmal auf dem Platz vor dem Museum, dem so genannten ,Goetheplatz', steht derzeit noch nicht. In dem 72-Jährigen entbrennt eine große Leidenschaft zu der um 54 Jahre Jüngeren.
Von Liebe geblendet, versteigt er sich nach wiederholter Begegnung zwei Sommer später 1823 zu dem schier Unausdenklichen: Mit Hilfe seines Freundes Großherzog Carl August von Sachsen-Weimar hält er schriftlich bei ihrer Mutter, Amalie von Levetzow, um Ulrikens Hand an. Carl August unterstützt den Antrag, indem er der Familie ein sorgenfreies Leben an seinem Hof verspricht. „Kein Missbilligen, kein Schelten macht die Liebe tadelhaft“, rechtfertigt Johann Wolfgang seinen Antrag. 1823 feiert er mit Ulrike im Schwarzenberg-Lusthaus seinen 74sten. Ein Bild davon hängt auf der Burg Loket. Umso erschütternder ist für den alten Roué Ulrikens höflicher Dispens: Das Fräulein habe noch gar keine Lust auf Heirat, heißt es diplomatisch. Diesmal versagt Mephisto. Kein Wunder, sie ist ja auch kein stadtbekanntes Flittchen wie Ronja!
Die peinliche Schlappe des Verliebten gibt seiner Schaffenskraft einen Kick. Schon in der Kutsche nach der Abfahrt aus Marienbad setzt er seinem entsagungsvollen Erlebnis ein lyrisches Denkmal: das Klagelied Marienbader Elegie, laut Autor „Produkt eines höchst leidenschaftlichen Zustands“. Dieser Zustand ist zugleich sein leidenschaftlich letzter und besiegelt seinen Abschied von der Liebe überhaupt. Harry, als er es 1824 erfährt, kommen, wie wenn er seine eigene Mouche erahnte, unaufhaltsame Tränen. Das kann doch überhaupt nur einem Erotiker wie ihnen passieren! Warum ergreift es ihn so? Warum muss er immer um der Liebe anderer willen leiden? Verfehlte Liebe, verfehltes Leben! auch wenn mit 74 das Leben und Lieben eigentlich schon passé ist. Aber das ist es ja gerade!
Oder hätte sich der Alte bei Ulriken vielleicht doch noch etwas mehr ins Zeug legen sollen? Sonderbar! Sie verehren einen als den größten Dichter der Menschheitsgeschichte und begnadeten Liebling der Götter, aber wenn man ihre eigene Liebe will, sind sie plötzlich ganz unliterarisch! Das Schwinden seiner Liebesfähigkeit sei der Schlussstrophe nach gleich dem Tod:
Mir ist das All, ich bin mir selbst verloren,
Der ich noch erst den Göttern Liebling war;
Sie prüften mich, verliehen mir Pandoren,
So reich an Gütern, reicher an Gefahr;
Sie drängten mich zum gabeseligen Munde,
Sie trennen mich, und richten mich zugrunde.
Später in ihren kurzen Erinnerungen an Goethe meint Ulrike, sie habe „gar keine Lust zu heiraten“ gehabt, und tatsächlich bleibt sie bis an ihr Lebensende ledig. Kaltes Blut? Verlorene Liebesmüh? Leidenschaft für die Katz? Wenn sie schon überhaupt nicht heiratet, hätte sie doch geradeso gut auch den Alten nehmen können! Warum soll ein 74-Jähriger eigentlich keine Neunzehnjährige bumsen? Charles Chaplin freit mit 54 die 18-jährige Oona O'Neill und hat mit ihr acht Kinder. Picasso heiratet 8o-jährig die 46 Jahre jüngere 34-jährige Jacqueline Roque, auch wenn die Ehe eventuell kinderlos bleibt. Dass Ulriken ein Verhältnis zu Goethe nachgesagt wird, ärgert sie, das weist sie entschieden zurück. Demnach habe sie ihn bloß „wie einen Vater“ geliebt. Noch im Alter entwirft sie eine autobiografische Gegendarstellung, um „all die falschen, oft fabelhaften Geschichten, welche darüber gedruckt wurden“ zu widerlegen und klarzustellen: „Keine Liebschaft war es nicht“. Bedenke, dass du Staub bist, Weib! Heines Angélique IX;
Dieser Liebe toller Fasching,
Dieser Taumel unsrer Herzen,
Geht zu Ende, und ernüchtert
Gähnen wir einander an!
Ausgetrunken ist der Kelch,
Der mit Sinnenrausch gefüllt war,
Schäumend, lodernd, bis am Rande;
Ausgetrunken ist der Kelch.
Es verstummen auch die Geigen,
Die zum Tanze mächtig spielten,
Zu dem Tanz der Leidenschaft;
Auch die Geigen, sie verstummen.
Es erlöschen auch die Lampen,
Die das wilde Licht ergossen
Auf den bunten Mummenschanz;
Auch die Lampen, sie erlöschen.
Morgen kommt der Aschermittwoch,
Und ich zeichne deine Stirne
Mit dem Aschenkreuz und spreche:
Weib, bedenke, dass du Staub bist.
– … du und die Frucht deines Leibes! Was will er damit sagen? Warum den biblischen Satz „Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und wieder zum Staub zurückkehren wirst“ aus Genesis 3,19, der ja auf das Menschengeschlecht allgemein geprägt ist, auf spezifische und fast chauvinistische Weise auf die Frau spezialisieren wollen? Warum dem schwachen Geschlecht so uncharmant auch noch seine Sterblichkeit hinreiben?
Das klingt nach heimlicher Ranküne und Revanchismus. Ein solcher Einfall kann nur von einem Erotiker stammen – also von einem Mann, dem durch das ,Weib' oft genug eine persönliche Niederlage bereitet wurde, öfter, als er ertragen kann. Für dieses Liebes-Leid will er sich ideell rächen und schadlos halten. Metaphysischer Trost-Revanchismus! Ist er der Unterlegene, dann ist das Weib der souveräne Sieger, und der Sieger ist dem Verlierer stets überlegen. Doch sollte auch der Überlegene, will er bedeuten, sich seines Sieges nicht allzu sehr freuen oder stolz darauf sein. Es ist immer nur ein Pyrrhussieg, ein Sieg auf Zeit, denn auch der Sieger ist sterblich und wird zu Staub werden. Auch er wird der Zeit unterliegen. Drum besser wär's, er wäre erst gar kein Sieger gewesen, sondern hätte sich von Anfang an mit dem Unterlegenen solidarisch gezeigt – ihn geliebt – und sich ihm so willig ergeben wie später dem Tod. Sieger bleibt doch nur immer – durch seine ,Unsterblichkeit' – am Ende der Dichter.
Aber auch Ulrike ist – durch Goethe – unsterblich. Sie stirbt im Alter von fünfundneunzig Jahren als Stiftsdame des Klosters zum Heiligengrabe auf dem Gut Trziblitz, das sie von ihrem Stiefvater erbte. Frau Marie Schäfer, die dem Edelfräulein 16 Jahre als Kammerzofe diente, berichtet über den 12. November 1899: Als Ulrike von Levetzow sich am Vorabend zu Bette begab, netzte ein kalter Schweiß ihr Antlitz, und im Vorgefühl ihres nahen Endes gebot sie, ein Päckchen Briefe, deren Inhalt niemandem bekannt geworden, auf einer silbernen Platte zu verbrennen. Die Asche wurde in einer silbernen Kapsel verschlossen, mit dem Wunsch, dass nach ihrem Ableben dieses für sie unschätzbare Andenken in den Sarg gelegt werde. Dies ist auch geschehen. Um vier Uhr morgens erwachte sie mit Husten, und um sechs Uhr entschlief sie sanft. Laut schriftlicher Mitteilung ihrer Großnichte sollen es Briefe Goethes gewesen sein. Ein Ulrike-von-Levetzow-Wanderweg führt heute von der Kleinstadt Groitzsch zu ihrem vermeintlichen Geburtsort Löbnitz, einem Ortsteil von Groitzsch. – Henri kann nur noch heulen. Das alles ist ungefähr genauso schlimm wie die Liebe des 50-jährigen Hemingway zu der neunzehnjährigen Adriana Ivancich. Davon später. Dabei ist Hemingway sogar noch verheiratet, mit Mary Welsh. Das spricht eindeutig für Goethe.