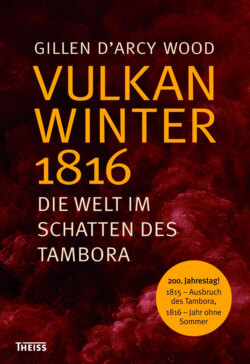Читать книгу Vulkanwinter 1816 - Gillen Wood - Страница 10
Der Philosophen-König von Java
ОглавлениеArabische Händler auf der Suche nach Gewürzen kamen als Erste in die ostindischen Meere rund um den Tambora. Ihr Einfluss besteht in der Dominanz des Islam in der Region fort. Im sechzehnten Jahrhundert folgten die Portugiesen. Als dann deren Seemacht dahinschwand, setzten sich die Holländer als Kolonialherren durch. Die Niederländische Ostindienkompanie führte die Produktion von Feldfrüchten für den Handel – Pfeffer, Kaffee, Zucker – im ganzen Archipel um Java ein, wobei sie die Leitung der Ländereien an chinesische Mittelsmänner delegierten, die ihre Landarbeiter übelst behandelten, um die Produktionsziele erfüllen zu können. Die Holländer brachten nichts mit, das sich in Ostindien fertigen oder verkaufen ließ; stattdessen beuteten sie die Region als breiten Agrargürtel aus, dessen Ernten auf dem europäischen Markt zu sagenhaft überhöhten Preisen verkauft wurden. Die gutgenährten holländischen Bürger, die uns von den Porträts, die Rembrandt und Frans Hals im siebzehnten Jahrhundert malten, zufrieden entgegenblicken, waren die Profiteure dieser Kaskade des Wohlstands, die ihren Ursprung in Ostindien hatte.
Es ist folglich ein historischer Glücksfall, dass die Briten zum Zeitpunkt der unerwarteten Explosion des Tambora im Jahr 1815 die Kontrolle über Sumbawa hatten. Britanniens Herrschaft über Java und die umliegenden Inseln bezeichnet ein kurzes Interregnum in der jahrhundertelangen Einflussnahme seitens arabischer, portugiesischer und holländischer Kaufleute. Dennoch war Stamford Raffles’ Stempelabdruck auf Java bedeutend. Nachdem er mit militärischer Gewalt die Kontrolle über die Insel erlangt hatte, wählte Raffles einheimische Sultane aus, welche über die Fürstentümer Javas und die entsprechenden riesigen Anbauflächen herrschten. Bis dahin ist es die bekannte Saga der europäischen Eroberung. Doch in einer Hinsicht unterschied sich Raffles von seinen niederländischen Vorgängern radikal: Er interessierte sich sehr für die Kultur Ostindiens.
Abbildung 11 Porträt von Sir Stamford Raffles, gemalt von George Francis Joseph (1817). Die Landschaft im Hintergrund deutet auf den fruchtbaren »Garten Eden« Ostindiens hin, über das Raffles herrschte, während die vielen Papiere und asiatischen Artefakte für sein gelehrtes Investment in The History of Java stehen, die im gleichen Jahr publiziert wurde, in dem auch das Porträt entstand. Der hinduistische Charakter von Raffles’ Kunstsammlung ist Absicht: Raffles bemüht sich in seiner History sehr, die »eingeborenen« hinduistischen Traditionen, die besser zu den englischen Kolonialherren passten, gegenüber der jüngeren Einführung der islamischen Kultur aufzuwerten.
In den zwei Jahrhunderten der niederländischen Herrschaft wurde kaum einmal eine Abhandlung über irgendeinen Aspekt der Geschichte, Sitten oder Sprache Javas verfasst. In seiner nur fünf Jahre dauernden Amtszeit hingegen entwickelte sich Raffles zu einer Art Philosophen-König oder, vielleicht zutreffender, zu einem Anthropologen mit unbegrenztem Forschungsbudget, einem gut bewaffneten Regiment und keinerlei professionellen Vorschriften, an die er sich hätte halten müssen. Er lernte Javanisch, Malaiisch sprach er bereits fließend, erstand alle historischen Manuskripte, die er nur finden konnte, und beschäftigte eine Heerschar von einheimischen Kopisten, um eine Bibliothek mit javanischem Quellenmaterial zu erstellen. Er entsandte ein Heer von Assistenten ins Gelände zum Sammeln von Tieren, Pflanzen und geologischen Proben jedweder Art sowie Künstler, die Zeichnungen anfertigen sollten. Als die Nachricht von der Sammelwut des englischen Gouverneurs sich herumsprach, schickte ihm der Prinz einer nahegelegenen Insel einen Orang-Utan, den Raffles wie einen Mann in Rock, Hosen und Hut steckte.29 Raffles sollte später auch der Gründer und erste Präsident des Londoner Zoos werden.
Der Gouverneur führte den Vorsitz über seine ausufernde Menagerie und Forschungsfabrik als deren Prosa-Synthetiker, als eine Art oberster Mythenschöpfer der javanischen Geschichte. Nachdem er seine europäischen Kollegen beim Dinner unterhalten hatte, pflegte er sich in sein Arbeitszimmer zu begeben, wo für ihn Feder, Tinte und Papier bereitlagen und zwei große Kerzen angezündet waren. Nachdem er eine Zeit lang auf und ab geschritten war, legte er sich mit geschlossenen Augen, als ob er schlafen würde, auf seinen Schreibtisch, dann zuckte er plötzlich hoch und schrieb wie rasend bis nach Mitternacht. Am Morgen las er das Geschriebene nochmals durch, legte drei von zehn Blättern zur Seite und zerriss den Rest.
Das Resultat dieser obsessiven Gelehrsamkeit hat man den ersten »Klassiker der südostasiatischen Historiographie« genannt.30 Die zwei Bände von Raffles’ The History of Java (Geschichte Javas, 1817) wollen einen umfassenden Bericht über die Kultur Javas im Stile der westlichen Aufklärung geben und sind gegliedert in die Rubriken Geologie und Geographie, Landwirtschaft und Manufakturerzeugnisse, Sprache und Sitten, Geschichte und Regierung. Doch trotz des ganzen Apparats an gelehrter Objektivität vertritt The History of Java auf Schritt und Tritt eine spezielle politische Agenda. Eingewoben in botanische Beschreibungen und historische Berichte sind eine anschauliche Stimmungsmache im Stil von Reiseberichten, anti-niederländische Polemik und eine auf Reformen bedachte Kolonialpolitik, allesamt dazu gedacht, für eine fortdauernde britische Verwaltung des Archipels rund um Java, darunter auch Sumbawas, zu werben.
Für seine Vorgesetzten in der Ostindien-Kompanie malt Raffles ein poetisches Bild der Region Java als Garten Eden der landwirtschaftlichen Möglichkeiten, der reif für eine Entwicklung durch die Europäer sei:
Man kann sich nichts Schöneres für das Auge oder Befriedigenderes für die Vorstellungskraft denken als den Blick auf die reiche Mannigfaltigkeit an Bergen und Tälern, der üppigen Pflanzungen und Obstbäume oder Wälder, der natürlichen Flüsse und künstlichen Wasserläufe … Es ist schwer zu sagen, ob der Bewunderer der Landschaft oder der Kultivator des Bodens von dem Anblick am meisten zufriedengestellt sein wird. Das ganze Land, wie es von den Bergen beträchtlicher Höhe aus zu sehen ist, wirkt wie ein reichhaltiger, diversifizierter und gut gewässerter Garten.31
Dem Wirtschaftstheoretiker Adam Smith, den Raffles häufig zitiert, war das niederländische Kolonialmonopol ein Gräuel. Er riet dem jeweiligen Herrscher des aufstrebenden Britischen Empire, die Monopolwirtschaft zugunsten eines Freihandelssystems aufzugeben, um »den Absatzmarkt weitestgehend für die Erzeugnisse seines Landes zu öffnen, einen vollkommenen freien Handel zuzulassen, um damit die Zahl der Käufer zu erhöhen und den Wettbewerb unter ihnen zu verschärfen«.32 Java und die umliegenden Inseln waren somit keineswegs nutzlos, argumentierte Raffles, sondern ein natürliches Labor für eine freie Marktwirtschaft und eine goldene Gelegenheit für eine fortschrittliche Kolonialmacht, sich selbst wie auch ihre Untertanen reich zu machen.33
Abbildung 12 Eine idealisierte Landschaft auf Java aus dem frühen neunzehnten Jahrhundert zeigt eine idyllische Szenerie; sie demonstriert aber auch, wie nah sich das dörfliche Leben an den Feuerbergen abspielte, die sich in Ost-West-Richtung durch den Ostindischen Archipel ziehen.
Das klang natürlich alles in der Theorie sehr gut – wenn man einmal von dieser kleinen Sache mit den Vulkanen absieht. Raffles’ Herausforderung 1815, als selbststilisierter imperialer Visionär, war es, diese modernen Treibhaus-Ideen des freien Handels und politischer Freiheit an eine völlig andere kulturelle Ökologie anzupassen: an eine, in der alles – vom fruchtbaren Boden unter seinen Füßen über die allgegenwärtigen Berge, die sich vor dem Himmel abzeichneten, bis hin zum Jodsäuregehalt ebendieses Himmels – vulkanisch war und deren Bewohner die Geschichte in den erinnerten Kataklysmen von Vulkanausbrüchen maßen.
In Batavia wachte Raffles am 11. April 1815 spät im Dunkeln auf, nachdem er sein nächtliches Quantum einer britischen Vorherrschaft über Ostindien geträumt hatte. Als er dann in seinem vizeköniglichen Garten durch kniehohe Asche watete, waren bereits zehntausend seiner sumbawanischen Untertanen tot. Seine erste Reaktion auf die Katastrophe war dem Wesen nach sowohl die eines modernen Bürokraten wie auch jene des Gelehrten: Er forderte von seinen regionalen Untergebenen umfassende schriftliche Berichte über das Ereignis. Doch das volle Ausmaß der Verheerung scheint dem britischen Gouverneur fatal langsam gedämmert zu sein. Erst im August, als er Berichte über eine Hungersnot auf Sumbawa hörte, entsandte er als eine Form der Katastrophenhilfe ein Schiff mit Reis unter der Einsatzleitung von Lieutenant Owen Phillips. Raffles äußert sich voller Stolz über diese Tat in seiner History, wenngleich seine humanitäre Geste nach unserem heutigen Maßstab erbärmlich unzureichend war: nur ein paar hundert Tonnen Reis, gerade mal genug, um zwanzigtausend Überlebende auf Sumbawa etwa eine Woche lang zu ernähren.
Angesichts des kataklystischen Ausmaßes des Tambora-Ausbruches wird diesem in Raffles’ History of Java auch seltsam wenig Platz eingeräumt. Die Schilderung der Eruption ist nicht in den langen Kapiteln über die Geschichte Javas oder auch nur in dem großzügig bemessenen Abschnitt über Vulkane zu finden. Vielmehr ist sie in eine mehrere Seiten lange Fußnote zwischen Abhandlungen über Javas »Mineralogische Beschaffenheit« und dessen »Jahreszeiten und Klima« gequetscht, als eine Episode, die für seine Leser »nicht uninteressant sein dürfte«. Raffles ist somit der Erste in einer langen Reihe westlicher Historiker, die den Impakt des Tambora nicht erkennen oder – wie in seinem Fall – vorsätzlich leugnen. Seine Zurückhaltung in Bezug auf den Vulkanausbruch ist leicht zu erklären. Raffles präsentiert den Tambora lediglich als Naturwunder, als vulkanische Licht-und-Ton-Show, denn sein Eintreten für ein britisches Java konnte wegen dessen Nähe zu riesigen Vulkanen, welche die regionale Wirtschaft innerhalb von Stunden in den völligen Ruin treiben konnten, nur unterminiert werden.
Vulkanwinter 1816 beginnt folglich als Geschichte einer Naturkatastrophe – als ein Pompeji des Ostens oder eines hundertmal stärkeren Hurrikans Katrina –, deren Schicksal es war, nahezu ohne jedes schriftliches Zeugnis zu bleiben. Raffles hatte kurz vor der Eruption die Anfänge eines »Temboranischen [sic]« Wörterbuches zusammengestellt, das er als eine Art Grabspruch in einen Anhang seiner History of Java aufnahm. Aber wie Raffles’ Wörterbuch ist auch die Geschichte des Tambora immer nur in Fußnoten und Skizzen erzählt worden, wobei große Löcher ungestopft blieben. Anstatt als weltgeschichtlich bedeutsame Erzählung hat der kolossale Ausbruch auf der Insel Sumbawa im Jahr 1815 – in fernen Ländern und anderen Sprachen – lediglich als Wettersage überdauert: als das legendäre »Jahr ohne Sommer«. Wie die folgenden Kapitel jedoch zeigen werden, erfordert die weltverändernde Tragweite des Tambora eine episch breite Darstellung, die weit über die eingefrorenen Erinnerungen eines einzelnen, lange vergangenen Sommers hinausgeht.