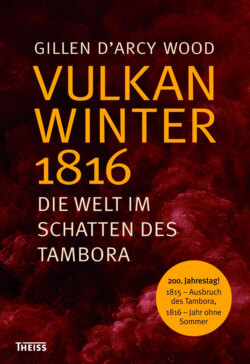Читать книгу Vulkanwinter 1816 - Gillen Wood - Страница 16
Die letzte Hungersnot in Europa
ОглавлениеDer prägende Einfluss der Tambora-Eruption auf die Geschichte der Menschheit beruht nicht auf isolierten extremen Wetterereignissen, sondern auf den unzähligen ökologischen Folgen eines aus den Fugen geratenen Klimasystems. Wie erwähnt klingt der volkstümliche Name, den das Jahr 1816 erhielt, nämlich das »Jahr ohne Sommer«, viel zu freundlich, als handelte es sich lediglich um die kleine Unannehmlichkeit, im Juli in den Mantel schlüpfen zu müssen, wo »kein Sommer« doch de facto für Millionen Menschen »nichts zu essen« bedeutete. Infolge des lang anhaltenden schlechten Wetters fielen in den Jahren 1816 bis 1818 die Ernteerträge auf den Britischen Inseln und in Westeuropa um 75 Prozent und mehr. Tamboras Visitenkarte in Deutschland, wo die Zeit als »Betteljahr« – oder in der Schweiz als »L’Année de la Misère« und das »Hungerjahr« – in der Erinnerung haften blieb, trifft die Stimmung einer sozialen Krise während des Extremwetters jener Jahre besser. Im ersten Sommer von Tamboras kaltem, nassem und windigem Regiment – der »atmosphärischen Sarabande« von 1816 – verfaulten die europäischen Ernten elendiglich. Die Bauern ließen die Pflanzen so lange sie es eben wagten, auf den Feldern stehen, in der Hoffnung, ein Teil würde im spät kommenden Sonnenschein doch noch reif werden. Doch die herbeigesehnte Wärme kam nicht, und schließlich, im Oktober, gaben sie auf. Sie ließen die Kartoffeln auf den Feldern verrotten und ganze Gerste- und Haferfelder bis zum nächsten Frühjahr unter dem Schnee liegen.
In Deutschland ging der Abstieg vom schlechten Wetter über die Missernte bis hin zur Hungersnot erschreckend rasch vonstatten. Carl von Clausewitz, der Militärstratege, erlebte »herzzerreißende« Szenen, als er auf dem Rücken seines Pferdes im Frühling 1817 durch das Rheinland reiste. »Ich sah stark geschwächtes Volk, kaum mehr menschlich, das auf der Suche nach halb verfaulten Kartoffeln über die Äcker lief.«25 Im Winter 1817 brachen in Augsburg, Memmingen und anderen deutschen Städten Unruhen aus wegen des angeblichen Exports von Getreide in die hungernde Schweiz, obwohl die Einheimischen gezwungen waren, Pferde- und Hundefleisch zu essen.26
Auch in England kam es in den Städten von East Anglia bereits im Mai 1816 zu Aufständen. Bewaffnete Arbeiter trugen Fahnen mit der Aufschrift »Brot oder Blut« bei ihrem Marsch auf die anglikanische Bistumsstadt Ely, nahmen dort die Friedensrichter als Geiseln und lieferten sich eine wilde Schlacht mit der Miliz.27 In Somersetshire besetzten dreitausend Bergleute in ihrer Verzweiflung über die himmelschreiend hohen Brotpreise die örtliche Kohlenzeche. Als sie gefragt wurden, was sie wollten, entgegneten sie: »… vollen Lohn, und dass sie am Verhungern wären.« Der örtliche Friedensrichter reagierte mit der Verlesung des Riot Act, drohte allen Simulanten mit der Todesstrafe und schickte die Miliz, die auf die Menschenmenge mit »ungeheuer großen Knüppeln« losging.28 In einer anderen Größenordnung demonstrierten im März 1817 mehr als zehntausend Menschen in Manchester, während im Juni die sogenannte Pentrich Revolution auch den Plan umfasste, in die Stadt Nottingham einzudringen und diese zu besetzen. Die Armee erhielt den Befehl, ähnliche Unruhen in Schottland und Wales zu unterdrücken. Die Regierung von Lord Liverpool reagierte auf die Verzweiflung der Menschen mit drakonischer Gewalt. Sie untersagte die Veröffentlichung der landwirtschaftlichen Quartalsberichte und setzte den Habeas Corpus Act, das Gesetz zum Schutz der persönlichen Freiheit, außer Kraft. Die Provinzgefängnisse waren überall im Königreich überfüllt, obgleich viele hungernde Aufständische gehängt oder übers Meer in Strafkolonien geschickt wurden.29
In seinem maßgeblichen Buch über den sozialen und wirtschaftlichen Aufruhr in Europa während der Tambora-Zeit hat der Historiker John Post gezeigt, dass das menschliche Leid am schlimmsten in der Schweiz war, wo sich Mary Shelley und ihr Kreis im Jahr 1816 aufhielten. Selbst in normalen Zeiten wandte eine Schweizer Familie mindestens die Hälfte ihres Einkommens für den Kauf von Brot auf. Bereits im August 1816 war Brot knapp, und im Dezember drohten in Montreux Bäcker damit, die Produktion einzustellen, wenn sie nicht die Preise anheben dürften.30 Als sich der Preis für Getreide 1817 dann nahezu verdreifachte, konnten sich Hunderttausende Schweizer mit einem Mal die Grundnahrungsmittel nicht mehr leisten, nicht nur in den ländlichen Regionen, sondern auch in den industrialisierten Städten, wo »der Wochenlohn einer Handspinnerin 1817 … unter dem Preis für ein Pfund Brot lag«.31 Mit der drohenden Hungersnot wuchs auch die Gefahr von »soulèvements« – gewalttätigen Aufständen. In den Marktflecken überfiel der hungernde Mob Bäcker und zerstörte deren Läden. Stratford Canning, der englische Botschafter in der Schweiz, schrieb an seinen Premierminister, dass ein Heer von erwerbslosen hungernden Bauern sich sammle, um nach Lausanne zu marschieren.
Wie es der historische Zufall wollte, verbrachte Stamford Raffles, nachdem er seinen Gouverneursposten in Java aufgegeben hatte, diesen elenden Sommer auf Reisen quer durch Europa. Ihm gebührt somit die zweifelhafte Ehre, dass er der Einzige war, der sowohl einen Bericht über den Ausbruch des Tambora in Ostindien im Jahr 1815 als auch über die folgenden Jahre mit Extremwetter und Hungersnot in Europa – auf der anderen Seite der Welt – hinterließ. Raffles und seinem Bruder Thomas, der ihn begleitete und ein Tagebuch führte, kamen die Dörfer in der französischen Provinz wie Geisterstädte vor:
Wir konnten nicht umhin zu bemerken, dass nahezu alles Leben und jegliche Aktivität fehlten … Eine Atmosphäre der Düsternis und Verlassenheit durchdrang sie. Die Häuser wirkten freudlos und vernachlässigt. Auf den Straßen war kein Mensch zu erblicken – sie sahen aus, als wären sie von den Einwohnern verlassen worden.
Überall in Frankreich verdarb die Getreideernte auf den vom Regen vollgesogenen Feldern, und die Weinhändler hatten 1816 die magerste Traubenlese in den seit Jahrhunderten geführten Aufzeichnungen. Beim Grenzübertritt in das Binnenland Schweiz, wo die Getreidepreise um das Zwei- bis Dreifache höher stiegen als in den Küstenregionen, fanden die Raffles-Brüder, die Nahrungsmittelknappheit sei sogar noch schrecklicher: »… die große Zunahme der Bettler … in der Hauptsache Kinder … war wirklich erstaunlich.«32
Bei der Bewältigung der Krise hatten die Schweizer Behörden wegen der kleinräumigen politischen Struktur Probleme. Als eine schwere Hungersnot drohte, bekamen die zuständigen Stellen der kleinen Kantone Panik und schlossen die Grenzen für den Handel mit Getreide, womit sie selbst allerdings auch keinerlei Hilfsgüter mehr importieren konnten. Öffentliche Arbeitsbeschaffungsprogramme und Suppenküchen wendeten eine noch größere Katastrophe ab, aber dennoch verhungerten in der »letzten großen Subsistenzkrise« Kontinentaleuropas Tausende. Ein Priester aus dem Kanton Glarus zeichnete ein beklagenswertes Porträt der leidenden Menschen in seinem Sprengel: »Es ist entsetzlich zu beobachten, wie diese wandernden Skelette die abscheulichsten Lebensmittel mit solcher Gier verschlingen: Viehkadaver, stinkende Nesseln – und sie mit Tieren um Abfälle kämpfen zu sehen.«33 Allerorten suchten verzweifelte Dorfbewohner ihr Heil in einer mitleiderregenden Hungerkost bestehend aus »den ekelhaftesten und widernatürlichsten Lebensmitteln«.34 Die Sterblichkeit lag in der Schweiz 1817 um 30 Prozent über der bereits gestiegenen Mortalitätsrate im Kriegsjahr 1815. Zudem übertrafen die Todesfälle die Geburten sowohl 1817 wie auch 1818, was auf eine zusätzliche Sterblichkeitsrate in Höhe von Zehntausenden Menschen schließen lässt. Nur die ab und an und gerade noch zur rechten Zeit eintreffenden Getreidelieferungen aus Russland, das zufällig von den schlimmsten Wetterbedingungen nach dem Tambora-Ausbruch verschont blieb, verhinderten, dass die Schweiz und ein Großteil Europas in einer regelrechten Hungersnot kollabierten.
Doch selbst so waren die Zustände schon verzweifelt genug. Den Besuchern des Kontinents erschienen 1817 die Legionen von vagabundierenden Armen, die in die Marktflecken einfielen, wie die vorrückenden Säulen eines Heeres auf dem Marsch. Der Präfekt von Brie beschrieb den Flüchtlingsstrom in sein Département als »eine Invasion oder vielleicht die Einwanderung einer ganzen Nation«.35 In ihrem unerträglichen Leid verloren die Bettler jede Angst vor dem Gesetz. Brandstiftung, Tätlichkeiten und Raubüberfälle fegten in Wellen durch die ländlichen Regionen. Der Tagebuchschreiber in Montreux berichtete über die weit verbreitete Angst, »Szenen aus der Zeit der Goten und Vandalen« könnten wiederkehren.36 Einige Schweizer Behörden reagierten unweigerlich zu heftig. Diebe wurden geköpft und kleinere Diebstähle wurden mit Auspeitschen bestraft.
Am erschreckendsten war jedoch das Schicksal mancher verzweifelter Mütter. In den entsetzlichen Zuständen, die auf der ganzen Welt in der Tambora-Zeit ähnlich waren, ließen einige Schweizer Familien in der Krise ihren Nachwuchs im Stich, während andere beschlossen, ihre Kinder umzubringen, da dies humaner wäre. Für dieses Verbrechen wurden einige hungernde Mütter verhaftet und enthauptet. Tausende Schweizer, die mehr Mittel und Widerstandskraft besaßen, emigrierten nach Osten in das wohlhabende Russland, während andere sich auf dem Rhein nach Holland aufmachten, von wo sie nach Nordamerika fuhren, das in den Jahren 1817 bis 1819 die erste große europäische Einwanderungswelle im neunzehnten Jahrhundert erlebte. Die Zahlen der europäischen Neuankömmlinge, die 1817 in US-amerikanischen Häfen ankamen, waren doppelt so hoch wie im Jahr zuvor.37
Auf politischer Ebene trieben in der Tambora-Zeit Nahrungsmittelknappheit und soziale Instabilität die Regierungen in den autoritären Rechtsrutsch, den wir mit der ideologischen Landschaft des postnapoleonischen Europa verbinden. Mit den Worten des Schweizer liberalen Journalisten Eusèbe-Henri Gaullieur (einem leicht zu beeindruckenden Jungen zurzeit der Krise): »Die Gewinne, die der Geist des fortschrittlichen Liberalismus gemacht hatte, wurden beträchtlich aufgezehrt … durch das Leid, das aus dem Desaster von 1816 entstand.« Angst vor Ausfällen in der Landwirtschaft brachten die Regierenden außerdem dazu, eine protektionistische Politik zu verfolgen. Genau in der Zeit der Tambora-Katastrophe werden erstmals Zoll- und Handelsschranken im europäischen und transatlantischen Wirtschaftssystem zur Norm.38