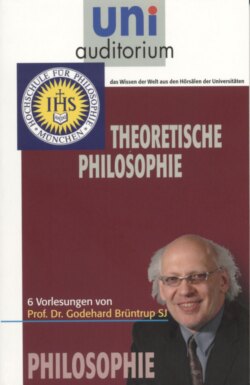Читать книгу Theoretische Philosophie - Godehard Brüntrup - Страница 10
1.4 Realismus und Antirealismus
ОглавлениеIch möchte Ihnen das am Beispiel des Freiheitsbegriffes verdeutlichen. Die Welt, in der wir leben, ist entweder deterministisch oder sie ist nicht deterministisch, also indeterministisch. Wenn sie deterministisch ist, dann gibt es zu jedem beliebigen Zeitpunkt nur eine mögliche Zukunft. Wenn sie nicht deterministisch ist, dann gibt es zu beliebigen Zeitpunkten mehr als eine mögliche Zukunft. Nun sagen manche, dass in einer deterministischen Welt, in der zu jedem beliebigen Zeitpunkt die Zukunft bereits feststeht, weil es nur eine mögliche Zukunft gibt, keine Freiheit vorkommen kann, weil Freiheit bedeutet, dass man zwischen zwei Möglichkeiten auswählt, mindestens zweien. Und es ist noch nicht entschieden, welche der beiden denn nun eintritt. Andere wiederum sagen, für den Freiheitsbegriff ist es gar nicht wichtig, ob die Zukunft offen ist. Für den Freiheitsbegriff, damit ich frei handle, reicht vollkommen, dass ich nicht einem äußeren Zwang unterliege, dass mir nicht sozusagen jemand die Pistole auf die Brust setzt und sagt: Halte jetzt diese Vorlesung, und wenn nicht, passiert was. Welcher dieser beiden Freiheitsbegriffe, nämlich der, der sagt, die Zukunft muss offen sein und ich muss auswählen können, ob ich A oder B tue, oder der Freiheitsbegriff, der sagt, Freiheit ist die Abwesenheit von Zwang, welcher der beiden Freiheitsbegriffe der richtige ist, mit dem wir arbeiten wollen, wie wir Freiheit verstehen wollen, ist keine empirische Frage. Dazu können wir nicht oder sollten wir gar nicht Neurophysiologie betreiben und das Gehirn untersuchen, denn eine Antwort darauf, was Freiheit überhaupt ist, werden wir im Gehirn nicht finden.
Die Frage nach dem Freiheitsbegriff, das wird später eine eigene Vorlesung in dieser Reihe sein, ist also eine genuin philosophische Frage, eine Frage der Begriffsanalyse.
Ich möchte Ihnen nun, damit es ein bisschen konkreter wird, an einem Beispiel zeigen, wie man metaphysisch denkt, nämlich an dem Idealismus von Berkeley. Bischof Berkeley, ein englischer Philosoph, hat ein frappierendes Argument vorgebracht, das wir wenigstens in seinen allergrößten Grundzügen hier einmal kurz als Beispiel für eine metaphysische Theorie vorstellen wollen. Berkeleys These, die ja detailliert entwickelt ist, sagt, dass alle existierenden Entitäten, also alle existierenden Seienden entweder Wahrnehmende sind oder sie werden wahrgenommen. Alltägliche Objekte existieren nur, insofern sie wahrgenommen werden.
Es gibt also nichts, was nicht entweder selbst ein Wahrnehmendes ist oder ein Wahrgenommenes ist. Daher der berühmte Ausspruch: „esse est percipi – Sein ist wahrgenommen werden“.
Die Argumente für diese Position von Berkeley waren: Jedes physische Objekt - schauen Sie sich um im Raum, wo Sie jetzt sind - ist doch nur eine Ansammlung wahrnehmbarer Qualitäten. Farben, Abschattierungen von Farben, taktile Qualitäten, Sie können es anfassen, es ist hart oder weich. Und er sagt, jede wahrnehmbare Qualität ist eine Idee. Und keine Idee existiert außerhalb der Wahrnehmung. Also existiert kein physisches Objekt außerhalb der Wahrnehmung.
Und er sagt weiter: Man kann sich ein Objekt der Sinneserfahrung nicht außerhalb des Mentalen vorstellen. Jede Vorstellung von einem Ding an sich, jenseits all unserer Vorstellungen, ist wiederum nur ein mentales Bild, nur eine Idee. Also wenn ich mir etwas vorstelle, was außerhalb all unserer Vorstellungen liegt, ist es wieder nur eine Vorstellung. Wir kommen sozusagen aus dem Gefängnis unserer Vorstellungen nicht heraus. Das außerhalb der Vorstellungen Gedachte ist selbst wieder etwas Gedachtes, eine Vorstellung.
Und nun kritisieren vor diesem Hintergrund Berkeley diejenigen Materialisten, die sagen, hinter den wahrgenommenen Dingen müsste sozusagen eine materielle Substanz liegen, die Materie. Ein reines Zugrundeliegendes, ein Substrat, wie die Philosophen sagen, das allen sinnlichen Erfahrungen zugrunde liegt. Aber man muss diesem Substratum ja wieder irgendwelche Eigenschaften zusprechen, zum Beispiel „ausgedehnt“. Das gelingt aber nur, wenn man erfahrbare Qualitäten annimmt. Zum Beispiel, dass es eine bestimmte Farbe hat. Wenn Sie dieses Zugrundelegende denken wollen ohne jegliche sinnliche Qualitäten, geht es Ihnen verloren. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Machen wir uns eine ganz einfache Welt. Ein Rechteck, das soll unsere Welt sein. Da drin sind drei kleine Teilchen, drei kleine Partikel. Der Rest unserer Welt ist Vakuum. Nennen wir das die Partikelwelt. Und jetzt stellen Sie sich noch eine zweite Welt vor, die genauso ist wie diese, nur ist es kein Vakuum. Diese Welt ist gleichmäßig mit irgendetwas gefüllt. Irgendeinem Medium. Wasser oder irgendetwas. Und in diesem Medium gibt es drei kleine Blasen, genauso groß wie vorher in der Partikelwelt unsere Partikel. Und auch noch an derselben Stelle. Nennen wir die eine die „Partikelwelt“ und die andere die „Plenumswelt“. In der einen Welt haben wir Vakuum mit drei Partikeln drin, in der anderen haben wir etwas Gefülltes, ein Plenum, in dem drei kleine Blasen sind, genauso groß und an derselben Stelle wie in der Partikelwelt die Partikel.
Wenn Sie sich nun vorstellen wollen, dass zum Beispiel die Partikel ein materieller Träger sind, einen materiellen Träger haben, etwas Festes, und rundherum das Vakuum ist, stellen Sie sich das vor Ihrem geistigen Auge vor, dass Sie zum Beispiel die Partikel vor Ihrem geistigen Auge dunkel malen und das Vakuum rundherum hell, so dass sich diese Partikel davon absetzen. Und wenn Sie sich jetzt die Plenumswelt vorstellen, in der anstelle der Partikel an derselben Stelle nur drei kleine Vakua sind, drei kleine Blasen, und alles andere gefüllt ist, dann machen Sie es vielleicht umgekehrt, Sie füllen vor Ihrem geistigen Auge das Plenum dunkel und die drei kleinen Blasen hell.
Das zeigt, wie auch immer Sie sich die letzte materielle Weltstruktur vorstellen wollen, Sie arbeiten immer mit sinnlichen Bildern, mit anschaulichen Bildern. Und daher, sagt Berkeley, kann man sich eine Welt jenseits jeglicher Anschaulichkeit nicht vorstellen. Und die muss man auch nicht annehmen. Das ist für ihn dann schlechte Metaphysik sozusagen.
Der Materialist nimmt da eine Materie an, jenseits aller Wahrnehmungen, die es nicht gibt. Und dann folgt daraus eben, dass ein alltäglicher Gegenstand nichts anderes ist als seine wahrnehmbaren Eigenschaften. Und die wahrnehmbaren Eigenschaften alltäglicher Gegenstände sind identisch mit den Sinnesdaten, die wir haben, wenn wir sehen, hören oder tasten.
Dann fragen Sie natürlich, na ja, wie ist das denn, wenn die alltäglichen Gegenstände nur als wahrgenommene existieren. Was passiert in Berkeleys Theorie denn mit den Gegenständen, wenn keiner hinguckt? Da hat er eine ganz pfiffige Antwort. Er war Theist, er glaubte an Gott, und hat gesagt: Gott schaut immer hin. Solange Gott hinschaut, sind auch die Gegenstände da. Die Gegenstände sind sozusagen Wahrnehmungen Gottes. Das heißt, selbst in dieser Theorie, wo alles nur aus Wahrnehmungen besteht, zugegebenerweise eine etwas abstruse metaphysische Theorie, aber eine, die immerhin doch argumentativ gute Gründe für sich hat, selbst in dieser Theorie kann man es schaffen, dass es eine objektive Realität gibt. Sie ist unabhängig von dem, was der menschliche Geist sich ausdenkt. Indem nämlich hier ein objektiver Geist angenommen wird, der garantiert, dass die Dinge auch dann noch da sind, wenn wir nicht hinschauen. Und trotzdem sind die Dinge nichts anderes als wahrgenommen werden – esse est percipi.
Dieses Beispiel sollte Ihnen einfach mal in einem Kurzdurchgang eine ziemlich gewagte metaphysische These vor Augen führen, dass Sie ein Gespür bekommen dafür, was überhaupt eine metaphysische Weltsicht ist. Sie spüren sofort, dass sie jetzt Argumente brauchen wenn Sie sagen, das ist nicht meine Sicht. Wo macht Berkeley etwas falsch? Und schon sind Sie mitten im metaphysischen Diskurs.
Aber wir sind an dieser Stelle auch an etwas anderes, auf etwas anderes Wichtiges gestoßen. Nämlich, dass das metaphysische Denken immer ein Denken ist, das für die Objektivität der Außenwelt argumentiert. Selbst Bischof Berkeley, der sagt, „alles Sein ist wahrgenommen werden“ postuliert, „die Dinge sind objektiv“, weil der absolute Geist oder Gott sie wahrnimmt. Das heißt, wenn der Mensch wegschaut, sind die Dinge trotzdem noch da. Wir machen die Welt nicht. Wir bringen die Welt nicht hervor.
Man spricht deshalb auch von metaphysischem Realismus. Alle Kritiker, die meisten Kritiker der Metaphysik, lehnen diesen sog. metaphysischen Realismus, die Idee der Objektivität der Außenwelt ab. Das werden wir im Folgenden der Vorlesungen noch genauer sehen. Aber schauen wir uns das einmal an. Was ist metaphysischer Realismus?
Die erste These ist, dass die von uns unabhängig existierende Außenwelt jeden sinnvollen Behauptungssatz entweder wahr oder falsch macht. Man spricht auch von Bivalenz – zwei Wahrheitswerten, wahr oder falsch. Und die Welt besteht, die nächste These, aus Dingen oder Entitäten, deren Identitätsbedingungen, also das, was sie ausmacht, was sie sind, unabhängig von unserem Wissen über sie bestehen. Also wir machen nicht die Welt. Die Dinge identifizieren sich selbst. Und daraus folgt dann die nächste These: Es gibt eine einzige wahre Theorie über die Welt, die die Welt genauso beschreibt, wie sie ist. Die ist aber für den begrenzten Verstand des Menschen unerreichbar.
Und schließlich - das ist sozusagen der Lackmustest, ob jemand Realist oder Antirealist ist - sagt der Realist, der metaphysische Realist, dass Wahrheit nicht nach menschlichem Maß gemessen werden kann. Wahrheit ist die Übereinstimmung von Aussage und Sachverhalt. Und unsere Wahrheitskriterien, dass eine Theorie gute Vorhersagen liefert, dass sie praktisch ist, dass sie gut angewendet werden kann, all diese menschlichen Kriterien für Wahrheit garantieren nicht, dass die Theorie die Wirklichkeit richtig trifft. Das heißt, auch eine nach menschlichem Maß ideale Theorie könnte immer noch falsch sein, sagt der metaphysische Realist.
Die Gegenposition, und das sind gleichzeitig die Kritiker der Metaphysik, verneinen genau das.
Bleiben wir gleich beim letzten Punkt. Sie sagen, dass eine nach menschlichem Maß ideale Theorie per definitionem wahr ist. Denn Wahrheit wird nach menschlichem Maß definiert. Wahrheit ist nicht die Übereinstimmung der Sache, der Aussage mit der Sache, sondern Wahrheit ist, dass unsere menschlichen Anforderungen an die Theorie erfüllt werden. Die Antirealisten verneinen auch die erste These, nämlich dass die unabhängige Außenwelt jeden Satz, über sie sinnvollen Satz wahr oder falsch macht. Sie sagen, es gibt Fälle, in denen ein Satz, der zwar sinnvoll ist, weder wahr noch falsch ist. Also einen dritten Wahrheitswert. Und die gesamte Vorstellung einer geistunabhängigen fertigen Welt, sagen sie, ergibt gar keinen Sinn, ist unintelligibel.
Und sie sagen drittens: Es gibt nicht nur eine komplette, wahre Beschreibung der Welt, sondern es gibt mehrere konkurrierende wahre Beschreibungen der Welt, die möglicherweise miteinander logisch nicht verträglich sind. Dieses ganze Paket der Verneinungen des Realismus ist typischerweise das, was wir bei den Kritikern der Metaphysik finden, während die Metaphysiker auf der Seite des Realismus stehen. Deshalb spricht man eben auch oft von metaphysischem Realismus.
Um das wieder konkreter zu machen, möchte ich Ihnen ein Beispiel geben, nämlich die berühmte Goldbach’sche Vermutung des Mathematikers Goldbach. Goldbach hatte die Vermutung, dass jede gerade Zahl größer als 4 die Summe zweier Primzahlen ist. Diese Vermutung hat man bereits mit modernen Computern mit bis extrem großen, ohne maschinelle Hilfe gar nicht handhabbaren Zahlen überprüft, und sie hat sich bisher immer als richtig erwiesen. Aber, wie Sie wissen, in der Mathematik reicht es nicht, die Sache durch Beispiele zu testen. Um eine Theorie zu beweisen, braucht man einen konstruktiven Beweis, der zeigt, dass sie für alle Fälle gilt. Und einen solchen Beweis hat man für die Goldbach’sche Vermutung bisher nicht gefunden. Es könnte sich also immer noch herausstellen, dass sie nicht stimmt. Aber eine solche Widerlegung, einen Beweis, dass sie nicht stimmt, hat man auch nicht gefunden.
Jetzt können wir sehr schön den Unterschied zwischen Realisten, metaphysischen Realisten, und Antirealisten sehen. Der metaphysische Realist wird sagen: Da draußen gibt es eine mathematische Wirklichkeit. Die Welt der Zahlen. Ganz unabhängig von unserem Denken. Ob wir über die Zahlen nachdenken oder nicht, das ist völlig egal. Die existieren unabhängig von uns. Und diese Welt der Zahlen legt fest, ob die Goldbach’sche Vermutung wahr ist oder falsch. Und ob wir das wissen, spielt überhaupt keine Rolle. Wir können das vielleicht in der Zukunft entdecken durch einen konstruktiven Beweis. Die Vermutung ist aber ganz unabhängig von unseren Leistungen, unseren Verstandesleistungen, entweder wahr oder falsch. Es ist die Wirklichkeit, die mathematische Wirklichkeit selbst, die sie wahr oder falsch macht.
Dagegen sagt der Antirealist: Für mich ist ja Wahrheit, nach menschlichem Maß zu messen. Da draußen gibt es keine Realität der Zahlen. Wenn wir die Goldbach’sche Vermutung bewiesen haben, dann ist sie wahr. Wenn wir sie widerlegt haben, dann ist sie falsch. Wenn wir sie weder bewiesen haben noch widerlegt haben, wie im Moment, dann ist sie weder wahr noch falsch.
Sehen Sie, da wird der dritte Wahrheitswert eingeführt, der Realist hat nur wahr und falsch, der Antirealist hat den dritten Wahrheitswert: weder wahr noch falsch.