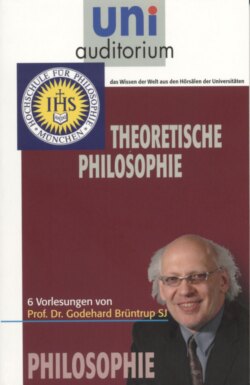Читать книгу Theoretische Philosophie - Godehard Brüntrup - Страница 13
1.7 Logischer Positivismus
ОглавлениеÄhnliches lässt sich über den logischen Positivismus sagen. Der logische Positivismus, eine Strömung der Philosophie zu Beginn des 20. Jahrhunderts, ähnelt in manchem der Kantischen Philosophie. Indem er nämlich sagt: Wenn wir hinausspekulieren über das, was uns sinnlich empirisch anschaulich gegeben ist, verlassen wir den Bereich, in dem unsere Vernunft funktioniert. Die Metaphysik ist genau in diesem Bereich.
Dieser logische Positivismus ruht auf zwei Säulen. Die eine Säule ist eine Erkenntnistheorie, und die andere Säule ist eine Bedeutungstheorie. Die Erkenntnistheorie des logischen Positivismus ist der Empirismus. Er besagt, dass alle unsere Erkenntnis aus der sinnlichen Erfahrung stammt, mit Ausnahme der Mathematik und Logik, die rein apriorische Begriffsanalyse sind.
Die zweite Säule, auf der der logische Positivismus beruht, ist der Verifikationismus. Der Verifikationismus ist eine Bedeutungstheorie, also eine Theorie darüber, wie sprachliche Ausdrücke eine Bedeutung bekommen können. Die verifikationistische Bedeutungstheorie sagt, dass die Bedeutung eines Satzes die Methode seiner Verifikation ist. Wenn Sie also die Bedeutung eines Satzes kennen, zum Beispiel „Dieses Taschenbuch hat 128 Seiten“, wenn Sie diesen Satz verstehen, dann können Sie ihn verifizieren. Sie können nachschauen und sagen, ja, es sind genau 128 Seiten. Der Satz ist also wahr.
Wenn Sie diese beiden Dinge zusammennehmen, die den logischen Positivismus ausmachen, nämlich den Empirismus auf der einen Seite, die verifikationistische Bedeutungstheorie auf der anderen Seite, dann kann man leicht zeigen, dass Metaphysik nicht möglich ist. Die einzige Methode, die wir haben, einen Satz zu verifizieren, der nicht ein rein mathematischer oder logischer Satz ist, ist, ihn durch Sinneserfahrung zu verifizieren. Und Sätze, die wir durch Sinneserfahrung nicht verifizieren können, sind nach dieser Theorie sinnlos, sie haben keine Bedeutung. In dieser Beziehung geht sie über die Kritik von Kant noch hinaus.
Für Kant sind die Gesetze der Metaphysik sinnvoll, aber für den Menschen unerreichbar. Für den logischen Positivisten ist ein Satz wie: Es gibt eine Geist-Seele, obwohl wir sie nicht sehen können im Mikroskop oder in einer Computertomographie, oder es gibt so etwas wie durch die Zeit sich erhaltende Substanzen, die keine zeitlichen Teile haben, die die Identität einer Sache ausmachen, solche Sätze sind für die logischen Positivisten völlig bedeutungslos. Es sind unsinnige Sätze, etwa wie wenn ich sage: die Tugend singt gefrorene Integrale. Bei diesem Satz erkennen wir natürlich sofort, dass er keinen Sinn ergibt, während der Satz: Es gibt eine Geist-Seele, auf den ersten Blick sinnvoll erscheint. Bei genauerer Analyse stellt sich allerdings heraus, sagen die logischen Positivisten, dass diese metaphysischen Sätze gleichermaßen sinnlos sind.
Die Grundstruktur ist also wie bei Kant. Nämlich, dass die Grenzlinie zwischen unerlaubt und erlaubt klar zu ziehen ist. Und meine Kritik ist wiederum dieselbe wie bei Kant. Ich zweifle daran, dass diese Grenzlinie so klar zu ziehen ist. Schauen wir nur auf die theoretischen Begriffe der Naturwissenschaft, die wir nicht direkt aus den Sinnesdaten haben, sondern die abstrakten theoretischen Entitäten, die wir in den Naturwissenschaften einführen, von Dingen, die wir nicht direkt beobachten können. Denken Sie an so was die Quantenmechanik, oder die Stringtheorie. Die werden allein aus mathematischen Gesichtspunkten oft eingeführt, aber nicht aus der Beobachtung gewonnen.
Nehmen wir einen einzelnen Satz, in dem eine solche Entität vorkommt, von mir aus schon so etwas wie ein Quarks oder etwas Vergleichbares, so können Sie den nicht mehr direkt an der Erfahrung verifizieren. Vielleicht lässt sich die Theorie als Ganze an der Erfahrung verifizieren, aber sicherlich nicht einzelne Sätze, so dass man sagen könnte, ein Satz, der sich nicht verifizieren lässt durch die Erfahrung, ist sinnlos. Wenn wir dieses Kriterium anlegen, sind die meisten Sätze in den abstrakten Naturwissenschaften sinnlos.
Wie ich Ihnen am Anfang gezeigt habe, gibt es sogar große Theorien innerhalb der Naturwissenschaft, die sich bisher nicht durch die Erfahrung verifizieren lassen, so in der Quantenmechanik. Wenn man also dieses strikte Kriterium des logischen Positivismus anlegt, wirft man wiederum einen erheblichen Teil unserer besten naturwissenschaftlichen Theorien mit der Physik zusammen über Bord.
Aber nicht nur das. Nehmen Sie einen Satz wie: Die Zahl der Fixsterne ist gerade. Das können wir natürlich nicht verifizieren, ob die Zahl der Fixsterne gerade ist. Wir können nicht alle Galaxien besuchen und dort die Sterne abzählen. Wir können sie auch nicht alle beobachten. Weil sie sich zum Teil verdecken oder hinter dunkler Materie verdeckt sind. Wir werden nie herausfinden, ob die Zahl der Fixsterne zu diesem Zeitpunkt gerade ist oder nicht.
Aber daraus folgt doch nicht, dass dieser Satz sinnlos ist. Der metaphysische Realist würde sogar sagen, die Wirklichkeit macht diesen Satz entweder wahr oder falsch, ganz unabhängig davon, ob wir das herausfinden können. Aber nach dem logischen Positivismus ist dieser Satz, da für uns prinzipiell nicht verifizierbar, auch sinnlos. Das scheint uns auf den ersten Blick nicht überzeugend.
Das schwerwiegendste Argument gegen den logischen Positivismus ist aber das Argument der Selbstapplikation, also der Anwendung der Theorie auf sich selber. In der Theorie kam ja die verifikationistische Bedeutungstheorie vor. Die besagte, erinnern Sie sich - die Bedeutung eines Satzes ist die Methode seiner Verifikation. Wenn ich die Methode der Verifikation eines Satzes angeben kann, dann habe ich ihn verstanden.
Jetzt fragen Sie sich: Ist dieser Satz selbst die Bedeutung eines Satzes, ist die Methode seiner Verifikation, ist dieser Satz selbst empirisch verifizierbar? Natürlich nicht. Den können sie nicht empirisch verifizieren, das ist eine philosophische Hintergrundannahme, also in diesem Sinne fast eine metaphysische These, und damit sinnlos. Damit sagt aber der logische Positivismus über sich selbst und seine zentralen Thesen, dass sie sinnlos sind. Und das ist fast das schlimmste, was einer Theorie passieren kann, dass aus ihr folgt, dass sie selber sinnlos ist. Das ist in der Tat ein schwerwiegender Einwand gegen dieses Projekt des logischen Positivismus. Sowohl beim logischen Positivismus - und das ist ein letzter Aspekt, den ich noch hervorheben möchte - wie bei Kant wird der Begriff der Analytizität fälschlich für völlig klar abgrenzbar gehalten. Die Mathematik ist analytisch, die Metaphysik nicht. Aber Aussagen, die rein begrifflich wahr sein sollen, lassen sich nicht klar abgrenzen von solchen, die wahr sind aufgrund bestimmter allgemeiner oder notwendiger Eigenschaften der realen physischen Welt.
Es fehlt ein Argument, das analytische Aussagen mittels ihrer Weltunabhängigkeit rein begrifflich absetzt von solchen, die ihre Notwendigkeit zum Beispiel aus empirischer Vertrautheit gewinnen. Ich hatte Ihnen schon das Beispiel genannt, „Raben sind schwarz“ ist analytisch. Es ist nun durchaus möglich, dass es auch außerhalb der Mathematik und Logik interessante Erkenntnisse gibt, die rein auf Begriffsanalyse beruhen. Wenn das möglich wäre, wäre ja die Metaphysik als mögliche Wissenschaft etabliert.
Ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel aus der Philosophie, das nicht unmittelbar aus der Metaphysik entnommen, aber sehr eingängig ist. Machen wir folgende Begriffsanalyse. Fragen wir uns: Schließt der Begriff moralische Verantwortung den Begriff der Absichtlichkeit ein? Ist also nur der moralisch verantwortlich, der absichtlich handelt. Also moralisch verantwortlich für seine Handlungen, wenn er sie absichtlich getan hat.
Machen wir ein Gedankenexperiment. Stellen wir uns vor, der Apotheker gibt mir versehentlich ein Medikament, das eine toxische, gesundheitsgefährdende Wirkung auf mich hat. Wenn ich ihn nun anklage vor Gericht, kann er sagen, ich habe es doch nicht absichtlich getan, also bin ich für diese Vergiftung nicht verantwortlich. Wir würden bei Reflexion über den Begriff der Verantwortlichkeit zu dem Ergebnis kommen, dass der Begriff der Verantwortung den der Absichtlichkeit nicht einschließt. In dem Falle hat der Apotheker fahrlässig gehandelt, aber unabsichtlich. Er ist trotzdem verantwortlich. Ein Beispiel einer reinen Begriffsanalyse, die uns interessante Ergebnisse liefert.
Die Metaphysik-Kritik beruht also auf der Annahme, dass es absolute präzise Grenzen zwischen Naturwissenschaft, Mathematik und Metaphysik gibt. Das ist aber fragwürdig. Auch die Naturwissenschaft enthält nichtempirische Begriffsanalyse. Auch die Mathematik ist nicht als analytisch von der sog. synthetischen Metaphysik klar abzugrenzen. Die Metaphysik als Begriffsanalyse ist zu erheblich interessanten analytischen Begriffsanalysen fähig.
Ich folgere daher, dass das Projekt der Metaphysik, wie man es auch an der florierenden Metaphysik in der heutigen Landschaft der Philosophie sieht, einer Vielzahl von Publikationen, Strömungen und Konferenzen, dass das Projekt der Metaphysik keineswegs gescheitert ist. In den folgenden fünf Vorlesungen will ich Ihnen an konkreten Beispielen zeigen, dass die Metaphysik sehr spezifische Probleme auf erhellende Weise darlegen und auch bereichernd darstellen kann.