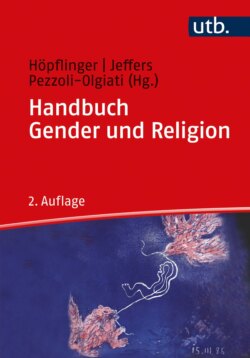Читать книгу Handbuch Gender und Religion - Группа авторов - Страница 88
2.3 Asiatische Kontexte
ОглавлениеKwok Pui-Lan und Meyda Yeğenoğlu betonen die spezifische Form, die missionarische und kolonialistische Bestrebungen im 19. Jahrhundert in Bezug auf die reichen Kulturen des »Orients« angenommen haben. Dabei wurden »die wahrgenommene Rückständigkeit, der Analphabetismus und die Promiskuität der einheimischen Frauen den viktorianischen Idealen von Weiblichkeit, wie Bildung, Hygiene und sexuelle Zurückhaltung, gegenübergestellt«.24 Westliche Kolonialherren und Missionare betrachteten die Frau als »die Essenz des Orients«,25 beispielhaft aufgezeigt anhand kultureller Praktiken wie »Füßebinden, Polygamie, sati und verschleierter Frauen«.26 Solche Praktiken müssten – so die Meinung – radikal durch den modernisierenden und befreienden Westen verändert werden: eine Einstellung, die sich in der Zweiten Welle des Feminismus fortsetzt.
Sowohl Kwok als auch Yeğenoğlu weisen jedoch daraufhin, dass alle Körper kulturelle Räume darstellen: »stets schon durch sozialen Druck markiert, beschriftet und eingraviert«.27 Der westliche weibliche Körper, keineswegs ein erstrebenswertes Vorbild der Befreiung für andere Kulturen, ist einer starken Sexualisierung ausgesetzt und wird nach einem idealisierten, unerreichbaren Frauenbild modelliert.
Die Befreiungsbewegungen, die aus der reichen Vielfalt Asiens entstanden, richten ihren Fokus auf die komplexen Ungerechtigkeiten, mit denen Frauen konfrontiert werden. Frauen werden oft als die Unterdrückten der Unterdrückten erkannt: in Korea, die »Minjung of the minjung«;28 in Indien, »the Dalits of the Dalits« oder auch »thrice Dalits«. Ruth Manorama, eine Dalit-Frauenrechtsaktivistin, begründet die Prägung des letztgenannten Begriffs damit, dass Dalit-Frauen »aufgrund von Kaste, Gesellschaftsklasse und Gender diskriminiert werden«.29